Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos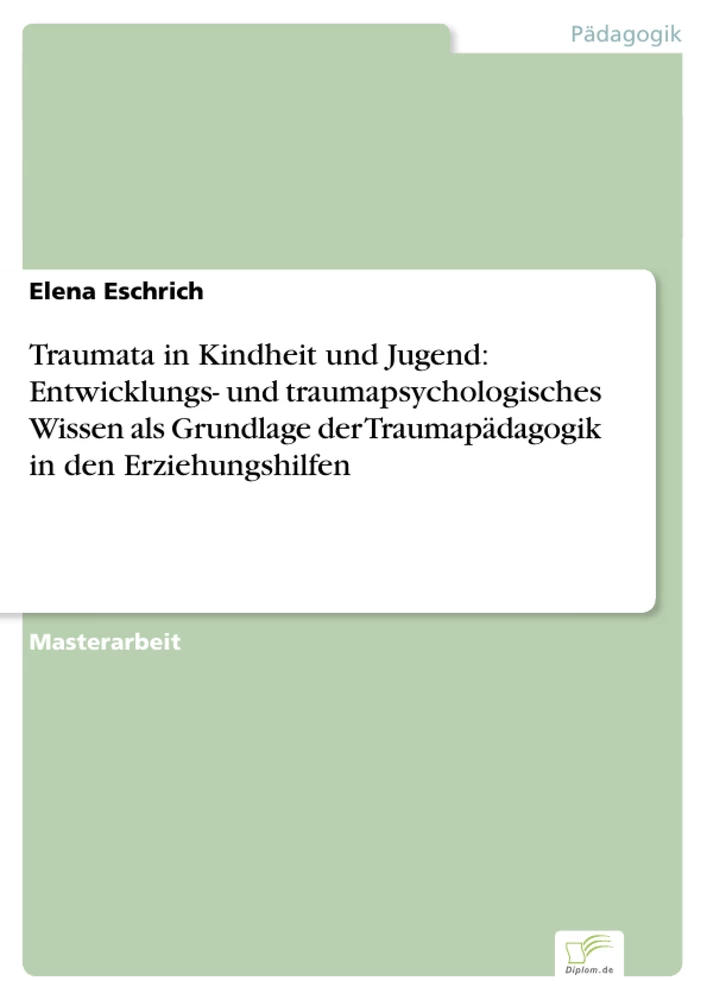
Traumata in Kindheit und Jugend: Entwicklungs- und traumapsychologisches Wissen als Grundlage der Traumapädagogik in den Erziehungshilfen
Masterarbeit, 2013, 272 Seiten
Autor

Kategorie
Masterarbeit
Institution / Hochschule
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Erziehungswissenschaften)
Note
1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1) Einleitung
1.1) Eigene Praxiserfahrungen
1.2) Ziel und Aufbau der Arbeit
Teil A
2) Kindheit und Jugend
2.1) Kindheit und Jugend heute
2.1.1) Kindheit und Jugend aus unterschiedlicher Perspektive
2.2) Entwicklungspsychologische Überlegungen zu Entwicklungsschritten in Kindheit und Jugend
2.3) Entwicklung in Kindheit und Jugend
2.3.1) Pränatale Entwicklung
2.3.2) Das Neugeborene
2.3.3) Erstes und zweites Lebensjahr
2.3.4) Frühe Kindheit (3-6 Jahre)
2.3.5) Mittlere und späte Kindheit (6-11 Jahre)
2.3.6) Jugend (11-20 Jahren)
Teil B
3) Traumata bei Kindern und Jugendlichen
3.1) Der Begriff „Trauma“
3.2) Ein historischer Exkurs: Die Geschichte der Wahrnehmung von Traumata
3.2.1) Traumatische Erfahrungen von Mädchen und Jungen in der Geschichte
3.3) Typologie von Traumatisierungen
3.4) Situationsfaktoren und Risikofaktoren
3.4.1) Potentielle Traumata
3.5) Schutzfaktoren & Mittlerfaktoren
3.6) Die Bedeutung des Entwicklungsstandes: Trauma-Vulnerabilität vor dem Hintergrund von Entwicklungsstufe und Entwicklungsaufgaben
3.7) Trauma in Kindheit und Jugend und die Folgen
3.7.1) Entwicklungspsychologische Aspekte von Traumaerleben und Traumaverarbeitung
3.7.1.1) Entwicklungspsychologische Reaktionen der Traumaverarbeitung
3.7.2) Symptome und Auswirkungen von Traumata in Kindheit und Jugend
3.7.3) Auswirkungen von Traumata aus neuro- und psychobiologischer Sicht im Kontext Entwicklung
Teil C
4) Der pädagogische Umgang mit Traumata bei Kindern und Jugendlichen
4.1) Psychisch belastete und traumatisierte Kinder und Jugendliche in der stationären Jugendhilfebetreuung
4.2) Die Wurzeln der Traumapädagogik
4.3) Aufgabe und Notwendigkeit der traumabezogenen Pädagogik
4.3.1) Gründe für einen pädagogischen Zugang
4.3.2) Die Traumapädagogische Perspektive: Pädagogik als Hilfe zur Traumabewältigung
4.4) Elemente und Aufgaben der Traumapädagogik
4.4.1) Der äußere (Schutz-)Ort
4.4.2) Kontinuierliche Bezüge sichern
4.4.2.1) Beziehungsarbeit in der Praxis
4.4.3) Biografiearbeit
4.4.3.1) Biografiearbeit in der Praxis
4.4.4) Unterstützung zur Selbstbemächtigung
4.4.4.1) Unterstützung zur Selbstbemächtigung in der Praxis
4.4.5) Sexualpädagogik und geschlechtsbezogene pädagogische Arbeit
4.4.6) Elternarbeit
4.5) Professioneller Umgang mit Traumata
4.5.1) Definition von Professionalität
4.5.2) Potentielle Belastungsfaktoren
4.5.3) Grundkompetenzen der PädagogInnen
4.5.4) Strukturelle kompensatorische Schutzfaktoren
4.5.4.1) Das Team als Kraftquelle
4.5.5) Leitungsebene
4.6) Strukturelle Anforderungen
4.6.1) Ausbildungsprofil
4.6.2) Weiterbildung und Supervision
4.6.3) Gesellschaft
5) Schluss
6) Literaturverzeichnis
7) Anhang
8) Eidesstattliche Erklärung
1) Einleitung
„Aufhebung [1]
Sein Unglück
ausatmen können
tief ausatmen
so daß man wieder
einatmen kann
Und vielleicht auch sein Unglück
sagen können
in Worten
in wirklichen Worten
die zusammenhängen
und Sinn haben
und die man selbst noch
verstehen kann
und die vielleicht sogar
irgendwer sonst versteht
oder verstehen könnte
Und weinen können
Das wäre schon
fast wieder
Glück“
(Erich Fried )
Erich Fried konnte mit seinem Gedicht „Aufhebung“ verdichtet eine Aufarbeitung von traumatischen Erlebnissen darstellen.[2] Seine Worte machen deutlich, wie schwer es Menschen, zunächst ganz allgemein gesprochen, in unserer heutigen Gesellschaft fällt, über die eigenen Gefühle und Probleme zu sprechen; weinen oder Leid auszudrücken wird allzu oft als das Zeigen von Schwäche missgedeutet und lässt die Person in einer Gestalt erscheinen, die nicht in das Bild einer vermeintlichen perfekten Welt passt. Zu herrschen scheint das Ideal eines Menschen mit einem starken Charakter, der Probleme und Hürden des Lebens alleine bewältigen kann, ohne auf Hilfe von anderen angewiesen und abhängig zu sein. Die Menschen sollen im Sinne der Erwartungen und Anforderungen der heutigen Leistungs- und Disziplinargesellschaft wie Roboter funktionieren - unabhängig davon, welches Schicksal ihnen widerfahren ist.[3]
TraumapatientInnen müssen erst lernen, ihr Unglück auszusprechen und über das Erlebte zu berichten und es ist erlaubt und sogar erwünscht, dass sie Schwäche zeigen und die Gefühle offenlegen.[4] Auch bei jüngeren Traumaopfern ist es weit verbreitet, dass diese selten von selbst über das traumatische Erlebnis sprechen,[5] oft, weil sie den Menschen in ihrer Umgebung – v. a. D. den Eltern, Geschwistern und FreundInnen – nicht schaden und sie nicht belasten möchten[6] und Einschüchterung und Scham zu groß sind.[7] Doch oft, gerade wenn Kinder Zeuge von Traumatisierungen sind und z. B. Gewalt miterleben, wird von Außenstehenden nicht erkannt, wie beteiligt die Kinder hierbei sind, zugleich bekommen sie es verboten, über das Vorgefallene zu sprechen. Hierdurch entsteht dann oft die von Dan Bar-On[8] so genannte „doppelte Mauer“ – Die Kinder können oder dürfen darüber nicht sprechen, zugleich will die Umwelt dies aber auch nicht hören.[9] Dieses bekannte Phänomen, also dass diejenigen, die Erinnerungen mit sich herumschleppen, eine Mauer um sich herumbauen (müssen) und in diese irgendwann ein Loch gebrochen wird und in dem Moment, wo sie etwas sagen wollen, sie auf die nächste Mauer – die Mauer derer, die nichts hören wollen – treffen,[10] ist eine Problematik, die sich in der Geschichte des Umgangs mit bzw. der Reaktion auf Traumata von Menschen, lange Zeit aufrecht erhielt.[11] In den letzten 20 Jahren konnte jedoch durch zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse und klinisches Wissen zu diversen Aspekten von Traumata die Entwicklung eines integrierten Verständnisses der Traumaeffekte auf das soziale, psychologische und physiologische Erleben von Einzelpersonen voranschreiten.[12]
Die Geschichte der Erforschung von psychischen Traumatisierungen bei Kindern und Jugendlichen ist jedoch insgesamt als „ein wenig rühmliches Kapitel der dafür zuständigen Fachdisziplinen“[13] zu betrachten. Rückblickend ist es eher schwer nachvollziehbar, dass katastrophale Resultate von Trennungen im Säuglings- und Kleinkindalter, v. a D. in Krippen und Kinderkliniken, sowie das Massenphänomen der Kindesmisshandlung oder sexuellen Kindesmissbrauchs so lange „übersehen“ werden konnten.[14] Zwar ist auch hier die Forschung erfreulicherweise fortgeschritten,[15] da z. B. neuere Untersuchungen auch hier eindeutig zeigen, dass psychische Traumatisierungen besonders häufig Kinder und Jugendliche betreffen und zudem einen sehr starken Einfluss auf die Entwicklung und die Lebensqualität haben,[16] doch den Umgang hiermit als einen Teil des pädagogischen Handelns[17] anzusehen, ist eine noch sehr junge Entwicklung.[18] Die Notwendigkeit, das Wissen um den Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in den pädagogischen Alltag zu integrieren, wird umso deutlicher, wenn man sich vor Augen hält, dass traumatisierte Kinder die Folgen ihrer Traumatisierung natürlich nicht nur in den Therapiestunden zeigen, sondern überall da, wo sie leben: In der Familie, in der Schule, im Freundeskreis, in der Freizeit. Nicht nur PsychotherapeutInnen, gerade auch (Sozial-)PädagogInnen sind in den unterschiedlichsten Handlungsfeldern nahezu ständig mit traumatisierten Menschen konfrontiert, die sie betreuen und denen sie begegnen. Dennoch fehlten und fehlen oftmals Kenntnisse, Handwerkszeug und Ressourcen, um damit angemessen und hilfreich umzugehen.[19] Um traumatisierte Kinder und Jugendliche somit in ihrer Entwicklung adäquat begleiten zu können, ist eine pädagogische Haltung vonnöten, die die aktuellen Forschungserkenntnisse berücksichtigt; auch ist eine Disziplin unabdingbar, die die Fachkräfte anleitet, die betroffenen Kindern und Jugendlichen zu unterstützen und Hilfe zu leisten, in der Hoffnung und mit dem Ziel, dass sie – mit Erich Frieds Worten – ihr „Unglück ausatmen“ können.[20] Nur logisch und konsequent entstand hieraus die Notwendigkeit, die aktuellen Erkenntnisse der Traumaforschung auch in pädagogischen Ansätzen zu berücksichtigen, um die betroffenen Mädchen und Jungen ihrem Bedarf entsprechend gerecht unterstützen zu können. Hieraus entwickelte sich in den letzten Jahren die mittlerweile zum Fachbegriff gewordene „Traumapädagogik“, die sich als neue, eigenständige Fachdisziplin etabliert hat.[21] Im Zentrum dieser steht die Frage, was die Pädagogik bieten und leisten kann, um diesen Kindern im Alltag zu helfen und eine Bearbeitung traumatischer Erfahrungen über eine parallel stattfindende Traumatherapie hinaus sinnvoll zu unterstützen.[22]
Diese dringende Notwendigkeit, das Wissen hierüber innerhalb der pädagogischen Disziplin zu steigern, wird umso gravierender, wenn man aktuelle Zahlen bzgl. Fremdplatzierungen betrachtet: In Deutschland werden fast 100 Kinder jeden Tag in Einrichtungen der stationären Hilfen aufgenommen. Diese Kinder und Jugendlichen waren in ihrer Biografie überdurchschnittlich häufig komplexen Problemlagen ausgesetzt und haben einen intensiven pädagogischen Betreuungsbedarf. Traumata, in welcher Form auch immer, stehen hier an der Spitze ihrer Belastungen, meist sind es sogar komplexe Traumatisierungen durch Misshandlung, Vernachlässigung oder Missbrauch im unmittelbaren häuslichen Umfeld.[23] Zahlreiche Untersuchungen an Fremdplatzierten zeigen, dass über 70% der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mindestens ein traumatisches Ereignis erlebt haben. Somit gibt es kaum eine andere psychosoziale Gruppierung, wo traumatische Erfahrungen aufgetreten sind, wie Heranwachsende der stationären Jugendhilfe. Somit wird ersichtlich, wenn man das Gesamtvolumen der eingesetzten Hilfen in diesem Arbeitsbereich betrachtet, dass die psychosozialen Fachkräfte aus dem Bereich der Sozialen Arbeit und (Heil-)Pädagogik den weitaus größten Teil der Traumaversorgung leisten.[24]
1.1) Eigene Praxiserfahrungen
Auch ich selbst konnte im Umgang mit traumatisch belasteten Kindern und Jugendlichen schon zahlreiche Erfahrungen sammeln, die mich umso mehr motivieren, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Meine persönlichen Eindrücke sollen an dieser Stelle kurz vorgestellt werden, um der Arbeit eine persönlichere Note zu verleihen und womöglich auch beispielhafter eine Vorstellung von der Art der Arbeit und den Problematiken hiermit als Pädagogin/ Pädagoge zu erhalten.
Meine diversen Praktika in stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen und meine derzeitigen Tätigkeit als pädagogische Fachkraft in einer Heimeinrichtung ließen mich ähnliche Erfahrungen machen, wie die bereits einleitend angedeuteten – zum einen die Tatsache, dass viele der Kinder und Jugendliche belastete und zum Teil traumatische Biografien haben, aber eben auch, wie schwierig und herausfordernd es als Pädagogin/ Pädagoge ist und wie ohnmächtig und unwissend man teilweise im Umgang hiermit ist.
Meine eigenen Erfahrungen bzgl. des Schichtdienstes und der oft erlebte Personalmangel, der dazu führte, dass ich keine umfangreiche Einarbeitung in das Arbeitsfeld erhielt, stellten bereits Hürden dar. Doch immer öfter gab es auch zwischenmenschliche Situationen im Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen (im Alter von vier bis 14 Jahren, gemischtgeschlechtlich), die ich oftmals zunächst nicht konkret einordnen konnte und (dementsprechend) auch nicht wusste, wie ich hiermit umgehen sollte. Mit der Zeit und je nach Zusammensetzung der Gruppe[25] merkte ich schnell, dass eine solche Arbeit mehr Herausforderung mit sich bringt, als ich anfangs dachte. Im Laufe der Zeit stellten sich bei mir zwar eine gewisse Erfahrung und Gewohnheit ein, was den Tagesablauf und gewisse Routinearbeiten betraf, weniger jedoch, was die Arbeit und den Umgang mit einigen „Problemfällen“ anging. Manche Kinder und Jugendliche hatten so schwere Verhaltensauffälligkeiten, dass man sich hier der Situation nicht gewachsen fühlte. Ein Kind war hoch aggressiv und hatte ADHS, ein anderes war sexuell übergriffig und gewalttätig, wieder andere hatten Bindungsprobleme – so kam es oft zu Situationen, wo vieles eskalierte und man zum Teil wirklich hilflos war und sich in seiner Professionalität ohnmächtig fühlte. Das folgende Fallbeispiel soll einen derartigen Fall und meine Gefühle und Unsicherheiten bzgl. der Reaktion hierauf etwas besser darstellen:
Marius (4 Jahre) ist nun schon beinahe ein Jahr in unserer Einrichtung untergebracht. Seine Vergangenheit bestand darin, dass er die Hälfte seiner erst kurzen Lebenszeit zum Teil bei seiner Mutter, zum Teil bei den Großeltern aufgewachsen ist. Seine Mutter dürfte er jedes Besuchswochenende treffen, doch sie, die selbst an einer Borderlinestörung leidet, ist sehr unzuverlässig und psychisch sehr belastet, weswegen es oft vorkommt, dass sie Termine nicht wahrnimmt, den Jungen nicht besucht oder abholt und auch sonst nicht mit ihm Kontakt aufzunehmen versucht. Oft kam es vor, dass bereits fest ausgemachte Termine ihrerseits kurzfristig abgesagt wurden – der Junge, der sich bereits freute und fest mit dem Kommen der Mutter gerechnet hat, ist daraufhin regelmäßig in Tränen ausgebrochen. Mit der Zeit stellte sich Marius immer öfter vor den Spiegel und sagte „ich will so nicht aussehen, ich bin hässlich“. Auch zweifelte er immer mehr an seinen eigenen Fähigkeiten und reagierte oft auf Ermunterungen mit „das kann ich nicht“. Auch fiel vermehrt auf, dass er auf seinen Fingerkuppen kaute, bis diese bereits blutig waren.
Mit der Zeit, durch Therapiestunden und Gespräche von KollegInnen mit dem Jungen, konnte sich herausstellen, dass Marius sich selbst die Schuld dafür gibt, dass seine Mutter ihn nicht besucht; er hat es also auf sich übertragen, dass „Mami ihn nicht so lieb hat“. Im ersten Moment dieses auftretenden Verhaltens fühlte ich mich hilflos, da ich die Situation nicht einordnen konnte und zudem fehlten mir angemessene Worte. Womit tröstet man so ein Kind? Ihm sagen, dass es nicht hässlich ist, ändert für ihn nichts an der permanenten Abwesenheit der Mutter. Da ich also weder von außen, noch selbst einen „Leitfaden“ hatte, wie ich mit ihm oder generell Kindern, die ein auffälliges Verhalten zeigen (hier war oftmals für mich zunächst ja auch nicht ersichtlich, womit dieses auffällige Verhalten zu tun hat)[26] und traumatische Erlebnisse in ihrer Biografie aufweisen, umgehen soll, fühlte ich mich manchmal nahezu machtlos und dahingehend hilflos, da man einerseits unterstützen und entlasten will, andererseits behutsam vorgehen muss und nicht noch mehr verletzen darf – anknüpfend an das eingehende Zitat von Janusz Korczak.[27] Marius erhielt zwar wöchentlich stattfindende Therapiestunden und auch die Mutter erhielt Unterstützung. Doch auch hier wird das eingangs angedeutete Problem wieder deutlich: In der Psychologie scheint der Umgang hiermit klar zu sein, doch wie sieht es in der Pädagogik aus?
Obwohl ich mich oft durch Literatur weiterbildete und somit ein gewisses theoretisches Hintergrundwissen und auch schon zahlreiche Erfahrungen im pädagogisch-praktischen Bereich sammeln konnte, hatte ich das Gefühl, kaum Ressourcen mehr zu haben, auf die ich in solchen „Extremsituationen“ zurückgreifen konnte. Solche Situationen und persönlichen Gefühle können innerhalb des Teams zwar besprochen werden und werden auch in einem täglichen „Tagebuch“, wo die Mitarbeiter zum gesamten Tagesablauf und zu jedem Kind speziell Einträge verfassen, dokumentiert, dennoch blieb meinerseits oft der Zweifel, ob ich mich richtig verhalten habe. In einigen Ausnahmesituationen herrschen durchaus Zweifel, ob man so einem Extremjob auf Dauer gewachsen wäre. Aus diesem Grund, weil ich auch gewillt bin, an dieser Herausforderung zu wachsen, bin ich trotz kurzzeitiger Zweifel überzeugt, dass dieses Arbeitsfeld das richtige ist, erkenne aber den großen Bedarf und die Notwendigkeit für eine pädagogische Fachkraft, die in solch einem Bereich und mit solchen Schicksalen arbeitet, sich in diesem Bereich kompetent und professionell weiterzubilden. Ich bin überzeugt, dass dies sowohl zur eigenen Professionalität beiträgt, als auch den Umgang mit den Kindern und Jugendlichen fördert und zum Teil sogar erleichtert.
1.2) Ziel und Aufbau der Arbeit
Sowohl aus den theoretischen Überlegungen und der objektiven Tatsache, dass bzgl. des pädagogischen Umgangs mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen noch einiges an Forschung und theoretischem Wissen hierüber benötigt wird (eine Konsequenz daraus, dass es sich um eine noch so junge Disziplin handelt), aber eben auch aufgrund der Bestätigung dessen durch meine eigenen praktischen Erfahrungen, ist es mir ein großes Anliegen, mich in meiner Masterarbeit mit dem Thema Traumata in Kindheit und Jugend und dem pädagogischen Umgang hiermit zu beschäftigen. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Frage, vor welche Herausforderungen die Symptome von schwer traumatisierten Kindern und Jugendlichen die pädagogischen Fachkräfte in den stationären Wohngruppen stellen - und wie diesen pädagogisch begegnet werden kann. Hierzu möchte ich die Erkenntnisse und wissenschaftlichen Erfahrungen aus den Teilbereichen der Psychologie, Psychiatrie und auch Pädagogik, v. a. D. der jungen Disziplin der Traumapädagogik, mit einfließen lassen. Insbesondere sollen Grundlagen aus der Entwicklungs- sowie Traumapsychologie dazu führen, eine professionelle bzw. effiziente traumapädagogische Unterstützung in der Praxis begründen und leisten zu können. Diese Arbeit versucht hier einen „Brückenschlag“ vorzunehmen und PädagogInnen alltagspraktische Möglichkeiten zum Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen.
In der nachfolgenden Ausarbeitung geht es vor allem um die Unterstützung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, welche durch eine frühe Traumatisierung Hilfe bei der Bewältigung des Traumas in ihrem alltäglichen Leben unter Einbezug der entwicklungsspezifischen Phasen benötigen. Damit dieser Klientel eine angemessene professionelle Hilfe, Begleitung und Unterstützung zukommt, ist die qualifizierte fachspezifische Auseinandersetzung mit diversen Themen unabdingbar.[28]
Da im Laufe der Arbeit ersichtlich wird, dass zahlreiche Faktoren, sei es die Beschäftigung mit Traumata in der Geschichte, die Entwicklung der Traumapädagogik, die Organisation der Erziehungshilfen etc. entscheidend von der Gesellschaft und deren Offenheit abhängt, möchte ich eingangs zunächst einen Blick auf Kindheit und Jugend und deren veränderte Lebenssituation werfen.[29] Anschließend sollen Einblicke in die Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters vorgenommen werden. Zum einen erschien es für mich unumgänglich, eine gewisse Vorstellung von gewissen Entwicklungsschritten zu haben um einerseits zu wissen, vor welchen Entwicklungsaufgaben die Kinder und Jugendlichen stehen und andererseits, um ein pathologisches Verhalten überhaupt erkennen und ggf. Auswirkungen von Traumata auf die einzelnen Entwicklungsschritte verstehen zu können. Auch sehe ich es als eine notwendige Bedingung für einen adäquaten Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen und den Traumata selbst an, ein Verständnis der kindlichen und adoleszenten Entwicklung zu haben. Es ist es notwendig, zunächst einen Blick auf die „normale“ Entwicklung eines Kindes und Jugendlichen zu legen, damit verstanden werden kann, welche Bedeutung und auch Auswirkungen sowohl die Lebensspannen an sich, aber auch Traumata zu Zeiten eben dieser Lebensspannen haben können.[30] Angelehnt werden soll sich hierzu an das Konzept der Entwicklungspsychologie, deren Ziel es ist, zunächst gewisse Entwicklungsnormen zu erstellen um Auskunft über den normalen Entwicklungsverlauf zu erhalten, sodass dann mithilfe von detaillierten Beobachtungen die Auswirkungen von verschiedenen Entwicklungsbedingungen, hier traumatischen Erfahrungen, studiert werden können.[31] Denn nur durch den Vergleich mit einer typischen Entwicklung kann wiederum eine atypische Entwicklung erkannt und diagnostiziert und hierdurch letztendlich Interventionen entwickelt werden.[32] Auch gibt z. B. Peter Riedesser zu bedenken, dass das Trauma selbst, dessen Wahrnehmung und letztendlich die Symptome hieraus, von dem Alter des Kindes abhängen und somit entscheidend ist, in welcher Entwicklungsphase es sich befindet.[33] Nach den verschiedenen Altersspannen untereilt, sollen in diesem Kapitel somit übersichtlich[34] körperlich-motorische, kognitive, emotionale und soziale Meilensteine der Entwicklung im Kindes- und Jugendalter aufgezeigt werden.
In einem zweiten großen Kapitel soll es dann um Traumata gehen. Es wird aufgezeigt, welche traumatischen Erlebnisse Kindern und Jugendlichen widerfahren können, welche Folgen hieraus resultieren und hier auch der Bogen zum ersten Kapitel gespannt, indem alters- und entwicklungsrelevante Auswirkung auf bestimmte Entwicklungsbereiche aufgezeigt werden. Auch an dieser Stelle scheint es relevant, den Fokus auf Alter und Entwicklung zu legen, da gerade in den Erziehungshilfen potentiell mit jeder Altersklasse gearbeitet wird und jedes Kind/ jeder Jugendliche in seiner Entwicklung begleitet werden soll. Wenn auch bspw. das Kapitel Auswirkungen von Traumata auf unterschiedliche Entwicklungsphasen nur eine Orientierung liefern kann, erscheint es dennoch sinnvoll, eine Vorstellung und Einschätzung darüber zu besitzen, wann sich welches Trauma wie auf den Heranwachsenden auswirken und welche Symptome er warum im pädagogischen Alltag zeigen könnte.[35] Hierdurch erhoffe ich mir, dass die Empathiefähigkeit und Sensibilisierung der pädagogischen Fachkräfte wachsen kann. Doch hierzu ist eben der Überblick über theoretische Hintergründe unabdingbar, da man nur verstehen und verändern kann, worüber man etwas weiß, getreu dem Motto: „Die Brille bestimmt, was wir sehen können“.[36]
In einem dritten großen Kapitel soll dann die Arbeit schließlich darin münden, aufgrund der vorhergehenden Kenntnisse, einen Einblick und zugleich eine Anleitung für den pädagogisch-professionellen Umgang mit diesen Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Mir geht es hierbei jedoch nicht etwa darum, ein „Patentrezept“ für jegliche Situation und für jedes Arbeitsfeld zu erhalten, was sicherlich ohnehin nicht realisierbar wäre. Ich bin mir bewusst, dass es nicht möglich ist, eine Handlungssicherheit für sämtliche Situationen zu bekommen, da es sich schließlich um Handlungsfelder handelt, die i. d. R. von Ungewissheiten und Unvorhergesehenem geprägt sind.[37] Vielmehr ist es mir ein Anliegen, die pädagogischen Interaktionen beobachten und reflektieren zu können und mich, zunächst theoretisch und dann praktisch, sowohl mit meinen, als auch mit den dieser Thematik zugrundeliegenden Vorstellungen und Überzeugungen zu beschäftigen. Praxisreflexion erkenne ich somit als ein absolutes „Qualitätsmerkmal pädagogischer Praxis“ an und bin mir im Klaren darüber, dass „ohne Reflexion nur die Hinnahme des Stattfindenden zur pädagogischen Praxis stilisiert würde“.[38] In diesem dritten Kapitel geht es mir, anknüpfend an die vorherigen Überlegungen, darum, auch das Augenmerk auf die unterschiedlichen Altersgruppen zu legen, auch wenn sich dies, aufgrund kaum vorliegender Quellenarbeit hierzu, sich recht schwierig gestaltet. Zudem möchte ich bei dieser Bearbeitung auch durch praktische Beispiele und Ideen erläutern, wie gewisse Empfehlungen umzusetzen sind, da – auch dies fällt negativ bei Literatur zu dieser Thematik auf – oftmals lediglich Fakten zur Verbesserung genannt werden, wie und wodurch dies erreicht werden könnte, kommt jedoch leider oft zu kurz.
Ein abschließender Blick auf die aktuelle Forschung und die Schlussworte sollen ein Resümee des Genannten ziehen und einen Ausblick und Hinweise auf zukünftige, theoretische, empirische sowie praktische Arbeiten und Forschungslücken geben.
Zum Stil und zur Sprache der Arbeit möchte ich sagen, dass, der Einfachheit halber, um jedoch dem geschlechtergerechten Sprachgebrauch zu entsprechen, z. B. immer, wenn es syntaktisch möglich ist, von PädagogInnen gesprochen wird. Bei den Kindern und Jugendlichen soll immer die gesamte Altersgruppe und Geschlechter ausgedrückt werden – an Stellen wo dies differenziert zu betrachten ist, soll explizit darauf hingewiesen werden. Auch möchte ich hinzufügen, dass sporadisch in dieser Arbeit, bei Kapiteln bzw. Stellen, an denen es geeignet erschien, Zitate von bekannten Persönlichkeiten einleiten sollen, da diese den Inhalt oft kurz und prägnant wiedergeben und sie das Gesamtbild der insgesamt doch sehr wissenschaftlichen Arbeit auflockern sollen.
Zur Literaturarbeit ist zu sagen, dass sich hauptsächlich auf Literatur aus dem 21. Jahrhundert bzw. speziell auf höchstens einige Jahre alte Quellen bezogen wurde – zum einen, da das Thema, also die Entwicklung des Kindes und Jugendlichen (die Entwicklungspsychologie eingeschlossen), aber auch das Thema Trauma und v. a. D. der pädagogische Umgang hiermit, zu ständig neuen Forschungserkenntnissen kommt und, wie eindrucksvoll deutlich wurde, das Thema pädagogischer Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen zur Zeit eine sehr hohe Aktualität besitzt und diese Fachdisziplin noch „in den Kinderschuhen“ steckt; zum anderen wandelt sich die Kindheit und Jugend natürlich auch mit der Gesellschaft und den „Umständen“, was es unumgänglich macht, aktuelle Erkenntnisse mit heranzuziehen.
Während für das Kapitel 2, also die Einblicke in die Entwicklungspsychologie, hier noch eine große Bandbreite an entsprechenden Veröffentlichungen zu finden und somit ein umfassender und umfangreicher Einblick in die Thematik möglich ist,[39] und auch Grundlagenwissen zum Thema Traumata (Kapitel 3) allgemein aufzufinden ist, so zeigte sich bereits, dass Quellen über Traumata speziell bei Kindern und Jugendlichen schon weitaus übersichtlicher sind.[40] Bereits bei diesem Kapitel, aber vor allen Dingen auch bei dem anschließenden Kapitel 4 (Traumapädagogik bzw. der pädagogische Umgang mit Traumata bei Kindern und Jugendlichen) konnte sich deutlich erkennen lassen, dass man es hier mit einer sehr jungen Disziplin von wenigen Jahren zu tun hat, womit unweigerlich einhergeht, dass das Fachliteraturspektrum zwar über ein breitgefächertes Angebot bzgl. therapeutischer Ansätze zur Förderung psychisch kranker und traumatisierter Kinder und Jugendlicher verfügt, die zur pädagogischen Arbeit jedoch sehr überschaubar sind.[41] Bzgl. dieses Kapitels sei jedoch dennoch das Werk „Philipp sucht sein Ich“ von Wilma Weiß[42] hervorzuheben, an dem sich primär orientiert wurde und das einen wichtigen Grundstein der Traumapädagogik[43] geliefert hat.[44]
Teil A
2) Kindheit und Jugend
2.1) Kindheit und Jugend heute
„Das Konstrukt Kind steuert die Wahrnehmung und Deutung der Phänomene des Kinderlebens; es stellt dar, wie das Kind lebt und bewertet implizit oder explizit, wie es leben soll. Die Bilder und Begriffe vom Kind stehen in einer je eigentümlichen Beziehung zum tatsächlichen Leben der Kinder, zur Kindheit als Element gesellschaftlicher Ordnung.“[45]
Das Thema „Kindheit“ ist mittlerweile zu einem interdisziplinären Forschungsgebiet geworden. Die moderne Kindheitsforschung betrachtet den historischen, sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Kontext dieses Lebensabschnitts und die Frage interessiert, welche Wechselwirkung es zwischen dem sich entwickelnden Menschen und der sich wandelnden Umwelt gibt.[46] Historisch gesehen ist das Konzept der „Kindheit“ jedoch ein relativ junges Phänomen, da diese erst im Zuge der Aufklärung als eigenständige Phase begriffen wurde; vorher wurden Kinder als „kleine Erwachsene“ angesehen.[47] Nach Rathmayr (2007) lassen sich vier Unterscheidungen im Hinblick auf die historische Entwicklung des „Konstrukts Kindheit“ vornehmen:
1) Kindheit als Unterwerfung und Gehorsamspflicht. Von der Antike mit dem patriarchalischen Weltbild, über das Mittelalter bis hin in die Frühe Neuzeit galten Gehorsam und Unterordnung „mit unendlich viel Leid im totalen Widerspruch zur Verhätschelung für Kinder“ als normales Verständnis von Kindheit.
2) Erziehungskindheit: Seit der Aufklärung im 17. Jahrhundert wird das Kind neu gesehen, nämlich als mit besonderen Maßnahmen in seiner Eigenart zu erziehendes Wesen.[48]
3) Kinder als sozial kompetente Akteure: Seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit seinen Neuansätzen der Kindheitsforschung in den USA, den skandinavischen Ländern usw. gelten Kinder als eigenberechtigte Personen, die an Erziehung und Sozialisation einen aktiven und konstruktiven Anteil haben.
4) Als eine Art Ergänzung (um nicht zu sagen Gegenbewegung) gilt das vierte Konstrukt: Kinder brauchen ein eigenes Kind-Erwachsenen-Verhältnis. Das heißt: Kinder sind angewiesen auf Erwachsene, die ihnen Bindung bieten (v. a. D. die Mutter in der frühen Kindheit), sie brauchen Schutz, weil sie verletzlich sind, emotionale und physische Fürsorge, weil sie sonst verkümmern.[49]
Aus dem vierten Konstrukt wir deutlich, dass Kindheit heute als biographischer Erfahrungszeitraum verstanden wird, in welchem relevante Entwicklungsimpulse an die Kinder herangetragen, aber in dem auch vielfältige Unterstützungen und Hilfen gegeben werden müssen.[50]
Auch die Vorstellung von einer Jugend als eigenständige, von der Kindheit unterschiedene Lebensphase aller Heranwachsenden setzte sich erst im 19. und 20. Jahrhundert durch.[51] Die Bestimmung einer eigenständigen Lebensphase Jugend geschah durch verschiedene gesellschaftlichen Entwicklungen wie z. B. lebenslanges Lernen, die Selbstgestaltung des Lebens, verlängerte Ausbildungszeit und allgemeine veränderte Lebensstrukturen.[52]
Insgesamt hat sich das Entwicklungsverständnis weg von der Zielorientierung menschlicher Entwicklung (das Erwachsenenalter als Ziel der menschlichen Entwicklung, wobei Kindheit und Jugend automatisch eine defizitäre Rolle zugewiesen wird) hin zur Wertschätzung jeder einzelnen Lebensphase von der Antike bis heute radikal verändert.[53] Somit erscheint es relevant, die Kindheit sowie die Jugend als eigenständige Lebensabschnitte anzusehen, mit ihren jeweiligen spezifischen Anforderungen, Aufgaben und Bewältigungskapazitäten.[54]
Wie Kindheit und Jugend im Einzelnen definiert wird, welche Rolle ihnen zugeschrieben und von welchen Disziplinen der Begriff der „Kindheit“ und „Jugend“ untersucht wird, aber auch, wann Kindheit und Jugend zeitlich anzusetzen sind, hängt somit von historischen und gesellschaftlichen Umständen ab und davon, unter welcher Fragestellung man sie betrachtet.[55] I. d. R. werden diesen Lebensphasen im Alltagsgebrauch sowie in wissenschaftlichen Untersuchungen gewisse Alterskategorien zugeordnet. Doch weder altersgemäß noch symbolisch sind die Übergänge vom Kind zum Jugendlichen klar definiert, sondern eben auch nur gesellschaftlich konstruiert.[56] Gab es also zu Beginn des 20. Jahrhunderts lediglich zwei Lebensphasen – die Kindheit (bis ca. 14 Jahren) und das Erwachsenenalter – so haben sich in den jeweils vierzig folgenden Jahren zwei Kategorien hinzufügen lassen – zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts die Jugend und der Ruhestand, Ende des zwanzigsten Jahrhunderts eine Unterteilung in Jugend und Nachjugendalter sowie spätes Erwachsenenalter; zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist nach Klaus Hurrelmann eine noch feingliedrige Aufteilung der Lebensabschnitte sinnvoll.[57] Den Ausblick auf künftige Unterteilungen gibt er aufgrund möglicher zukünftiger Gesellschaftszusammensetzungen, sowie Verschiebungen in Form von zeitlichen Ausdehnungen. Lebensphasen können in ihrer Dauer gestaucht werden, indem neue Unterteilungen vorgenommen werden oder im Zuge einer genaueren Einteilung sogar neue Lebensphasen hinzukommen.[58]
2.1.1) Kindheit und Jugend aus unterschiedlicher Perspektive
Wie deutlich werden konnte, hat die Lebensphase der Kindheit (aber auch der Jugend) durch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen starke Veränderungen erfahren, die man unter dem Begriff der „Veränderten Kindheit“[59] subsumieren kann. Getreu der Aussage, dass Kindheit eine Lebensform und als solche unhintergehbar ist, wird sie zum Gegenstand wissenschaftlichen Interesses.[60] Deutlich werden konnte zudem, dass es sich um ein interdisziplinäres Interesse handelt und je nach wissenschaftlicher Disziplin zeigen sich unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in der Klärung des Begriffes „Kindheit“. So lassen sich z. B. drei Perspektiven unterschiedlicher, aber miteinander korrelierender und sich ergänzender wissenschaftlicher Disziplinen[61] unterscheiden, die im Rahmen dieser Masterarbeit Anwendung finden: Kindheit aus soziologischer Perspektive, wo Kindheit als Lebensphase mit individuellen Sozialisationsprozessen und als sozio-kulturelles Muster gedeutet wird,[62] das diesen Prozessen vorausgeht und damit die Bedeutung von gesellschaftlichen Veränderungen und Prozessen ins Spiel kommt. Hierdurch wird eine Annäherung an den Begriff der „Veränderten Kindheit“ überhaupt erst möglich.[63] Diese Perspektive soll dahingehend Anwendung in der Arbeit finden, indem immer wieder auf gesellschaftliche Verhältnisse und Hürden, aber auch Zuschreibungen hingewiesen wird, so z. B. die vorgestellte soziologische Betrachtung der Lebensphasen Kindheit und Jugend.[64] Die zweite Perspektive, die im beruflichen Alltag relevant ist und die im letzten Drittel der Arbeit eine bedeutende Rolle spielt, ist die Kindheit aus pädagogischer Perspektive; hier werden Fragen nach Erziehung und Bildung in der dieser Lebensphase in den Blick genommen und diskutiert. Die dritte Perspektive ist die Kindheit aus entwicklungspsychologischer Perspektive, bei der es darum geht, Kindheit und Jugend als eine Abfolge von Entwicklungsphasen zu konzipieren und illustrieren, bei denen mit stetig wachsenden motorischen, kognitiven, affektiven und psychosozialen Fähigkeiten des Kindes und Jugendlichen deren „Welt“ ständig wächst und komplexer wird[65] und es, in der Auffassung von Robert J. Havighurst, bestimmte Entwicklungsaufgaben zu bewältigen hat.[66]
Dieser Punkt soll in den nun folgenden Abschnitten ausführlicher behandelt werden.
2.2) Entwicklungspsychologische Überlegungen zu Entwicklungsschritten in Kindheit und Jugend
Die Entwicklungspsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie[67], die sich vor rund 100 Jahren als eigenes Wissenschaftsgebiet etabliert hat. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie und wann psychische Funktionen und Strukturen entstehen und in welcher Weise sie sich über die Lebensspanne des Menschen verändern. Die entwicklungspsychologische Forschung hat es sich zum Ziel gemacht, eine grundlegende Orientierung über den menschlichen Lebenslauf zu erarbeiten, sodass typische Entwicklungen und typische Probleme in bestimmten Lebensabschnitten kennengelernt werden können.[68] Auch für die Entwicklungspsychopathologie, die sich mit der Genese psychopathologischer Symptome[69] innerhalb einer normalen oder gestörten Entwicklung beschäftigt und den Einfluss von psychosozialen Belastungen für die Entwicklung beschreibt, was für das vorliegende Thema bzgl. Traumata zentral ist, ist es wichtig, Kenntnisse über sich vollziehende Entwicklungsschritte in diversen Lebensabschnitten auf biologischer, kognitiver, affektiver und sozialer Ebene zu erhalten.[70] Es ist hierbei nicht sinnvoll, nur einzelne Ebenen herauszugreifen, da sie sich zum Teil gegenseitig bedingen und miteinander korrelieren.[71] Die psychische Entwicklung, ein lebenslanger dynamischer Prozess, bei der es sich um Veränderungen im Psychischen und Physischen handelt,[72] kann somit nie nur für sich betrachtet werden, da sie mit zahlreichen Einflussgrößen wie den körperlichen Reifungsvorgängen oder aber eben auch den gesellschaftlichen Bedingungen eng verflochten ist.[73] Zu diesen Veränderungen tragen das anlagebedingte Wachsen und Reifen des Organismus und seiner physischen und psychischen Funktionen, bei. Dies geschieht in Abhängigkeit sowohl von der chronologischen Zeit sowie zufällig auftretender Ereignisse als auch durch die Wechselwirkung des sich entwickelnden Individuums mit den Umweltweinflüssen. Letztere können in Gestalt mannigfaltiger Anforderungen und daraus resultierender Lernprozesse[74] vorgeburtlich (pränatal)[75] wie auch nach der Geburt (postnatal) existieren.[76]
Entwicklung und Reifung erstreckt sich somit über die gesamte Lebensspanne eines Menschen, der über das komplette Leben auf sogenannte Entwicklungsaufgaben trifft. Entsprechend seinen inneren und äußeren Entwicklungs- und Reifungsprozessen wird er somit immer wieder mit neuen Aufgaben und Anforderungen konfrontiert. Die Bewältigung hiervon führt zu Veränderungen und trägt zur Stabilisierung der Persönlichkeit bei.[77]
Zwar bringt jeder Lebensabschnitt seine eigenen spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten mit sich, die jedoch zu gewissen Ähnlichkeiten bei der Entwicklung verschiedener Menschen führen.[78] Aber dennoch unterscheiden sich die Herausforderungen, denen sich der Einzelne in seinem Leben stellen muss, sowie seine Anpassungsstrategien von denen anderer Menschen. Sowohl die Entwicklungszeitpunkte als auch das Entwicklungsmuster sind individuell ganz verschieden.[79]
Lange Zeit glaubte man, dass Entwicklung in Stufen, Phasen oder Perioden erfolgt; in der neueren Entwicklungspsychologie vertritt man jedoch die Auffassung, dass Entwicklungsveränderungen eher kontinuierlich ohne feste Stufen, jedoch nicht völlig gleichmäßig erfolgen.[80]
Im Unterschied zum Beginn des 20. Jahrhunderts wird Entwicklung heute so verstanden, dass sie nicht auf einen End- oder Reifezustand am Ende der Pubertät mit dann folgender Stagnation abzielt, sondern Entwicklung wird als lebenslanger Prozess verstanden, der erst mit dem Tod endet. Vertrat man früher die Auffassung, dass Entwicklung immer zu einem höheren Niveau führt, so gehen neuere Ansätze davon aus, dass Entwicklung über die gesamte Lebensspanne immer gleichzeitig sowohl mit Wachstum oder Gewinn als auch mit Abbau oder Verlust verbunden ist.[81] Weiterhin war man lange Zeit der Meinung, dass Entwicklung etwas Kulturunabhängiges ist, wohingegen in modernen Konzeptionen hervorgehoben wird, dass Entwicklung stark von der Kultur abhängt, dies gilt insbesondere z. B. für die Moralentwicklung, aber auch für die Dauer und Gestaltung ganzer Entwicklungsabschnitte; selbst die biologische Entwicklung kann stark von kulturellen Einflüssen abhängen.[82]
Alterseinteilungen in der vorliegenden Arbeit
Wie bereits erläutert, werden, je nach Perspektiven, unterschiedliche Zeitpunkte für „Kindheit“ und „Jugend“ aufgeführt. Zur Strukturierung des individuellen Lebenszyklus werden in der Entwicklungspsychologie traditionell Alterseinteilungen benutzt.[83]
Die einzelnen Entwicklungsabschnitte werden rein pragmatisch, ohne der Annahme eines Stufenmodells, in verschiedene Lebensphasen eingeteilt: Die frühe Kindheit[84], die Kindheit, das Jugendalter, das frühe Erwachsenenalter, das mittlere Erwachsenenalter und das höhere Erwachsenenalter. Da für die vorliegende Masterarbeit nur die Lebensabschnitte der Kindheit und Jugend interessant sind, sollen auch nur diese Phasen betrachtet werden.
Aufgrund der zuvor aufgeführten Erkenntnisse wird deutlich, dass es schwierig ist, verlässliche zeitliche Angaben für die einzelnen Abschnitte der Entwicklung zu geben, da diese sehr individuell und auch je nach Geschlecht unterschiedlich anzusiedeln sind.[85] Auch das Ende ist vor dem Hintergrund der Kulturabhängigkeit des Jugendalters schwer zu bestimmen.[86] Je nach Autor lassen sich somit unterschiedliche zeitliche Eingrenzungen ablesen.[87]
Ich möchte mich, da diese Einteilung in einigen entwicklungspsychologischen Quellen[88] auffindbar ist, im Folgenden an die Unterteilung in pränatale Entwicklung, Neugeborenenalter, erstes und zweites Lebensjahr, frühe Kindheit (3-6), mittlere und späte Kindheit, (6-11) und Jugend (11-18) halten.
Oft wird, wenn von der Entwicklung des Kindes und Jugendlichen gesprochen wird, lediglich auf Entwicklungsmodelle[89] (weniger Entwicklung nach Lebensabschnitten) [z. B. die drei bekannten entwicklungspsychologischen Modelle nach Erik H. Erikson (Entwicklung als Weg zur Identität), Jean Piaget (kognitive Entwicklungsphasen des Kindes) und Lawrence Kohlberg (moralische Entwicklung)] hingewiesen oder die Entwicklungsaufgaben nach Robert James Havighurst oder Klaus Hurrelmann aufgegriffen. Eben weil es sich bei der Betrachtung jedoch um ein interdisziplinäres Wissen handelt (und somit auch soziale und gesellschaftliche Bedingungen mit einfließen sollten) und viele der Modelle als teilweise überholt gelten[90] und des Weiteren, um die Entwicklung nicht nur anhand von Modellen und Thesen begreifen zu können, soll eine Unterteilung in die einzelnen Entwicklungsbereiche nach Alter vorgenommen werden. Die Entwicklungsmodelle werden trotz allem an relevanter Stelle mit einbezogen.
2.3) Entwicklung in Kindheit und Jugend
„Sind die Kinder klein, müssen wir ihnen helfen, Wurzeln zu fassen. Sind sie aber groß geworden, müssen wir ihnen Flügel schenken.“[91]
Die Entwicklung eines Menschen lässt sich in verschiedene Bereiche unterteilen: Der zunächst auffälligste Entwicklungsbereich ist die körperliche Entwicklung. Hiermit verbunden sind die Entwicklung der Wahrnehmung, der Psychomotorik und die sexuelle Entwicklung. Ein weiterer zentraler Bereich der Entwicklung ist die kognitive (geistige) Entwicklung. Eng hiermit verbunden oder ein Teilaspekt hiervon sind die Gedächtnisentwicklung, die moralische Entwicklung und die Sprachentwicklung. Wichtige Bereiche sind des Weiteren noch die emotionale sowie die soziale Entwicklung.[92]
2.3.1) Pränatale Entwicklung
„In der Wahl seiner Eltern kann man nicht vorsichtig genug sein.“[93]
Die Einbeziehung der vorgeburtlichen Periode in die psychische Entwicklung des Kindes ist deshalb so bedeutungsvoll, weil in der Zeit von der Empfängnis bis zur Geburt vielfältige Prozesse des Wachsens und Reifens, aber auch schon des Lernens ablaufen, die jene Voraussetzungen schaffen, die für die Existenz in der biologischen und sozialen Umwelt notwendig sind.[94] Eine gewisse Kenntnis über vorgeburtliche Abläufe zu besitzen, ist somit für das Verständnis der Entwicklung von wichtiger Bedeutung, u. a. auch deswegen, weil diverse Prinzipien, die eine Aussage über die pränatale Entwicklung erlauben, wiederum auch die Entwicklung nach der Geburt erklären und umgekehrt zahlreiche postnatale Beeinträchtigungen ihren Ursprung in Störungen der vorgeburtlichen Entwicklung haben.[95] Dieser Notwendigkeit konnte dank der Entwicklung der Ultraschalluntersuchungen immer weiter nachgekommen und somit eine Vielzahl von Erkenntnissen über die intrauterine Entwicklung erfahren werden.[96] Die Erforschung der pränatalen Psychologie ist insgesamt zwar noch sehr jung und die bereits erworbenen Erkenntnisse über die pränatale psychische Entwicklung sind noch sehr lückenhaft[97], doch es bleibt zu hoffen und es ist auch davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren noch weitere interessante und gewinnbringende Entdeckungen auf diesem Gebiet gemacht werden.[98]
Eine Schwangerschaft dauert im Normalfall rund 40 Wochen[99] von der Konzeption bis zur Geburt.[100] In dieser Zeit wächst im Mutterleib aus einer Zelle ein lebensfähiger Mensch mit all seinen Organen und Gliedmaßen heran.[101] Man unterscheidet drei Phasen der Entwicklung von der Eizelle bis zur Geburt: 1) Keimphase (erste bis Mitte der zweiten Schwangerschaftswoche); hier erfolgen die Befruchtung, die ersten Zellteilungen und die Einnistung der Eizelle im Uterus; Embryonalstadium (Mitte der zweiten bis zur achten Woche), in dem sich die wichtigsten Organsysteme entwickeln; Fetalstadium (ab der neunten Woche nach der Befruchtung)[102], das v. a. D. dem Wachstum und der Ausreifung dient.[103] Die pränatale Entwicklung ist größtenteils genetisch vorprogrammiert, wobei sich bereits hier Umwelteinflüsse[104] bemerkbar machen können.[105]
Körperlich-motorische und sensorische Entwicklung
Die Entstehung eines Menschen beginnt mit der Befruchtung, wenn also ein Spermium in eine Eizelle eindringt und die beiden hälftigen DNS-Stränge[106] zu einer einzigartigen Genkombination verschmelzen. Wenn dieser Prozess erfolgreich ist, teilt sich die befruchtete Eizelle (Zygote) nach ca. 30 Stunden zum ersten Mal[107] ; in den folgenden drei bis vier Tagen erfolgt eine ganze Reihe von schnell aufeinander folgenden Zellteilungen.[108] Nach ungefähr fünf bis sechs Tagen differenziert sich die Zellansammlung (diese nennt man nun Blastozyste) in zwei Teile, von denen sich dann einer zum Embryo weiterentwickelt, während aus dem anderen Versorgungsstrukturen entstehen. Am Ende der ersten Schwangerschaftswoche (SSW) kommt es zu einer Einnistung der Blastozyste in die Gebärmutterschleimhaut, am Ende der zweiten SSW ist dann die Keimscheibe gebildet, aus der der Embryo dann entsteht. Somit sind einige relevante Entwicklungsschritte bereits geschehen, bevor die Mutter die Schwangerschaft überhaupt registriert.[109] In der Embryonalzeit ab der dritten SSW setzt dann die Entstehung des Nervensystems, sowie der inneres Organe und äußeren Extremitäten ein. Das erste Verhalten jedes Kindes ist hierbei der Herzschlag, der mit etwa drei Wochen einsetzt, wo der Embryo gerade mal 0,4cm groß ist.[110]
Jeder Mensch durchlebt bei seiner embryonalen Entwicklung die Stadien der früheren Stammesentwicklung. So entwickeln sich bereits nach etwa 17 Tagen nach der Befruchtung durch die am Embryo entstehende Neuralrinne erste Ansätze des Gehirns und aus der sich zum 27. Tag das Neuralrohr als Vorläufer von Rückenmark und Gehirnstamm entwickelt (bis zur Geburt sind der Gehirnstamm und das Rückenmark nahezu vollständig entwickelt). Rückenmark und Stammhirn bilden die älteren, hinteren Abschnitte des Gehirns und werden manchmal auch Reptiliengehirn genannt, da sie für die Steuerung der Überlebensreaktionen zuständig sind (Regulation der Atemmuskulatur, des Herz-Kreislaufsystems, Körpertemperatur und vegetatives Nervensystem).[111] Die mittleren Abschnitte bestehen aus Mittel- und Zwischenhirn. Hier ist auch das limbische System beheimatet, das eine zentrale Rolle bei Gefühlen spielt („emotionales Gehirn“).[112] Der dritte Abschnitt ist der sich am spätesten und langsamsten entwickelnde Teil des Gehirns (Vorderhirnhemisphären, orbifrontaler Kortex/ kognitives Gehirn), der dazu benötigt wird, diverse Fähigkeiten[113] auszuüben.[114]
Schon ab der fünften bis sechsten Woche nach der Befruchtung beginnt der Embryo seinen Kopf und sein Rückgrat zu beugen. Mit etwa sieben Wochen ist so etwas wie „Schluckauf“ zu beobachten.[115] In der siebten[116] bzw. achten SSW ist das Nervensystem dann bereits so weit ausgereift und mit den Extremitäten verbunden, dass bereits erste, jedoch zunächst noch unkoordinierte Bewegungen und einfache Reaktionen auf Berührungen möglich sind. Weitere Entwicklungsschritte in der Embryonalzeit sind der Beginn der Entwicklung der Sinnesorgane (der Tastsinn ist hierbei der zuerst entstehende Sinn; bereits mit fünfeinhalb Wochen zeigt der Fetus Reaktionen auf Berührung der Lippen und Nase)[117] und die Entwicklung der Geschlechtsorgane.[118]
Bei der dann einsetzenden, als Fetalstadium titulierten, Zeit, sind dann alle zentralen Organe sowie Körperteile angelegt, sodass die weitere Entwicklung v. a. D. durch Größenwachstum, Differenzierung, Koordination und pränatales Leben geprägt ist. In der zwölften SSW sind dann, bedingt durch die Reifung des zentralen und peripheren Nervensystems sowie der Muskeln, erste koordinierte Bewegungen möglich, die dann für die Mutter ab der 17. bis 20. SSW spürbar sind.[119] Auch reifen zu dieser Zeit auditorische und visuelle Sinnesorgane heran, sodass in der 20. SSW bereits erste Reaktionen auf Geräusche, sowie Lichtreize auftreten. Spätestens ab dem sechsten Schwangerschaftsmonat ist eine Reaktion des ungeborenen Kindes auf Außengeräusche mit Veränderungen in ihren Bewegungen und der Pulsfrequenz zu vernehmen. Ab der 23. SSW können Föten dann bereits auf Hörreize reagieren, allerdings nur auf laute Geräusche und nur auf bestimmte Frequenzen; ab der 35. Woche ist der Gehörsinn dann bereits differenziert und Tonhöhen und Klänge können unterschieden werden.[120] Auch kann der Fetus ca. ab der 28. Gestationswoche Gerüche wahrnehmen.[121]
Im dritten Schwangerschaftsdrittel sorgt dann das Wachstum der Großhirnrinde[122] (zerebraler Kortex) für eine fortschreitende neurologische Organisation, sodass ab der 28. SSW wechselnde Phasen von Wachheit und Inaktivität auftreten. Außerdem besteht eine zunehmende Reaktionsbereitschaft auf äußere Reize, auch erste Reflexe treten auf (z. B. Greifen).[123]
Fand die Entwicklung des Gehirns und der Sinnesorgane zunächst unabhängig voneinander statt, kommt es zwischen der 25. bis 37. SSW zur Verschaltung.[124] Ab diesem Zeitpunkt sind die neurophysiologischen Grundlagen für Lernerfahrungen über die Sinnesorgane gelegt.[125] Ab der 30. SSW wird der Körper dann auf das Leben außerhalb des Mutterleibs vorbereitet, sodass u. a. die Lungen ausreifen, eine Fettschicht in der Haut angelegt wird (u. a. zur Temperaturregulation) und der Fetus Antikörper aus dem Blut der Mutter (Immunsystem) erhält.[126] Da im letzten Schwangerschaftsdrittel nicht mehr viel Bewegung in der Gebärmutter möglich ist, stehen für das Kind in dieser Zeit das Hören[127], die propriozeptive[128] und taktile Wahrnehmung im Vordergrund. Es spürt die Berührung des Fruchtwassers sowie den Druck der Gebärmutterwand, zudem riecht, schmeckt und hört es; so bereitet es sich bereits auf seine neue Umwelt vor.[129]
Als gesichert kann angenommen werden, dass sich die vorgeburtliche Entwicklung jedoch nicht nur etwa auf die körperliche Entwicklung eines Menschen bezieht. Trotz der „Unreife“ eines Fetus erwirbt dieser eine Menge von Eindrücken und Erfahrungen, die ihn auf das Leben nach der Geburt vorbereiten.[130] Auf diese kognitiven Aspekte möchte ich nun kurz eingehen.
Geistige/ kognitive Entwicklung
Als Kognitionen versteht man Erkenntniseinheiten des Bewusstseins, die auf Sinneserfahrungen, Vorstellungen, Denken und/ oder Erinnern beruhen. Kognitive Prozesse sind Prozesse der Informationsverarbeitung und der Handlungssteuerung des Menschen im Licht von Bewertungen und des verfügbaren Wissens. Diese Prozesse können auf sehr unterschiedlichem Niveau, je nach Entwicklungsstand des Individuums, stattfinden.[131] Die geistige Entwicklung beginnt bereits pränatal und es ist belegt, dass das Kind bereits im Mutterleib eine Wahrnehmungsfähigkeit besitzt.[132] Die Frage, ob man sich an das Leben vor der Geburt erinnern kann, wirft immer wieder neues Interesse auf, insbesondere, wenn es um negative Einflüsse wie Traumata oder schweren Stress der Mutter während Schwangerschaft und Geburt geht. Um sich an diese Frage anzunähern, ist es jedoch relevant zwei Arten des Erinnerns zu unterscheiden, die in Kapitel 2.3.3 nochmal genauer behandelt werden: 1) bewusste, explizite Erinnerungen (die man als Gedächtnis bezeichnet) und 2) unbewusste, implizite Erinnerungen.[133] Die bewussten Erinnerungen enthalten Fakten und Ereignisse und mithilfe des expliziten Gedächtnisses ist es uns möglich, zu wissen, wer wir sind was und wann wir etwas erlebt haben usw. Die unbewussten Erinnerungen hingegen enthalten eine Fülle von Eindrücken, Gewohnheiten, erlernten motorischen, perzeptiven und kognitiven Fähigkeiten und Konditionierungen. Zunächst entwickelt sich jedoch das implizite Erinnern, weswegen in der Pränatalzeit nur von dieser Art Erinnerungen auszugehen ist.[134] Bereits dem Fetus ist es somit möglich, Erfahrungen abzuspeichern, sodass das Kind also Erinnerungen an die vorgeburtliche Zeit hat, die z. B. die Wahrnehmung und das Lernen beeinflussen, jedoch sind sie nicht explizit abrufbar, da sich die neurologischen Strukturen, die hierzu notwendig wären, nur langsam und bis in die späte Kindheit hinein entwickeln.[135] Untersuchungen konnten zudem zeigen, dass das Gedächtnis eines Fetus nicht nur auf das kurzfristige Wiedererkennen beschränkt ist, sondern Säuglinge sich nach der Geburt an Erfahrungen erinnern, die sie im Mutterleib gemacht haben, oft sogar bereits Monate später.[136] Vor allem im dritten Schwangerschaftsdrittel sind die Lernfähigkeit und das Gedächtnis des Fetus so weit entwickelt, dass pränatale Erfahrungen über die Geburt hinweg und über längere Zeiträume bestehen bleiben.[137]
Insgesamt lassen sich einige Lernprozesse in dieser Phase erkennen,[138] sodass ein Hinweis auf intrauterines Lernen z. B. der Prozess der Gewöhnung ist. Ab der 23. Woche ist nachweisbar, dass der Fetus sich an Reize zu gewöhnen scheint und nicht mehr auf diese reagiert.[139] Auch eine weitere Form des Lernens, die klassische Konditionierung, konnte bereits bei fünfeinhalbmonatigen Feten nachgewiesen werden. Eine gewisse Musik, die die Kinder intrauterin hörten, löste nach der Geburt auch die gleiche Reaktion hervor wie intrauterin.[140]
Heutzutage wird davon ausgegangen, dass Lernerfahrungen im Zentralnervensystem (ZNS) gespeichert werden, indem neue Verbindungen zwischen Nervenzellen entstehen bzw. vorhandene Verbindungen verändert werden. In der Pränatalzeit wird die Grundlage für diese Prozesse geschaffen und hierbei kommt es zunächst zu einer Überproduktion an Neuronen und neuronalen Verbindungen. Aber bereits in dieser Zeit setzen auch gegenläufige Prozesse ein, indem Neuronen absterben (Apoptose) oder neuronale Verbindungen gekappt werden (Pruning). Dieser gleichzeitige Auf- und Abbau ermöglicht eine Selektivität der Entwicklung, denn durch das Absterben nicht genutzter Neuronen entstehen Freiräume für benötigte neuronale Verbindungen. Hierbei bestimmen Erfahrungsproesse, welche Verbindungen gestärkt werden und welche nicht.[141]
Die pränatale Entwicklung ist also zum Großteil genetisch vorprogrammiert, aber auch hier machen sich bereits Umwelteinflüsse bemerkbar. Denn obwohl das im Fruchtwasser schwebende Ungeborene im Uterus geschützt und von vielen Reizen abgeschirmt erscheint, ist es einer Menge von Reizen ausgesetzt, die auf die werdende Mutter einwirken und in seinem Nervensystem verarbeitet werden und seine Entwicklung beeinflussen können. Jüngere Forschungsergebnisse legen somit nahe, dass das Erleben des Fetus Auswirkungen auf seine weitere Entwicklung hat.[142] So spricht man von einigen vorgeburtlichen Risikofaktoren, die die gesunde Entwicklung des Kindes auf verschiedene Art und Weise[143] beeinträchtigen können (Teratogene)[144]: Krankheiten, Einnahme bestimmter Medikamente, Drogen, Alkohol, Rauchen, Umweltgifte, ionisierende Strahlung wie Röntgen, Fehl- oder Unterernährung der Mutter, mangelnde Versorgung durch die Plazenta (steigt bei höherem Alter der Mutter) etc. Neben den gesundheitlichen Risiken können aber auch genetische Risikofaktoren und auch psychische Belastungen (wie z. B. die Ablehnung des Kindes, Tod des Partners, schwierige Lebensumstände) die Entwicklung des Kindes negativ beeinflussen.[145]
Sozio-emotionale Entwicklung
Etwa acht Wochen vor der Geburt kann das heranwachsende Kind die mütterlichen Herztöne und Umweltgeräusche hören und es beruhigt sich, wenn die Mutter z. B. über den Bauch streichelt.[146] Das Ungeborene bindet sich somit über sensorische Wahrnehmung, doch auch durch Riechen und Hören stellt der Fetus sicher, dass er bevorzugt auf die Umgebung reagiert, die sich nach seiner Geburt höchstwahrscheinlich um ihn sorgen wird. Diese sensorische Grundausstattung kann man somit als Ursprung von Bindung, wie man sie heute definiert, verstehen. Ein genauer Zeitpunkt, wann diese Bindung exakt beginnt, ist schwer festzumachen. Man kann jedoch davon ausgehen, dass Reiz-Reaktionsschleifen ab dem Zeitpunkt der Empfängnis bereits einsetzen, da sich immerhin die Eizelle ein Spermium aussucht, mit dem sie interagieren kann.[147]
Jede Empfindung der Mutter sowie Außenreize übertragen sich auf das Kind. Auch die Einstellung der werdenden Mutter zu ihrem Kind ist für seine Entwicklung, seine Persönlichkeit, seine Beziehungen sowie sein soziales Verhalten von Bedeutung.[148] Die emotionale Einstellung der Mutter beeinflusst somit auch die emotionale Entwicklung und Bindungsfähigkeit des Babys, da das Kind direkt erlebt, ob sich seine Mutter freut, ob sie unter Stress steht, wie sie sich fühlt oder wie ihre Einstellung gegenüber ihrem Kind ist. Die gelingende Kommunikation der Mutter mit dem ungeborenen Kind schafft eine tiefe beidseitige Verbindung, die gerade für das Kind zu einer unschätzbaren Ressource wird.[149] Insgesamt gilt die Entwicklung der Beziehung zum ungeborenen Kind als wichtige Voraussetzung für die postnatale Mutter-Kind-Beziehung.[150] Herrschen in der pränatalen Zeit jedoch zu viele stressvolle Stimuli oder negative Einflüsse, so kann es neben Störungen der Hirnentwicklung, die Auswirkungen auf den Aufbau der Nervenzellen, das Hirnvolumen und die Gehirninnenräume haben, auch zu Störungen der Bindungsfähigkeit nach der Geburt kommen. Dies drückt sich dadurch aus, dass diese Kinder z. B. ein schwach ausgeprägtes Geborgenheitsgefühl mit auf die Welt bringen und ängstlicher, unsicherer und schwerer zu beruhigen sind als Kinder mit günstigen pränatalen Erfahrungen (vgl. Kapitel 3.6 und 3.7.2).[151]
[...]
[1] Aus: Kaukoreit, Volker/ Wagenbach, Klaus. Erich Fried. Gesammelte Werke. Berlin 2006.
[2] Vgl. Sachsse, Ulrich/ Schilling, Lars/ Eßlinger, Katja. Ein stationäres Behandlungsprogramm für Patientinnen mit selbstverletzendem Verhalten (SVV) (S. 213-223), in: Streeck-Fischer, Annette (Hrsg.). Adoleszenz und Trauma. Göttingen 1999, S. 223.
[3] Vgl. Schwichtenberg, Nina. Trauma und Sucht – Zusammenhänge und therapeutische Möglichkeiten (Bachelorarbeit). Hamburg 2012, S. 1.
[4] Vgl. ebd., S. 1f.
[5] „Die Traumaforschung hat uns darüber belehrt, dass Menschen nach einem Trauma ‚dichtmachen‘, ihre Gefühle nicht mehr spüren können und dass das ein Schutz ist“ (Krüger, Andreas/ Reddemann, Luise. Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie für Kinder und Jugendliche. PITT-KID – Das Manual. Stuttgart 2007, S. 127).
[6] Vgl. hierzu Steil, Regina/ Straube, Eckart R. Posttraumatische Belastungsstörung bei Kindern und Jugendlichen (S. 1-13), in: Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 31(1). 2002.
[7] „Das Schamgefühl ist der sicherste Garant dafür, dass sozial nicht akzeptable und peinliche Taten zum Tabuthema und schließlich zum Geheimnis werden. Nicht nur der oder die Täter werden durch das Schamgefühl von einem Offenlegen der Tat abgehalten, auch diejenige, die etwas wissen könnten oder es zumindest ahnen, blicken weg, um nicht mit Schamgefühl konfrontiert zu werden. Das emotionale Band zwischen dem oder den Tätern und der sozialen Gemeinschaft ist damit aber zerrissen“ (Ruppert, Franz. Trauma, Bindung und Familienstellen. Seelische Verletzungen verstehen und heilen. Stuttgart 2010 S. 169).
[8] Er gab an, „dass die Tatsache, dass sich nicht nur die Täter, sondern auch Opfer z. T. nicht mehr an Traumatisierungen, die nach Krieg und Holocaust passierte, erinnern wollte, sowohl auf psychischen wie auf sozialen Bedingungen beruht. Er formulierte hierzu das Bild einer „doppelten Mauer des Schweigens“: „wenn die Überlebenden ein Loch in die sich schließende Mauer schlugen und endlich bereit waren zu sprechen, stießen sie auf eine zweite Mauer des Schweigens, die sich die umgebende Gesellschaft als einen Schutzwall gegen das Trauma errichtet hatte“ (Assmann, Aleida. Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München 2006, S. 99).
[9] Vgl. Herrmann, Bernd u. a. Kindesmisshandlung: Medizinische Diagnostik, Intervention und rechtliche Grundlagen. Heidelberg 2008, S. 198. In Bezug auf sexuellen Missbrauch durch Familienmitglieder lautet das gesellschaftliche Tabu somit damals wie heute: „Wer darüber spricht, dem glaubt keiner. Er macht sich lächerlich und grenzt sich aus“ [Steinhage, Rosemarie. Sexual Abuse – No Excuse. Bilanz einer parteilichen Arbeit gegen sexualisiert Gewalt (S. 139-155), in: Özkan, Ibrahim (Hrsg.). Trauma und Gesellschaft: Vergangenheit in der Gegenwart. Göttingen 2002, S. 139].
[10] Die Zeit (Hrsg.). Niemand lebt im Augenblick (03.12.1998). URL: http://www.zeit.de/1998/50/ 199850.assmann_.xml (Stand: 16.05.2013), S. 1.
[11] Vgl. Bilgeri, Robert. Denn sie wissen nicht, was sie tun…Oder wissen sie es doch? (S. 149-186), in: Perner, Rotraud A. (Hrsg.). Missbrauch: Kirche – Täter – Opfer. Wien 2010, S. 162.
[12] Vgl. Weiß, Wilma. Philipp sucht sein Ich. Zum Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen. Weinheim/ Basel 2013, S, 26.
[13] Fischer, Gottfried/ Riedesser, Peter. Lehrbuch der Psychotraumatologie. Stuttgart 2009, S. 286.
[14] Vgl. ebd.
[15] Zur Forschungslage und die Auflistung von Längsschnittstudien zu frühen Stresserfahrungen vgl. Egle, Ulrich Tiber. Frühe Stresserfahrungen in der Kindheit haben gesundheitliche Folgen (S. 73-96), in: Stiftung zum Wohl des Pflegekindes (Hrsg.). Traumatische Erfahrungen in der Kindheit – langfristige Folgen und Chancen der Verarbeitung in der Pflegefamilie. Tagesdokumentation der 15. Jahrestagung. Idstein 2005, S. 73ff.
[16] Vgl. Terr, Lenore C. Childhood traumas: on outline and overview (pp. 10-20), in: American Journal of Psychiatry, 148. 1991.
[17] Lange Zeit wurde die Bearbeitung von Traumata ausschließlich an den therapeutischen Bereich abgegeben (vgl. Weiß. Philipp sucht sein Ich. 2013, S. 85).
[18] Vgl. Gahleitner, Silke Birgitta. Biografiearbeit und Trauma (S. 142-152), in: Miethe, Ingrid (Hrsg.). Biografiearbeit – Lehr- und Handbuch für Studium und Praxis. Weinheim/ München 2011, S. 142.
„Obwohl ein mannigfaltiges Angebot therapeutischer Ansätze für Jugendliche mit psychischen Störungen vorliegt, gibt es bisher einen Mangel an konkreten Ansätzen für die pädagogische Arbeit mit ihnen. Dies liegt sicher mit daran, dass der professionelle Umgang mit psychisch gestörten Menschen bislang vorwiegend den Psychologen und Psychiatern vorbehalten war. Ebenso ist das Gebiet der Diagnostik psychischer Störungen bis heute diesen Berufsgruppen vorbehalten. Psychologie und Psychiatrie haben – jeweils eigene – Erklärungs- und Veränderungsmodelle psychischer Störungen entwickelt, die sich in der Regel auf den Kontext der Einzel- und/oder Gruppentherapie beziehen. Diese Modelle in den pädagogischen Kontext zu übertragen, ist nicht ohne Weiteres möglich. Erschwerend kommt dabei hinzu, dass sich eigene therapietypische Sprachmuster und Ausdrücke herausgebildet haben, die dem Nicht-Therapeuten oft kaum mehr verständlich sind“ (Baierl, Martin. Herausforderung Alltag. Praxishandbuch für die pädagogische Arbeit mit psychisch gestörten Jugendlichen. Göttingen 2010, S. 11f.).
[19] Vgl. Kühn, Martin. „Macht Eure Welt endlich wieder mit zu meiner!“ Anmerkungen zum Begriff der Traumapädagogik (S. 24-37), in: Bausum, Jacob/ Besser, Lutz/ Kühn, Martin/ Weiß, Wilma (Hrsg.). Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis. Weinheim/ Basel 2013, S. 34f.
[20] Vgl. Hüsson, Dorothea. Traumatisierte Kinder im pädagogischen Alltag. Leitartikel aus dem Jahresbericht 2010 von Wildwasser Esslingen e. V., S. 1.
[21] Vgl. BAG Traumapädagogik. Standards für traumapädagogische Konzepte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Positionspapier. 2011, S. 4. Vgl. Bausum 2013, S. 8.
[22] Vgl. Hüsson 2010, S. 1.
[23] Vgl. Weiß. Philipp sucht sein Ich. 2013, S. 9.
[24] V. a. D. im Bereich komplexer Traumata, bei denen sich die Traumaproblematik mit anderen sozialen Benachteiligungsaspekten vermengt (vgl. Weiß. Philipp sucht sein Ich. 2013, S. 9).
[25] Da die Aufenthaltszeit der Kinder auf maximal ein Jahr beschränkt ist, ist eine ständige Fluktuation erkennbar.
[26] Dies war u. a. dadurch bedingt, dass durch die zeitlichen Belastungen keine richtige Einarbeitung meinerseits in das Arbeitsfeld oder die Sichtung der Akteneinträge bzgl. der Aufnahmegründe etc. der Kinder und Jugendlichen möglich war.
[27] „(…) sondern, daß wir zu ihren Gefühlen emporklimmen müssen. Emporklimmen, uns ausstrecken, auf Zehenspitzen stellen, hinlangen. Um nicht zu verletzen“ (Korczak 1973, S. 7).
[28] Vgl. hierzu z. B. Weiß. Philipp sucht sein Ich. 2013, S. 90.
[29] Auch um definieren zu können, was Kindheit und Jugend ist und wann diese Lebensphasen jeweils zeitlich festzumachen sind.
[30] Vgl. Posth, Rüdiger. Gefühle regieren den Alltag. Schwierige Kinder zwischen Angst und Aggression. Mit Anmerkungen zur frühen Fremdbetreuung. Münster 2010, S. 11; Winert, Franz E. Entwicklung im Kindesalter. Münster 1998, S. 3.
[31] Vgl. Rossmann, Peter. Einführung in die Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters. Bern 1996, S. 11.
[32] Vgl. ebd.
[33] Vgl. Riedesser, Peter. Entwicklungspsychopathologie von Kinder mit traumatischen Erfahrungen (S. 160-171), in: Brisch, Karl Heinz/ Hellbrügge, Theodor (Hrsg.). Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern. Stuttgart 2003, S. 163.
[34] Eine zu detaillierte Auflistung der einzelnen Entwicklungsschritte je nach Lebensalter hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt und erschien auch nicht erforderlich, da es primär um eine grobe Übersicht und Verständnis der Entwicklung geht und v. a. D. die Bereiche Beachtung finden sollten, auf die Traumata einwirken. In diesem Sinne soll an dieser Stelle auf einschlägige Werke der Entwicklungspsychologie wie Berk, Laura E. Entwicklungspsychologie. München 2011 oder Schneider, Wolfgang/ Lindenberger (Hrsg.). Entwicklungspsychologie. Weinheim/ Basel 2012 verwiesen werden.
[35] Obwohl diese Unterteilung nur in weniger Fachliteratur aufzufinden ist, erschien mir dennoch die Einteilung der Auswirkungen je nach Altersgruppe sinnvoll.
[36] Vgl. Beckrath-Wilking, Ulrike. Einleitung (S. 19-24), in: Beckrath-Wilking, Ulrike/ Biberacher, Marlene/ Dittmar, Volker/ Wolf-Schmid, Regina (Hrsg.). Traumafachberatung, Traumatherapie & Traumapädagogik. Ein Handbuch für Psychotraumatologie im beratenden, therapeutischen & pädagogischen Kontext. Paderborn 2013, S. 20.
[37] Vgl. Egloff, Birte. Praxisreflexion (S. 211-219), in: Kade, Jochen u. a. Pädagogisches Wissen. Erziehungswissenschaft in Grundbegriffen. Stuttgart 2011, S. 211.
[38] Merkens, Hans. Wie viel Forschung verträgt ein berufsqualifizierendes Studium? (S. 119-126), in: Otto, Hans-Uwe/ Rauschenbach, Thomas/ Vogel, Peter (Hrsg.). Erziehungswissenschaft. Lehre und Studium. Opladen 2002, S. 121.
[39] Hier habe ich mich speziell an dem Werk „Entwicklungspsychologie“ von Laure E. Berk (Berk, Laura E. Entwicklungspsychologie. München 2011) sowie „Entwicklungspsychologie“ von Wolfgang Schneider und Ulman Lindenberger (Schneider, Wolfgang/ Lindenberger, Ulman (Hrsg.). Entwicklungspsychologie. Weinheim/ Basel 2012) orientiert, da diese ein gutes und übersichtliches Grundlagenwissen bieten und überdies mit der von mir präferierten Alterseinteilung (vgl. Kapitel 2.2) konform gingen.
[40] Hier konnten dennoch Werke wie „Trauma und Entwicklung. Frühe Traumatisierungen und ihre Folgen in der Adoleszenz“ von Annette Streeck-Fischer (Streeck-Fischer, Annette. Trauma und Entwicklung. Frühe Traumatisierungen und ihre Folgen in der Adoleszenz. Stuttgart 2006) oder „Trauma und Persönlichkeitsstörungen. Psychodynamisch-integrative Therapie“ von Wolfgang Wöller (Wöller, Wolfgang. Trauma und Persönlichkeitsstörungen. Psychodynamisch-integrative Therapie. Stuttgart 2006) sowie „Psychotraumatologie des Kindesalters. Grundlagen, Diagnostik und Interventionen“ von Markus A. Landolt (Landolt, Markus A. Psychotraumatologie des Kindesalters. Grundlagen, Diagnostik und Interventionen. Göttingen 2012) die Bearbeitung erleichtern.
[41] Dies liegt sicherlich in der Tatsache begründet, dass der professionelle Umgang mit traumatisierten Kindern bislang vorwiegend Psychologen oder Psychiatern vorbehalten war (vgl. Baierl 2008, S. 11).
[42] Weiß, Wilma. Philipp sucht sein Ich. Zum Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen. Weinheim/ Basel 2013.
[43] Vgl. Rießinger, Simone. Traumapädagogik und Sekundäre Traumatisierung (Abschlussarbeit). Bremen 2011, S. 1.
[44] Des Weiteren konnten Werke wie „Traumatisierte Kinder und Jugendliche in Deutschland. Analysen und Empfehlungen zu Versorgung und Betreuung“ von Jörg M. Fegert, Ute Ziegenhain und Lutz Goldbeck (Fegert, Jörg M./ Ziegenhain, Ute/ Goldbeck, Lutz (Hrsg.). Traumatisierte Kinder und Jugendliche in Deutschland. Analysen und Empfehlungen zu Versorgung und Betreuung. Weinheim/ München 2010) und das Herausgeberwerk „Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis“ von Jacob Bausum, Lutz Ulrich Besser, Martin Kühn und Wilma Weiß (Bausum, Jacob/ Besser, Lutz Ulrich/ Kühn, Martin/ Weiß, Wilma (Hrsg.). Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis. Weinheim/ Basel 2013) einen zusätzlichen Einblick in diese junge Disziplin ermöglichen.
[45] Ullrich, Heiner. Das Kind als schöpferischer Ursprung – Studien zur Genese des romantischen Kindbildes und zu seiner Wirkung auf das pädagogische Denken. Bad Heilbrunn 1999, S. 13.
[46] Vgl. Oerter, Rolf. Kultur, Ökologie und Entwicklung (S. 85-116), in: Oerter, Rolf/ Montada, Leo (Hrsg.). Entwicklungspsychologie. Weinheim/ Basel 2008, S. 85ff.
[47] Vgl. Hofmann, Regina. Der kindliche Ich-Erzähler in der modernen Kinderliteratur. Eine erzähltheoretische Analyse mit Blick auf aktuelle Kinderromane. Frankfurt am Main 2010, S. 91.
[48] Im 17. Jahrhundert forderte der Pädagoge Johann Amos Comenius einen kindgemäßen Unterricht; der Philosoph John Locke setzte sich für empirische Studien über Kinder und Jugendliche ein. In der Folge formulierten Pädagogen wie Jean-Jacques Rousseau, Heinrich Pestalozzi und Friedrich Fröbel die ersten pädagogischen Diskurse zur menschlichen Entwicklung (vgl. Grob, Alexander/ Jaschinski, Uta. Erwachsen werden: Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Weinheim/ Basel/ Berlin 2003, S. 13).
[49] Vgl. Gudjons, Herbert. Pädagogisches Grundwissen. Bad Heilbrunn 2008, S. 109f.
[50] Vgl. Bründel, Heidrun/ Hurrelmann, Klaus. Einführung in die Kindheitsforschung. Weinheim/ Basel 1996, S. 13.
[51] Vgl. Scherr, Albert. Jugendsoziologie. Einführung in Grundlagen und Theorien. Wiesbaden 2009, S. 19.
[52] Vgl. Grob, Alexander/ Jaschinski, Uta. Erwachsen werden: Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Weinheim/ Basel/ Berlin 2003, S. 13.
[53] Sodass weder in der Antike noch im Mittelalter der Entwicklungsbegriff im heutigen Sinne existierte (vgl. ebd.).
[54] Vgl. Bründel/ Hurrelmann 1996, S. 13; Hofmann 2010, S. 91f.
[55] Vgl. ebd. Sowohl die „Entdeckung“ von Kindheit und Jugend, aber auch die zunehmende Differenzierung in Altersstufen ist eine Folge von historischen und gesamtgesellschaftlichen Prozessen [vgl. hierzu Coelen, Thomas/ Otto, Hans-Uwe (Hrsg.). Grundbegriffe Ganztagsbildung. Das Handbuch. Wiesbaden 2008, S. 32f.].
[56] Heidrun Bündel und Klaus Hurrelmann geben an, dass die Abgrenzung der Lebensphasen „Kindheit“, „Jugend“ und „Erwachsensein“ aufgrund sich überschneidender Lebensbereiche und -erfahrungen immer schwieriger geworden sei (vgl. Bründel/ Hurrelmann 1996, S. 13). Vor dem Hintergrund ökonomischer und kultureller Faktoren prognostiziert Hurrelmann z. B. für das Jahr 2030 eine immer stärkere Unterteilung der Lebensspannen in einzelne Phasen, im Vergleich zum Jahr 1910. Vgl. hierzu Abb. 1) Lebensphasen im historisch-gesellschaftlichen Wandel im Anhang, S. 252 .
[57] Vgl. Muri, Gabriela/ Friedrich, Sabine. Stadt(t)räume – Alltagsräume? Jugendkultur zwischen geplanter und gelebter Urbanität. Wiesbaden 2009, S. 100f.
[58] Klare Grenzen können somit zwischen den einzelnen Lebensabschnitten nicht gezogen werden, denn „die Grenzziehung zwischen den einzelnen Lebensabschnitten könnte in dem gleichen Maße schwinden, wie die Zahl der aufeinander folgenden Lebensphasen im Lebenslauf ansteigt“ (Hurrelmann, Klaus. Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendphase. Weinheim/ München 1999, S. 25).
[59] Seit Beginn der Nachkriegszeit hat sich die Gesellschaft schnell und grundlegend verändert. Diese Wandlungen erstrecken sich auf fast alle Bereiche des sozialen Lebens, wozu u. a. soziale Abläufe, familiäre Lebens-, sowie Schul- und Arbeitswelten sowie die Vielfalt körperlicher und psychischer Erkrankungen gehören. Diese soziokulturell, sozioökonomisch sowie gesellschaftlich-politisch beobachtbaren Wandlungsprozesse in den letzten Jahrzehnten erfassen längst auch diejenigen Kinder, die heutzutage in veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aufwachsen, weswegen infolge hiervon von einem Wandel des sozialen Zustandes von „Kindheit“ gesprochen wird. Diese „veränderte Kindheit“ hat wiederum zum Teil schwerwiegende Änderungen für die Verläufe und Ergebnisse des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen sowie deren Handlungsweisen zur Folge [vgl. Block, Britta. Kindheit im Wandel – Veränderte Bedingungen des Kindseins seit dem Ende des zweiten Weltkrieges (Vordiplomarbeit) 2006, S. 4].
[60] Vgl. Ossowski, Ekkehard/ Rösler, Winfried (Hrsg.). Kindheit. Interdisziplinäre Perspektiven zu einem Forschungsgegenstand. Stuttgart 2002, S. 1.
[61] „Kindheit ist ein Begriff, der in den Wissenschaftsdisziplinen, die sich im weitesten Sinne mit Kindern beschäftigen, in sehr unterschiedlicher, jeweils spezifischer Form gefasst wird. Aus biographie- oder entwicklungspsychologischer Perspektive wird Kindheit als der individuelle Lebensabschnitt gesehen, der besonders prägend für die eigene Biographie ist; aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive als Lebensphase, in der bestimmte Kompetenzen, Qualifikationen und Eigenschaften erworben werden sollen, die Konsequenzen für den Lebenslauf als Ganzes haben; aus juristischer Perspektive als Altersphase, der spezifische juristische Attribute wie Unmündigkeit, Geschäftsunfähigkeit, Religions-Unmündigkeit, Schulpflicht etc. zugeordnet sind, oder aber auch aus soziologischer Perspektive als Zusammenhang gesellschaftlicher Bedingungen, in denen Kinder leben. Auf welche Art und Weise Kindheit gefasst wird, ist der jeweiligen Disziplin inhärent, die diese als ihren Gegenstand bestimmt und damit Kindheit konstituiert. Die jeweiligen disziplinären Bestimmungen sind kulturell und historisch entstanden und geprägt. Das heißt, ihre Erklärungsversuche und Modellbildungen verändern sich über die Zeit“ (Mierendorff, Johanna. Kindheit und Wohlfahrtsstaat. Entstehung, Wandel und Kontinuität des Musters moderner Kindheit. Weinheim/ München 2010, S. 15f.).
[62] Vgl. Honig, Michael-Sebastian/ Leu, Hans-Rudolf/ Nissen, Ursula. Kindheit als Sozialisationsphase und als kulturelles Muster. Zur Strukturierung eines Forschungsfeldes (S. 9-29), in: Honig, Michael-Sebastian/ Leu, Hans-Rudolf/ Nissen, Ursula (Hrsg.). Kinder und Kindheit. Soziokulturelle Muster – sozialisationstheoretische Perspektiven. Weinheim/ München 1996, S. 9.
[63] Vgl. Angele, Claudia. Kompetenzen zur Alltagsbewältigung im privaten Haushalt. Ein Desiderat lebensnaher Allgemeinbildung. Münster 2008, S. 35f.
[64] Aber z. B. auch die historischen Wurzeln der Beschäftigung mit Traumata (Kapitel 3.2) oder der Traumapädagogik (Kapitel 4.2), sowie die politischen und gesellschaftlichen sowie institutionellen Gegebenheiten, die fortan nötig sind (Kapitel 4.6).
[65] Vgl. Schultheis, Franz/ Perrig-Chiello, Pasqualina/ Egger, Stephan (Hrsg.). Kindheit und Jugend in der Schweiz. Weinheim/ Basel 2008, S. 20.
[66] Vgl. Lohaus, Arnold/ Vierhaus, Marc/ Maass, Asja. Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor. Berlin/ Heidelberg 2010, S. 20.
[67] Wobei hier anzumerken ist, dass durch die immer stärker werdende wechselseitige Durchdringung von Entwicklungspsychologie und anderen psychologischen Disziplinen (Allgemeine Psychologie mit ihren Teilgebieten Wahrnehmungs-, Kognitions-, Lern- und Motivationspsychologie, Differentielle Psychologie, Pädagogische Psychologie) sowie Disziplinen außerhalb der Psychologie (Genetik, Physiologie, Ethologie oder Soziologie) es immer schwieriger ist, die Entwicklungspsychologie von anderen Forschungsgebieten eindeutig abzugrenzen (vgl. Trautner, Hanns Martin. Lehrbuch der Entwicklungspsychologie. Band 1: Grundlagen und Methoden. Göttingen 1992, S. 15).
[68] „Durch Erstellen von Entwicklungsnormen soll Auskunft über den normalen Entwicklungsverlauf gegeben werden und anhand genauer Beobachtungen sollen die Auswirkungen verschiedener Entwicklungsbedingungen studiert werden. Dadurch soll es möglich werden, ihre Wirkung künftig vorherzusagen. Somit ist Entwicklungspsychologie aber nicht nur eine Grundlagenwissenschaft, sondern bekommt auch eine handfeste praktische Anwendungsrelevanz, denn durch den Vergleich mit der typischen Entwicklung können atypische Verläufe erkannt und diagnostiziert werden und auf der Basis des Wissens über die zu erwartenden Auswirkungen können konkrete Interventionen geplant, durchgeführt und evaluiert werden“ (Rossmann 1996, S. 11).
[69] Diese sind Krankheitszeichen und „sind als gleich oder ähnlich erkennbare Erlebens- und Verhaltensweisen, die sich herausheben aus dem alltäglichen Gewöhnlichen der Menschen eines bestimmten Kulturkreises“ zu bezeichnen (Scharfetter, Christian. Allgemeine Psychopathologie: Eine Einführung. Stuttgart 2002, S. 23).
[70] Vgl. Schüssler, Gerhard. Psychologische Grundlagen psychiatrischer Krankheiten (S. 178-207), in: Möller, Hans-Jürgen/ Laux, Gerd/ Kapfhammer, Hans-Peter (Hrsg.). Psychiatrie und Psychotherapie. Berlin 2005, S. 191.
[71] Vgl. hierzu Steinhausen 2010, S. 4; Zinnecker, Jürgen/ Silbereisen, Rainer K. Kindheit in Deutschland: Aktueller Survey über Kinder und ihre Eltern. Weinheim/ München 1998, S. 147; Heller, Angela. Nach der Geburt: Wochenbett und Rückbildung. Stuttgart 2002, S. 170; Flehmig, Inge. Normale Entwicklung des Säuglings und ihre Abweichungen: Früherkennung und Frühbehandlung. Stuttgart 2007, S. 40.
[72] Vgl. Joswig, Helga. Phasen und Stufen in der kindlichen Entwicklung (14.02.2003/ geändert am 23.05.2011). URL: https://www.familienhandbuch.de/kindliche-entwicklung/allgemeine-entwicklung/ phasen-und-stufen-in-der-kindlichen-entwicklung (Stand: 10.06.2013).
[73] Vgl. Rossmann 1996, S. 11.
[74] „Die Erbanlage verteilt die Karten, die Umwelt spielt das Blatt aus“ (Charles L. Brewer 1990, in: Myers, Davig G. Psychologie. Heidelberg 2008, S. 120) - Bei der Frage, was die Entwicklung antreibt, kommt die seit langem geführte Anlage-Umwelt-Debatte zum Vorschein: Im Mittelpunkt hiervon steht die Frage, ob das Verhalten und die Fähigkeit eines jeden Menschen eher auf angeborene Anlagen oder hingegen auf Umwelteinflüsse (Erziehung, sozialer Hintergrund oder Bildung) beruhen. Erforscht durch verschiedene Zwillings- und Adoptionsstudien, kam man zu den Erkenntnissen, dass Anlangen bestimmte Fähigkeiten nur hervorbringen können, wenn diese entwickelt und gefördert werden, sodass man in jüngerer Zeit von der polarisierenden Fragestellung Anlage oder Umwelt immer mehr abgeht. Vielmehr werden heutzutage, aufgrund der Erkenntnis, dass ungünstige Umwelteinflüsse verhindern können, dass sich bestimmte Anlagen entfalten, v. a. D. die Wechselwirkungen zwischen Anlage und Umwelt untersucht (vgl. Schrader, Sabine. Psychologie. Allgemeine Psychologie, Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie. München 2008, S. 19).
[75] „In der Kindheitsforschung wird sehr häufig der Beginn der Kindheit zeitlich mit der Geburt des Kindes festgelegt. Allerdings ist es auch durchaus denkbar, „die vorgeburtliche Entwicklung mitunter ein Verständnis von Kindheit zu fassen, da die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes mit Sicherheit nicht erst mit dem Zeitpunkt der Geburt beginnt“ (Bründel/ Hurrelmann 1996, S. 25).
[76] Wie wissenschaftliche Untersuchungen zu dieser Thematik ergeben haben, muss von einer breiten Streuung beobachtbarer psychischer Besonderheiten, sogenannten inter- und intraindividuellen Unterschieden, ausgegangen werden. Bei der Berücksichtigung solcher Erkenntnisse lassen sich dennoch Phasen bzw. Stufen in der Entwicklung festmachen, die es ermöglichen, Charakteristisches (Typisches) in der Persönlichkeitsentwicklung hervorzuheben (vgl. Joswig 2003).
[77] „Die dadurch phasenweise ansteigenden äußeren und inneren Anforderungen an das Individuum, einhergehend mit einer Destabilisierung der bis dahin erreichten Position und verstärkter Unsicherheit, erfüllen die Kriterien eines krisenhaften Zustandes. Diese sich im Laufe des Lebens wiederholenden Kriterien sind Teil des normalen Entwicklungsprozesses“ [Benz, Marisa/ Scholtes, Kerstin. Von der normalen Entwicklungskrise zur Regulationsstörung (S. 159-170), in: Cierpka, Manfred (Hrsg.). Frühe Kindheit 0-3 Jahre. Berlin/ Heidelberg 2012, S. 160].
[78] So lässt sich z. B. eine übersichtliche Tabelle der Entwicklungsschritte einzelner Abschnitte formulieren. Vgl. hierzu Abb. 2) Die wichtigsten Phasen der menschlichen Entwicklung über die gesamte Lebensspanne im Anhang, S. 252.
[79] Vgl. Berk, Laura E. Entwicklungspsychologie. München 2011, S. 8.
[80] Vgl. Hinz, Arnold/ Wagner, Rudi F. Entwicklung (S. 57-90), in: Wagner, Rudi F./ Hinz, Arnold/ Rausch, Adly/ Becker, Brigitte (Hrsg.). Modul Pädagogische Psychologie. Bad Heilbrunn 2009, S. 60.
[81] Generell kann man zwar sagen, dass in der Kindheit die Gewinne dominieren und im höheren Lebensalter die Verluste, jedoch gibt es auch in der Kindheit Verluste (so verliert das Kind beim Übergang zum Sprechen z. B. die Fähigkeit, gleichzeitig atmen und trinken zu können) und im höheren Lebensalter Gewinne (vgl. Hinz/ Wagner 2009, S. 59).
[82] Vgl. ebd., S. 59f.
[83] Der Gegenstand der Entwicklungspsychologie ist die ontogenetische Entwicklung, welche nach Funktionsbereichen (z. B. motorische Entwicklung, Sprachentwicklung, moralische Entwicklung, Identitätsentwicklung) oder nach Lebensphasen (Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter und Alter) beschrieben werden kann. Bei der Einteilung und Betrachtung von Lebensphasen ist jedoch nicht das Verstreichen von Zeit, sondern die komplexe Wechselbeziehung zwischen individuellen biologischen, psychischen Veränderungen und Umweltanforderungen als ursächlich für die auffälligen körperlichen, motorischen, kognitiven und sozial-emotionalen Veränderungen von Kindern anzusehen. Trotz der bereits benannten großen interindividuellen Differenzen sind Übereinstimmungen in Entwicklungssequenzen innerhalb verschiedener psychischer Funktionsbereiche im Kindes- und Jugendalter nicht zu übersehen [vgl. Pöhlmann, K. Entwicklungspsychologie aus psychologischer Sicht (S. 71-75), in: Janssen, Paul L./ Joraschky, Peter/ Tress, Wolfgang (Hrsg.). Leitfaden Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Köln 2009, S. 71ff.].
[84] Die frühe Kindheit lässt sich des Weiteren noch unterteilen in die vorgeburtliche Entwicklung, das Säuglingsalter und das Kleinkindalter.
[85] Die oben aufgeführten möglichen Unterteilungen in diverse Abschnitte, ließe sich ohne Weiteres um mehrere Möglichkeiten erweitern (vgl. hierzu z. B. Raithel, Jürgen/ Dollinger, Bernd/ Hörmann, Georg. Einführung Pädagogik: Begriffe, Strömungen, Klassiker, Fachrichtungen. Wiesbaden 2007, S. 46f.). Vgl. hierzu Abb. 3) Kindheit und Jugend – Alters- und Phaseneinteilung im Anhang, S. 253.
[86] „Entsprechend schwer ist es, den Beginn und das Ende des frühen Erwachsenenalters zu bestimmen (etwa vom 21. Bis zum 29. Lebensjahr). Eine Altersangabe zur Trennung zwischen dem mittleren und dem höheren Erwachsenenalter ist ebenfalls kaum möglich, weil sie abhängig ist von veränderlichen Faktoren wie Lebenserwartung, Renten- bzw. Pensionierungsalter, Gesundheit etc.“ (Hinz/ Wagner 2009, S. 60f.).
[87] Vgl. z. B. ebd., S. 57ff.; Poser, Märle. Identitätsentwicklung, Reifungsprozesse und Lebenszyklus (S. 271-292), in: Schneider, Kordula/ Brinker-Meyendriesch, Elfriede/ Schneider, Alfred (Hrsg.). Pflegepädagogik. Springer. Heidelberg 2005, S. 277; Bründel, Heidrun/ Hurrelmann, Klaus. Einführung in die Kindheitsforschung. Weinheim/ Basel 1996, S. 28.
[88] Vgl. z. B. Schneider/ Lindenberger 2012.
[89] So z. B. Theorien bzw. Modelle nach Sigmund Freud, Erik Erikson, Jean Piaget oder Lawrence Kohlberg (vgl. hierzu ausführlicher Thomas, R. Murray/ Feldmann, Birgitt. Die Entwicklung des Kindes. Ein Lehr- und Praxisbuch. Weinheim/ Basel 2002).
[90] „Kleine Kinder verfügen bereits über manche Fähigkeiten, die Piaget erst für spätere Stadien postulierte. Kohlbergs Stufenmodell hatte anscheinend den gebildeten Mann im Blick, der einer individualistischen Kultur angehört, und legte deshalb den Akzent zu sehr auf das Denken, während das Handeln eine geringere Rolle spielt. Das Leben des erwachsenen Menschen verläuft nicht in festen, vorhersagbaren Schritten, wie es sich Erikson vorgestellt hatte“ (Myers 2008, S. 210).
[91] Otto, Johannes. Volksmund ausgewählter Länder der Erde. Norderstedt 2010, S. 114.
[92] Vgl. Hinz/ Wagner 2009, S. 60.
[93] „Dieser Satz beschreibt die enorme, prägende Verantwortung der engsten Bezugspersonen im frühen Kindesalter. Bereits der Moment der Befruchtung unterliegt ganz unterschiedlichen Bedingungen. Handelt es sich um ein Wunschkind, einen ‚Zufall‘ oder gar um die Folge sexueller Gewalt?“ [Wettig, Jürgen. Eltern-Kind-Bindung: Kindheit bestimmt das Leben, in: Deutsches Ärzteblatt 2006: 103(36), A 2298/ B1992/C1922, URL: http://www.aerzteblatt.de/archiv/52567/Eltern-Kind-Bindung-Kindheit-bestimmt-das-Leben (Stand: 10.06.2013)]. Mit der Empfängnis sind Vater und Mutter bestimmt mit ihren biologischen und sozialen Bedingungen. Diese Konstellation ist bereits von diesem Zeitpunkt an entwicklungsfördernd oder aber entwicklungshemmend für das zukünftige Leben des Kindes (vgl. Joswig 2003).
[94] Vgl. ebd.
[95] Vgl. Petermann, Franz/ Nieband, Kay/ Scheithauer, Herbert. Entwicklungswissenschaft. Berlin/ Heidelberg 2004, S. 77.
[96] Vgl. Becker, Heidrun. Pränatale Entwicklung und erstes Lebensjahr (S. 10-18), in: Becker, Heidrun/ Steding-Albrecht, Ute. Ergotherapie im Arbeitsfeld Pädiatrie. Stuttgart 2006, S. 10.
[97] Stand: 2007 [vgl. Reh-Bergen, Thorgund. Entwicklungspsychologie – die gesunde Entwicklung eines Menschen (S. 2-43), in: Bund Deutscher Hebammen (Hrsg.). Psychologie und Psychopathologie für Hebammen. Die Betreuung von Frauen mit psychischen Problemen. Stuttgart 2007, S. 3].
[98] Vgl. ebd.
[99] Vgl. hierzu Schneider/ Lindenberger 2012, S. 16.
[100] Vgl. Becker 2006, S. 10.
[101] Vgl. Wettig, Jürgen. Schicksal Kindheit. Heidelberg 2009, S. 10.
[102] Zahlreiche Literaturangaben sprechen nur von zwei Stadien, die wesentlich zeitlich großzügiger angesetzt sind: So z. B. Simone Rothgangel, die davon spricht, dass der menschliche Keim in den ersten acht bis zwölf Wochen als Embryo bezeichnet wird und am dem dritten Monat als Fötus bzw. Fetus (Rothgangel, Simone. Kurzlehrbuch Medizinische Psychologie und Soziologie. Stuttgart 2010, S. 109).
[103] Vgl. ebd. Vgl. hierzu Abb. 4) Drei Stadien der pränatalen Entwicklung mit verschiedenen Bezeichnungen für den menschlichen Keim im Anhang, S. 253.
[104] „Schädigende Einflüsse verschiedenster Art können die pränatale Entwicklung stören. Je nach Art, Zeitpunkt und Intensität der Schädigung reicht die Spannbreite von kaum merklichen funktionellen Abnormitäten bis hin zum Fruchttod“ (Menche, Nicole. Pflege heute. München 2011, S. 126).
[105] Vgl. ebd., S. 125.
[106] Sie erhielten die Hälfte der 46 Chromosomen, die sich in allen normalen menschlichen Körperzellen finden, von ihrer Mutter und die andere Hälfte von ihrem Vater (vgl. Zimbardo, Philip G./ Gerrig, Richard J. Psychologie. München 2008, S. 443).
[107] Vgl. Romahn, Mechthild. Physiologische Entwicklung der Schwangerschaft (S. 83-112), in: Mändle, Christine/ Opitz-Kreuter, Sonja/ Wehling, Andrea (Hrsg.). Das Hebammenbuch. Lehrbuch der praktischen Geburtshilfe. Stuttgart 2007, S. 83.
[108] Vgl. Gassen, Hans-Günther/ Minol, Sabine. Die Menschen Macher. Weinheim 2006, S. 260.
[109] Vgl. Schneider/ Lindenberger 2012, S. 160.
[110] Vgl. Zimbardo/ Gerrig 2008, S. 443.
[111] Vgl. Fritsch, Gerlinde Ruth. Der Gefühls- und Bedürfnisnavigator. Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen. Paderborn 2010, S. 11.
[112] Vgl. ebd.
[113] Aufrecht gehen zu lernen, lesen, schreiben, rechnen; Fähigkeit, ein Selbstbild und Selbstwirksamkeitskonzepte zu entwickeln, psychosoziale Kompetenzen auszubilden, Handlungen planen und die Folgen des eigenen Handelns abschätzen zu lernen, sich selbst zu motivieren und die aus älteren Bereichen des Gehirns aufsteigenden Impulse und Triebe kontrollieren zu lernen (vgl. Hüther, Gerald/ Krens, Inge. Das Geheimnis der ersten neun Monate. Unsere frühesten Prägungen. Weinheim/ Basel 2008, S. 75).
[114] „Die drei Gehirnteile entstehen in der Gehirnentwicklung im Allgemeinen nacheinander, so dass von einer Entwicklung von unten nach oben gesprochen werden kann. Bis zur Geburt sind Gehirnstamm und Rückenmark nahezu vollständig entwickelt. Nach der Geburt beginnt die Myelinisierung der mittleren Gehirnregionen; die Myelinisierung des Kortex ist am langsamsten und unregelmäßigsten und dauert bis lange nach der Geburt und der ersten Lebensjahre an“ [Verdult, Rien. Die Neuverdrahtung des Gehirns. Zerebrale Entwicklung, pränatale Bindung und ihre Konsequenzen für die Psychotherapie (S. 47-80), in: Schindler, Peter (Hrsg.). Am Anfang des Lebens. Neue körperpsychotherapeutische Erkenntnisse über unsere frühesten Prägungen durch Schwangerschaft und Geburt. Band 7: Körper und Seele. Basel 2011, S. 70f.; vgl. Fritsch 2010, S. 11]. Vgl. hierzu Abb. 5) Dreiteiliges Gehirn im Anhang, S. 253.
[115] Vgl. Reh-Bergen 2007, S. 3.
[116] Vgl. Eggers, Christian. Die somatische Entwicklung und ihre Varianten (S. 3-26), in: Fegert, Jörg M./ Eggers, Christian/ Resch, Franz (Hrsg.). Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters. Berlin/ Heidelberg 2004, S. 5.
[117] Vgl. Becker 2006, S. 10.
[118] Vgl. Schneider/ Lindenberger 2012, S. 161.
[119] In der zehnten Woche berührt das Kind dann z. B. das Gesicht mit der Hand, ab der zwölften Woche ist es dann zum Saugen und Schlucken fähig. Auch Räkeln, Strecken, Schaukeln, sich Abstoßen und Greifen sind weitere Aktivitäten eines Fetus. Dieses „Training“ dient verschiedenen Aspekten: -Kräftigung der Muskulatur, -Feinabstimmung der Regelkreise, die die Motorik steuern, -Vorbereitung auf Atmung und Verdauung (Becker 2006, S. 10).
[120] Vgl. ebd., S. 11.
[121] Vgl. ebd.
[122] „Zwei Wachstumsschübe charakterisieren das Gehirnwachstum: Der erste findet zwischen dem dritten und fünften Gestationsmonat statt. In dieser Zeit vermehren sich die Nervenzellen rapide, zugleich ist das Risiko für eine Schädigung des Gehirns besonders hoch. Der zweite Wachstumsschub beginnt wenige Wochen vor der Geburt und hat seinen Höhepunkt im dritten bis vierten Monat nach der Geburt. In dieser Zeit findet die Ausdifferenzierung der Nervenzellen statt; es bilden sich Dendriten und Synapsen. Das höchste Ausmaß der Myelinisierung wird erst im dritten Lebensjahr erreicht“ (Rothgangel 2010, S. 110).
[123] Vgl. Schneider/ Lindenberger 2012, S. 161.
[124] Obwohl der Fetus bereits vorher sehr „kompetent“ wirkte, war er bis zur 22. SSW jedoch noch nicht alleine überlebensfähig, da u. a. die Lungen und das Verdauungssystem noch nicht ausreichend entwickelt sind; auch kann das Gehirn hier noch nicht die Atemfunktion steuern oder die Körpertemperatur regulieren (vgl. ebd.).
[125] Vgl. Rothgangel 2010, S. 110.
[126] Vgl. Schneider/ Lindenberger 2012, S. 161.
[127] Daher ist verständlich, dass das ungeborene Kind viele Geräusche erreichen kann, wie z. B. den Herzschlag, das Pulsieren der großen Blutgefäße, Darmgeräusche und die Sprache der Mutter (vgl. Reh-Bergen 2007, S. 5).
[128] „Propriozeption ist die Wahrnehmung der Lage und Stellung der Körperteile sowie der Bewegung des Organismus“ (Behrends, Jan C. u. a. Physiologie. Stuttgart 2010, S. 594).
[129] Vgl. Becker 2006, S. 11.
[130] Vgl. Reh-Bergen 2007, S. 5. Vgl. Abb. 6) Wichtige Schritte der vorgeburtlichen Entwicklung im Anhang, S. 254.
[131] Vgl. Thanner, Moritz. Kinderheilkunde für Heilpraktiker und Heilberufe. Lehr-, Lern- und Praxisbuch. Stuttgart 2004, S. 31.
[132] Vgl. Menche 2011, S. 125.
[133] Vgl. Becker 2006, S. 12.
[134] Implizite Erinnerungen machen es möglich zu wissen, wie etwas gemacht wird; zwar benötigt es etwas Übung, bis dieses Wissen abgespeichert ist, doch dann sind die Erfahrungen relativ stabil (so dass z. B. das Fahrradfahren nicht wieder verlernt wird) (vgl. ebd.).
[135] Vgl. ebd.
[136] Mennella Julie. A./ Jagnow, Coren P./ Beauchamp, Gary. K. Prenatal and postnatal flavor learning by human infants. Pediatrics, 107(6): E88. 2001.
[137] Vgl. Schneider/ Lindenberger 2012, S. 164.
[138] Vgl. Drude, Carsten (Hrsg.). Geistes- und Sozialwissenschaften. München 2008, S. 24.
[139] „Föten mit Störungen wie Downsyndrom, Sauerstoffmangel, Nikotinkonsum der Mutter entwickeln kein normales Gewöhnungsmuster. Ihnen fehlt also die wichtige Möglichkeit, anhaltende, bedeutungslose Reize zu unterdrücken“ (ebd.).
[140] Vgl. ebd.
[141] Bei der immensen Komplexität des ZNS bedeutet dies nicht, dass Fähigkeiten unwiederbringlich verloren gehen, wenn bestimmte Erfahrungen ausbleiben. Doch es heißt, dass durch das Zusammenwirken von Reifung und Erfahrung diejenigen Bereiche des ZNS gestärkt werden, die für die Lebenswelt des Individuums wichtig sind (vgl. Schneider/ Lindenberger 2012, S. 164).
[142] Vgl. Reh-Bergen 2007, S. 3.
[143] Die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung des Kindes hängt neben dem Ausmaß der Einwirkung auch von dem Zeitpunkt des Auftretens des Risikofaktors innerhalb der pränatalen Entwicklung ab. Speziell innerhalb der ausgeprägten Wachstumsphasen sind das zentrale Nervensystem und die Sinnesorgane besonders gefährdet. Solche Einflüsse wirken sich während der ersten drei Schwangerschaftsmonate vor allem schädigend auf die Organentwicklung des Kindes aus. Im Fötalstadium beeinträchtigen solche schädigenden Einflüsse insbesondere die Sauerstoff- und Nahrungsversorgung, die Gehirnentwicklung sowie die Aktivität des Fetus (vgl. Joswig 2003). Auch ist eine potentielle Schädigung u. a. abhängig von der Art des Einflusses und von der Dosis während der Schwangerschaft. Daher ist es relativ schwierig vorhersagbar, ob potentiell schädigende Umwelteinflüsse die pränatale Entwicklung tatsächlich beeinflussen werden und, wenn ja, welche Bereiche wie stark geschädigt sein werden (vgl. Schneider/ Lindenberger 2012, S. 161).
[144] Direkte Auswirkungen von Teratogenen beziehen sich auf Fehlentwicklungen von Körperstrukturen und/ oder Organen. Indirekte Auswirkungen von Teratogenen zeigen sich erst zu späteren Zeitpunkten im Verhalten und Erleben des Kindes, z. B. in Aufmerksamkeits-, Lern- oder Verhaltensproblemen. Man geht davon aus, dass Teratogene Mikrodefekte im zentralen Nervensystem verursachen können, z. B. eine verminderte Anzahl neuronaler Verbindungen oder Störungen der chemischen Informationsübertragung zwischen den Neuronen, welche sich wiederum auf das spätere Verhalten auswirken. Da aber auch andere Faktoren zu Problemverhalten des Kindes führen können (z. B. familiäre Probleme), ist die Kausalität von indirekten teratogenen Wirkungen schwierig nachzuweisen (vgl. ebd., S. 161f.).
[145] Vgl. Rothgangel 2010, S. 110. Für eine noch ausführlichere Übersicht über Teratogene vgl. Deutsch, Johann/ Schnekenburger, Franz G. Kinderchirurgie für Pflegeberufe. Stuttgart 2009 , S. 127f. Vgl. Abb. 7) Empfindliche Phasen der Schwangerschaft im Anhang, S. 254.
[146] Vgl. Menche 2011, S. 126.
[147] Vgl. Trautmann-Voigt, Sabine/ Voigt, Bernd. Grammatik der Körpersprache. Ein integratives Lehr- und Arbeitsbuch zum Embodiment. Stuttgart 2012, S. 57.
[148] Vgl. Hidas, György/ Raffai, Jenö. Nabelschnur der Seele. Psychoanalytisch orientierte Förderung der vorgeburtlichen Bindung zwischen Mutter und Baby. Gießen 2006, S. 17.
[149] Vgl. ebd., S. 49ff.
[150] Vgl. Munz, Dorothee. Die pränatale Mutter-Kind-Beziehung (S. 162-172), in: Strauß, Bernhard/ Buchheim, Anna/ Kächele, Horst (Hrsg.). Klinische Bindungsforschung. Stuttgart 2002, S. 162.
[151] Vgl. Trautmann-Voigt/ Voigt 2012, S. 56f.
Details
- Titel
- Traumata in Kindheit und Jugend: Entwicklungs- und traumapsychologisches Wissen als Grundlage der Traumapädagogik in den Erziehungshilfen
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 272
- Katalognummer
- V270309
- ISBN (eBook)
- 9783842889316
- Dateigröße
- 6217 KB
- Sprache
- Deutsch
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2013, Traumata in Kindheit und Jugend: Entwicklungs- und traumapsychologisches Wissen als Grundlage der Traumapädagogik in den Erziehungshilfen, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/270309

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.




