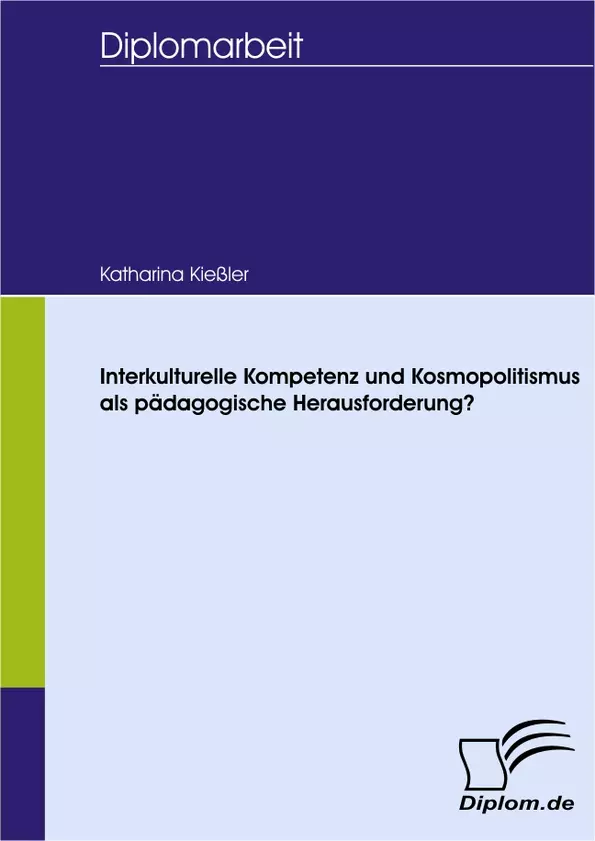Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos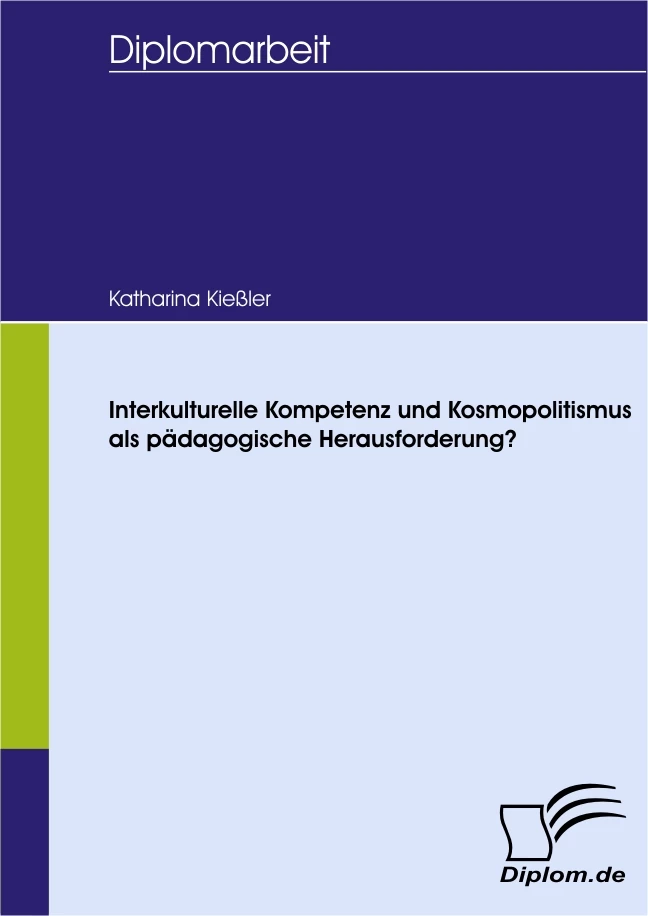
Interkulturelle Kompetenz und Kosmopolitismus als pädagogische Herausforderung?
Diplomarbeit, 2009, 101 Seiten
Autor

Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Note
1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel 1 Bausteine interkultureller Kompetenz. Begriffsklärung und theoretische Grundlagen
1.1 Der Kompetenzbegriff
1.2 Kultur – ein umstrittener Begriff
1.3 Multikulturalität – Transkulturalität – Interkulturalität
KAPITEL 2 Interkulturelle Kompetenz – Ein komplexes Konzept
2.1 Definitionsmodelle Interkultureller Kompetenz
2.1.1 Listen- und Strukturmodelle
2.1.1.1Kognitive Dimension
2.1.1.2 Affektive Dimension
2.1.1.2.1 Exkurs. Milton Bennetts Entwicklungsmodell interkultureller Sensibilität
2.1.1.3 Verhaltensbezogene bzw. pragmatische Dimension
2.1.2 Kritische Beurteilung
2.1.3 Prozessmodelle Interkultureller Kompetenz
2.1.3.1 Wissen
2.1.3.2 Verstehen
2.1.3.3 Handeln
kapitel 3 Zwischenfazit I
KAPITEL 4 ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER KOSMOPOLITEN IDEE
4.1 Antike Wurzeln
4.1.1 Die Kyniker
4.1.2 Griechische Stoa
4.1.3 Römische Stoa
4.2 Frühe Neuzeit und Aufklärung
4.2.1 Christoph Martin Wieland
4.2.2 Immanuel Kant
4.3. Kosmopolitismus der Gegenwart
4.3.1 Kwame Anthony Appiah
4.3.2 Ulrich Beck. Reflexive Modernisierung und Kosmopolitismus versus Kosmopolisierung
4.3.2.1 Exkurs: Reflexive Modernisierung
4.3.2.2 Kosmopolitismus vs. Kosmopolisierung
Kapitel 5 Zwischenfazit II. Konstituierende Gedanken des Kosmopolitismus
kapitel 6 Kosmopolitismus als Bildungskonzept
6.1 Antike und neuzeitliche Bildungskonzepte
6.1.1 Kosmopolitische Bildung in der Antike
6.1.2 Grundlegende Ideen des neuzeitlich kosmopolitischen Bildungsprogramms
6.2 Konzeptualisierungsvorschlag eines gegenwärtigen Bildungskonzeptes in kosmopolitischer Absicht
6.2.1 Bildungsziel und Bildungsverständnis
6.2.2 Analyse
6.2.3 Eckpfeiler eines aktuellen Bildungskonzeptes in kosmopolitischer Absicht
6.2.3.1 Klaus Seitz und das Konzept des Globalen Lernens
6.2.3.2 Edgar Morin. Die Ethik des Verstehens
6.2.3.3 Christoph Wulf. Der Andere und die Notwendigkeit anthropologischer Reflexion
6.2.3.4 Thomas Mohrs. Entwicklung eines weltbürgerlichen Bewusstseins
6.3 Zusammenfassung
Fazit
Literaturverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
Einleitung
Wir leben in einer globalisierten Welt. Die Menschheit hat die Schwelle zu einem globalen Zeitalter, auch wenn es manche nach wie vor nicht wahrhaben wollen, überschritten. Zwar wird der Mensch von Seiten der Soziobiologie[1] oder der biologischen Evolutionsforschung als ein Nahbereichswesen charakterisiert, doch widerspricht diese Annahme in jeglicher Hinsicht der soziologischen Diagnose, dass wir längst zu einer Weltgesellschaft geworden sind und unser Leben in dieser gestalten müssen. Das Ausmaß, in dem unsere Lebenswelt in globale Bezüge eingebunden ist, ist unübersehbar: Grenzüberschreitender Austausch und grenzüberschreitende Produktion nicht nur von Waren, Dienstleistungen und Kapital, sondern auch – weniger erfreulich – von ökologischen Risiken, Terrorgefahren, Wirtschaftskrisen etc. Grenzüberschreitende Mobilität von Personen, die wiederum einen grenzüberschreitenden Austausch von Informationen und kulturellen Gütern begünstigt. Einhergehend mit der Globalisierung bzw. Denationalisierung sozialer Handlungszusammenhänge verändern sich auch die Reichweite und die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen, verschiebt sich das Koordinationssystem moralischer Maßstäbe.
„Die Menschen der Gegenwart leben in unterschiedlichen historischen Zeiten und Kulturen, in sich aneinander stoßenden Ungleichheiten. Sie nehmen an globalen Prozessen Teil, in denen sich Angleichung und Differenzierung, Differenzierung und Entdifferenzierung, Anpassung und Widerstand gleichzeitig vollziehen und in denen die Angleichung der Lebenschancen unter Beibehaltung der kulturellen Vielfalt die Aufgabe ist“ (Merkel/Wulf 2002:11)
Mit der Globalisierung werden Pluralisierungsprozesse ausgelöst, die eine ethische und kulturell-religiöse Heterogenisierung der Gesellschaften unweigerlich zunehmen lassen und deshalb ist es absehbar, dass der konstruktive Umgang mit kultureller Vielfalt und vor allem mit kultureller Andersheit in den kommenden Jahren nicht nur zu den Schlüsselqualifikationen von Managern in weltweit agierenden Unternehmen gehört, sondern sich auch zu einem allgemeinen Bildungsziel bzw. Bestandteil einer jeden Persönlichkeit und zum Erfolgsfaktor für ein produktives Erleben kultureller Vielfalt herausbilden wird. Angesichts der Globalisierung wichtiger Lebensbereiche und einer weltweiten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Integration bedarf es einer verstärkten Akzeptanz von Differenzen und einer Förderung von Gemeinsamkeiten. Dabei sind Spannungen zwischen dem Lokalem, dem Regionalem und dem Globalen unvermeidbar.
Die Lebensbedingungen von Bürgerinnen und Bürgern in einem globalen Zeitalter verlangen nach spezifischen Kompetenzen. Lee Anderson hat diese bereits 1979 in vier große Bereiche kategorisiert, die sich verkürzt in den Stichwörtern „Teilhabe und Teilnahme an der globalen Gesellschaft“, „Entscheiden“, „Urteilen“ und „Einfluss ausüben“ darstellen lassen (Vgl. Anderson 1979: 335ff.). Diese müssen meiner Meinung nach durch eine weitere wichtige soziale Kompetenz erweitert werden, nämlich den Umgang mit Menschen fremder Kulturen. Die Öffnung des menschlichen Wahrnehmungs-, Denk-, Urteils- und Handlungsfeldes zum Horizont einer globalen Gesellschaft ebenso wie die Befähigung mit Widersprüchen umgehen zu können, gelten daher als die zentrale pädagogische Aufgabe der Gegenwart.
Interkulturelle Kompetenz und Kosmopolitismus bzw. die Idee des Weltbürgertums gehören zu den geläufigen Begriffen, die immer wieder im Zusammenhang zu den genannten Phänomenen genannt werden und die es den Menschen ermöglichen sollen, nicht nur die Zusammenhänge zwischen lokaler, regionaler und globaler Ebene zu erkennen, sondern auch eine Handlungskompetenz für das multikulturelle Zusammenleben, internationale Kooperation und das globale Zeitalter zu entwickeln.
In der vorliegenden Arbeit sollen vor allem Antworten auf die Frage gesucht werden, was unter interkultureller Kompetenz und Kosmopolitismus grundsätzlich zu verstehen ist und inwiefern sie eine Herausforderung für die Pädagogik darstellen.
Um sich dem Inhalt des Begriffs „interkulturelle Kompetenz“ anzunähren und ihm eine theoretische Basis zu schaffen, werden im ersten Kapitel grundlegende Begrifflichkeiten geklärt, die dafür notwendig sind, die Reichweite des Verständnisses einzugrenzen. Im zweiten Kapitel wird das Konzept interkultureller Kompetenz genauer beleuchtet. Es werden verschiedene Definitionsmodelle vorgestellt, die abschließend einer kritischen Analyse unterzogen sowie auf ihre Anwendbarkeit geprüft werden.
Dass die Idee einer kosmopolitischen Bildung keine Innovation ist, die aus den gesellschaftlichen Umbrüchen aufgrund der Globalisierung entsprungen ist, sondern bereits in der vorchristlichen Antike ihre Wurzeln hat, wird im vierten Kapitel verdeutlicht. Als erstes wird ein Überblick über die Entstehungsgeschichte der kosmopoliten Idee gegeben, in dem die wichtigsten Vertreter und ihre Gedanken skizziert werden. Im anschließenden Kapitel werden auf der Basis der historischen Erkenntnisse die Bildungskonzepte herausgearbeitet. Das sechste Kapitel befasst sich damit, ein Bildungskonzept in kosmopolitischer Absicht aufzustellen. Dafür werden in einem ersten Schritt das Bildungsziel und das Verständnis von Bildung definiert. In einem zweiten Schritt werden die antiken und neuzeitlichen Konzepte untersucht und überprüft, welche Aspekte heutzutage nach wie vor von Bedeutung sind. Als drittes werden Aspekte von Theorien verschiedener Autoren vorgestellt, die die Eckpfeiler eines aktuellen Bildungskonzeptes darstellen. Abgeschlossen wird mit einer kurzen Skizze davon, wie ein solches Konzept aussehen könnte.
Kapitel 1 Bausteine interkultureller Kompetenz. Begriffsklärung und theoretische Grundlagen
1.1 Der Kompetenzbegriff
Im Alltag lässt sich Kompetenz auf zwei verschiedene Weisen interpretieren. So weist der Begriff einerseits eine Fähigkeit, andererseits Befugnisse im Sinne von Entscheidungskompetenzen auf. In der Bildungsforschung und auch in dieser Arbeit geht es jedoch ausschließlich um die erste Bedeutung. Vereinfacht dargestellt wird unter Kompetenz eine (kaum genauer zu erklärende) Kombination einzelner Fähigkeiten, Fertigkeiten, Vermögen und Eigenschaften verstanden, die ein Individuum dazu befähigen, etwas Bestimmtes zu tun. Es ist anzumerken, dass sich Kompetenz nicht mit dem Begriff der Erfahrung gleichsetzen lässt. Durch Erfahrungslernen können durchaus Kompetenzen erworben werden, doch ist erst von einem Kompetenzerwerb zu sprechen, wenn neue Ereignisse und Anforderungen in ein bereits vorhandenes Modell integriert werden können, also neues sinnvoll mit bereits vorhandenem Wissen verknüpft wird (Vgl. Bittner/Reisch 1994: 104ff.).
1959 führt Roger W. White den Kompetenzbegriff in die Motivationspsychologie ein und grenzt ihn definitorisch klar von anderen mentalen Fähigkeiten ab. Kompetenz bezeichnet die Ergebnisse der Entwicklung grundlegender Fähigkeiten, die nicht angeboren oder das Produkt von Reifeprozessen sind, oder auch nicht ausreichend durch die klassischen Triebtheorien der Psychoanalyse oder der psychologischen Lerntheorie erklärt werden können. Zum größten Teil bringt das Individuum die Ergebnisse dieser Entwicklungen selbstständig hervor. White nimmt ein Wirksamkeitsmotiv (effectance motive) an, das auf wirkungsvolle Interaktionen mit der Umwelt drängt und so die Entwicklung von Kompetenzen fördert. Das Individuum entwickelt also seine Kompetenzen weniger im Dienst der Bedürfnisbefriedigung oder Triebstillung, sondern um der Fähigkeiten und Interaktionen mit der Umwelt selbst willen (Vgl. Heckhausen 1976:922).
Der Zusammenhang zwischen Kompetenz und der erfolgreichen Bewältigung komplexer Anforderungen ist allerdings nicht von deterministischer, sondern von wahrscheinlichkeitstheoretischer Natur. Kompetenzen stellen notwendige, aber noch keine hinreichenden Voraussetzungen für ein erfolgreiches Handeln dar. Erst in einer konkreten Situation wird deutlich, wie kompetent der Handelnde wirklich ist, denn nur im Idealfall sind Kompetenzen mit dem konkreten Handeln identisch. Daher müssen in eine Kompetenzdefinition neben kognitiven auch motivationale und emotionale Aspekte eingeschlossen werden. Darüber hinaus dürfen Bereitschaften und Selbstkonzepte als wichtige Aspekte, die individuelles Handeln beeinflussen, nicht außer Acht gelassen werden. Angelehnt an Weinert soll für die aufbauenden Kapitel folgende Definition als Grundlage dienen: Kompetenzen sind „die bei Individuen verfügbaren oder bei ihnen erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2001 nach Maag Merki 2009:502) .
Die Eigenart des Kompetenzbegriffes, der wie viele sozial- und geisteswissenschaftliche Begriffe nicht im Konsens definierbar ist, lässt sich besonders gut in Gegenüberstellung zum Begriff Intelligenz, deren Gleichsetzung häufig fälschlicherweise vollzogen wird, aufzeigen. Trotz vieler Definitionsunterschiede ist allen Definitionen die Betonung der Bedeutung von Übung und Lernprozessen für die Kompetenzentwicklung gemeinsam. Kompetenz gilt daher als lern- und beeinflussbar und wird durch das Sammeln von Erfahrungen in bestimmten Bereichen und Situationen erworben. Intelligenz hingegen wird als relativ stabil und zu bedeutsamen Teilen durch biologische Faktoren eingeschränkt, beschrieben. Zeitliche Veränderungen in Leistungsmaßen werden im Kontext der Intelligenz-forschung eher als problematisch gesehen, da sie im Widerspruch zum Konzept der Intelligenz als stabiles Persönlichkeitsmerkmal stehen. Umgekehrt ist es im Kompetenzkonzept: Hier stellen Veränderbarkeit und das Potenzial für Interventionen gerade ein wesentliches Kriterium dar.
Ein weiterer Unterschied zeigt sich im Bezug auf den Grad der Kontextualisierung. Während Kompetenz als kontextualisierte Fähigkeit definiert wird, um in spezifischen Situationen spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, handelt es sich bei der Intelligenz um eine generalisierte Fähigkeit, d.h. um die Fähigkeit, ohne spezifisches Vorwissen neue Probleme zu lösen. Die Binnenstruktur ergibt sich daher bei der Kompetenz aus Situationen und Anforderungen, bei der Intelligenz aus kognitiven grundlegenden Prozessen (Vgl. Maag Merki 2009:492-506).
1.2 Kultur – ein umstrittener Begriff
Definitionsversuche des Kulturbegriffs sind so zahlreich und mehrdeutig, dass aus diesem Grund Erwartungen an eine verbindliche und richtige Bedeutungsregelung enttäuscht werden müssen. Den allgemeingültigen Kulturbegriff gibt es nicht. Es ist allerdings notwendig, sich damit auseinanderzusetzen, was unter Kultur verstanden wird. Dabei geht es weniger darum die Kulturdefinition aufzustellen, sondern vielmehr, wichtige Erkenntnisse, die bei den Definitionsbemühungen gewonnen worden und die für die Bestimmung interkultureller Kompetenz von Belang sind, festzuhalten und nicht zuletzt, um eine Basis für die vorliegende Arbeit zu schaffen.
Zuvor ist anzumerken, dass der Kulturbegriff trotz seiner Vieldeutigkeit, zwei Aspekte beinhaltet, die in sämtlichen Definitionen wiederzufinden sind. Erstens den symbolischen Charakter und zweitens die Orientierungsfunktion von Kultur. Dieser Funktionsbestimmung entspricht, dass Werte und Normen ebenso wie kulturelle Symbole allgemein als elementare Bestandteile von Kultur verstanden werden. Dabei sind diese nicht als starre Gebote oder festgelegte Rituale zu verstehen, sondern als Alltagsphänomene. Willis, ein Vertreter der Cultural Studies, spricht vom „kulturellen Moment“ an der Produktion und Reproduktion der Lebensverhältnisse, das die kollektive Aktivität der Bedeutungsgebung betrifft. Rituale des Miteinander-Kommunizierens, Wohn- und Kleidungsstile usw. gelten als Definitionsmerkmalen des Symbolischen und gleichzeitig des Kulturellen. Die kulturellen Symbole dienen der Verständigung, der Darstellung nach außen.
Kultur lässt sich daher als Repertoire an Kommunikations- und Repräsentationsmitteln definieren. Nicht zuletzt dienen symbolische Mittel wie Kleidung der Repräsentation des Selbst und so kommt neben der Orientierungsfunktion der Kultur auch eine Identitätsfunktion zu. Gleichzeitig liegt an dieser Stelle der Hinweis auf eine Distinktionsfunktion von Kultur nahe (Vgl. Auernheimer 2003:73ff.).
Zusammengefasst dient also Kultur der Deutung des gesellschaftlichen Lebens und damit der Orientierung des Handelns. Der Kulturanthropologe Geertz definiert sie als „ das Geflecht von Bedeutungen, in denen die Menschen ihre Erfahrung interpretieren und nach denen sie ihre Handeln ausrichten “ (Geertz 1983:99). Dieser erweiterte, lebensweltlich orientierte Kulturbegriff hat sich in der interkulturellen Forschung durchgesetzt. Denn: „Er ist nicht auf das vermeintlich ‚Besondere’ eingeschränkt, sondern umfasst alle Lebensäußerungen. Hierzu zählen Religion, Ethik, Recht, Technik, Bildungssysteme, materielle und immaterielle Produkte … Kultur wenn man sie als Lebenswelt versteht, zeichnet sich dadurch aus, dass sie zwar geschaffen und durch eine gewisse Organisiertheit ausgezeichnet ist. Allerdings geschieht dies in Wechselwirkung mit der natürlichen Umwelt, so wie umgekehrt die natürliche Umwelt durch die „Kultur“ im Sinne der ‚geschaffenen’ Lebenswelt beeinflusst ist“ (Bolten 2007a:13).
Der erweiterte, lebensweltliche Kulturbegriff grenzt nicht aus, sondern integriert, ihm liegt keine zeitlos-statische, sondern eine historisch-dynamische Bedeutung zu Grunde und er versucht sich Werturteilungen zu entziehen. Aus dieser Perspektive gilt dementsprechend: Eine Gesellschaft hat keine Kultur, sondern ist eine Kultur. Dabei bleibt anzumerken, dass diese Kulturen weder homogen noch klar voneinander abgrenzbar sind und einem dynamischen Wandel unterliegen (Vgl. ebd.:16).
Unter den Bedingungen der Globalisierung hat sich heute die gedachte Einheit von Raum, Gruppe und Kultur als Fiktion erwiesen. Globalisierte Finanz- und Warenmärkte, weltweite Medienstrukturen und Migrantenströme haben zu einer exponentiellen Zunahme kultureller Austauschprozesse geführt. Im Zuge dieser Kontakte verschwinden zahlreiche traditionelle Lebensformen. Lokale Kulturen verändern sich und gehen ungewohnte Kombinationen ein. Die Grenzen zwischen dem Eigenen und dem Fremden verwischen zusehends. Überall sind menschliche Lebenswelten kulturell heterogen geworden. Das Fremde beginnt gleich nebenan. Wir leben mit Ein- und Auswanderern, mit ihren Sprachen, Religionen, Weltsichten, die überall auf der Welt ein Teil der lokalen Welten geworden sind. Der gewandelte prozesshafte Kulturbegriff versucht daher den Widersprüchen, der Vermischung und jener neuen Diversität gerecht zu werden, die stärker auf Verbindungen als auf Autonomie basieren. Weiterhin impliziert dieses Kulturverständnis, dass interkulturelle Kommunikation nicht zwischen Kulturen stattfindet, sondern als interpersonale Interaktion zwischen Individuen.
1.3 Multikulturalität – Transkulturalität – Interkulturalität
In Verbindung mit dem großen Schlagwort Globalisierung und seinen Folgen werden die Schlüsselbegriffe „multikulturell“, „transkulturell“ und „interkulturell“ in der heutigen Zeit allerorts und zu fast allen Zwecken benutzt ohne sich ihrer differenzierten Bedeutung und Tiefenschärfe bewusst zu sein. Um sich dem Begriff der interkulturellen Kompetenz anzunähern und ihm einen spezifischen Raum zuweisen zu können, ist es notwendig, ihn von den anderen beiden – ebenso populären – Begriffen abzugrenzen.
Die Theorie des Multikulturalismus geht zurück auf den kanadischen Politikwissenschaftler und Philosophen Charles Taylor, der auf die Frage, wie ein Land ohne Nation und eine Nation ohne Konsens existieren könne, mit dem prinzipiellen Aufweis des menschlichen Grundbedürfnisses nach Anerkennung nicht nur als Individuum, sondern auch als Zugehöriger einer bestimmten Gruppe, antwortet.
In der multikulturellen Gesellschaft leben verschiedene ethnische und kulturelle Gruppen nebeneinander, basierend auf der Voraussetzung, dass die Angehörigen der jeweiligen Ethnien sich gegenseitig Verständnis, Respekt und Toleranz entgegenbringen und sich einander als gleichberechtigt anerkennen. Das Prinzip von einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit, nach welcher von allen zu handeln ist, besteht in der Entfaltung von Pluralität und Freiheit und es soll keinen staatlichen oder nichtstaatlichen Anreiz oder Druck zur Assimilation geben.
Seine Ursprünge hat der Multikulturalismus in der Vitalität und Widerstandskraft aufbegehrender Minderheitskulturen, doch in seiner Politik kann er auch Tendenzen der Zementierung kollektiver Identitäten und gleichzeitig Differenzen befördern, so z.B. das Bild von Kultur als ein stabiler und isolierter Container von Sitten und Gebräuchen. Damit provoziert auf implizite Art und Weise, was er im ursprüngliche Sinn bekämpfen wollte: Diskriminierung und Nationalismus. „Wo sich alles um Sprache, Ethnie, Religion, Herkunft dreht, ist das Sprechen von Rasse nicht weit; wo Differenzen institutionalisiert werden, funktionieren Individuen nur in der kulturellen Gruppe, welche sie nicht immer selbst gewählt haben“ (Hollinger 1995 nach Demorgon/Kordes 2006:31).
Transkulturalität geht im Wesentlichen auf den deutschen Philosophen Wolfgang Welsch zurück und gründet in der Annahme, dass Kulturen heutzutage intern durch eine Pluralisierung möglicher Identitäten gekennzeichnet sind und zur gleichen Zeit extern grenzüberschreitende Konturen aufweisen. Die traditionelle Form von Kultur als starres Gehäuse wird durch eine neuartige ersetzt, die über die klassischen Kulturgrenzen wie selbstverständlich hinwegschreitet. Anstelle der separierten Einzelkulturen ist eine interdependente Globalkultur entstanden, die sämtliche Nationalkulturen verbindet und bis in Einzelheiten hinein durchdringt, diese dabei aber nicht verdrängt und in einer uniformen Weltkultur vereint. Das Konzept der Transkulturalität benennt diese veränderte Verfassung der Kulturen und versucht, daraus notwendige konzeptionelle und normative Konsequenzen zu ziehen (Vgl. Welsch 1995:3f.).
Der Begriff Interkulturalität fokussiert nicht wie die beiden vorangegangen Differenzen (Multikulturalität) oder Gemeinsamkeiten (Transkulturalität), sondern Überlagerungen (Interferenzen), wechselseitige Abhängigkeiten (Interdependenzen) und gegenseitige Durchdringungen von Grenzen und Kontakten. Kurz gesagt: Die Welt zwischen den interagierenden Individuen. Schon der lateinische Präfix „inter“ verweist auf Wechselseitigkeit, Reziprozität, Teilungs- und Zuteilungsverhältnisse sowie Angaben von Differenzen. Das Inter kulturelle impliziert die Vielfalt und Vielschichtigkeit der Kulturen und daher versteht sich Interkulturalität auch als ein Dialog zwischen der Eigenkultur auf der einen und der Fremdkultur auf der anderen Seite und betont so eine funktionierende Wechselseitigkeit zwischen Eigenem und Fremden (Vgl. Pan 2008:30f.).
Für interkulturelle Arbeit bedeutet Kultur weder nur die inhaltlichen Aspekte wie Sitten und Gebräuche, Werte und Anerkennungskämpfe bestimmter Gruppen wie es der Begriff Multikulturalität beinhaltet und auch nicht formale Rechtsprinzipien und Normen, Interessen und Verteilungskämpfe einer Gesellschaft wie in der Transkulturalität. Kultur bezeichnet in diesem Zusammenhang vielmehr eine qualitative Art und Weise, wie Menschen in sozialen Gruppen ihre Beziehungen zu ihrer Umwelt pflegen. Die interkulturelle Problematik beschränkt sich daher nicht nur auf die Beziehung zwischen Kulturen und Politik (Multikulturalität) oder nur auf den Zusammenhang zwischen Zivilgesellschaft und Individuen (Transkulturalität), sondern umfasst das Gesamtverhältnis zwischen kulturellen, gesellschaftlichen und weltsystemischen Wirklichkeiten (Vgl. Demorgon/Kordes 2006:33ff.).
Bolten versteht Interkulturalität als etwas, was sich zwischen unterschiedlichen Lebenswelten ereignet. Interkulturen entstehen, wenn Mitglieder unterschiedlicher Lebenswelten gemeinschaftlich handeln. Er betont, dass Interkulturen nicht einfach vorhanden sind, sondern nur in Abhängigkeit ihrer Beteiligten existieren (Vgl. Bolten 2007a:22). Interkulturelle Begegnung stellt nicht nur ein bloßes Bemühen um Dialog dar und interkulturelle Verständigung erfolgt nicht durch das Anerkennen des Anderen und des Fremden (Multikulturalität) und auch nicht durch das Anerkennen des Gemeinsamen und Vertrauten (Transkulturalität), sondern durch die Bearbeitung der Zwischenräume und Zwischenperspektiven zwischen dem Eigenem und dem Anderem, dem Vertrauten und dem Fremden.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass Interkulturalität nicht eine multikulturelle oder transkulturelle Schließung der Geschichte beabsichtigt, sondern sich in stetiger Such- und Protestbewegung befindet mit dem Zweck, immer wieder Geschichte zu eröffnen. Diese permanente Neueröffnung ist als ein dynamisches Element zu verstehen, das weit über das Partikulare der vielen Kulturen sowie Gruppen und das Universale diverser Internationalen hinausgeht (Vgl. Demorgon/Kordes 2006:27-36).
Kapitel 2 Interkulturelle Kompetenz – Ein komplexes Konzept
Auch wenn weitgehend von einem Konsens hinsichtlich der Relevanz von interkultureller Kompetenz gesprochen werden kann, ist nach wie vor keine Einigkeit darüber erzielt worden, was genau unter interkultureller Kompetenz zu verstehen sei, wie diese konzeptualisiert und gefördert werden kann.
Abstrakt und weitgefasst formuliert, handelt es sich um ein Profil von verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die das Subjekt in die Lage versetzen, sich in interkulturellen Überschneidungssituationen angemessen zu verhalten. Das heißt, dass die Begegnung mit dem Anderen, mit Personen aus einer fremden Kultur, im Empfinden, Denken und Verstehen sowie im Handeln des Subjekts friedfertig, verständigungsorientiert und somit auch konstruktiv und produktiv abläuft, so dass am Ende ein beidseitiger positiver kultureller Austausch stattfindet.
Dieser weitläufigen Definition, die jedoch weiterer Differenzierung bedarf, können sich die meisten der unterschiedlichen und von ihrer Anzahl her kaum übersehbaren Modelle zur Beschreibung und Entwicklung interkultureller Kompetenz anschließen. Einheit herrscht weiterhin über die Annahme, dass interkulturelle Kompetenz weitaus komplexer zu begreifen sei als ein effizientes Funktionieren in einer fremden Gesellschaft oder Umgebung, und dass es von großer Bedeutung sei, die Begrifflichkeit keinesfalls im Singular zu verwenden, da es sich bei „interkultureller Kompetenz nämlich keineswegs um eine einzige Fertigkeit oder Fähigkeit, eine einzige Eigenschaft, die der Lerner zu erwerben hat, [handelt], sondern vielmehr um ein vielschichtiges Geflecht unterschiedlicher Teilkompetenzen, die alle ausgebildet und miteinander vernetzt sein müssen, um fruchtbare interkulturelle Interaktion zu ermöglichen“ (Antor 2007:112).
Bei einem Rückblick auf die fast vierzigjährige Entwicklungsgeschichte von theoretischen Ansätzen zur Beschreibungen von interkultureller Kompetenz wird deutlich, dass sich das Spektrum in drei große Modelle unterteilen lässt, Listen-, Struktur- und Prozessmodelle. Entscheidungen für eines dieser Modelle als Basis für die Praxis werden zum größten Teil implizit getroffen. Eine solche Entscheidung nimmt jedoch erheblichen Einfluss darauf, wie sich das Bildungsziel und auch der Bildungsprozess gestalten. Eine Erläuterung der einzelnen Modelle erfolgt in den folgenden Kapiteln.
2.1 Definitionsmodelle Interkultureller Kompetenz
2.1.1 Listen- und Strukturmodelle
Konzeptualisierungen interkultureller Kompetenz haben sich seit dem Beginn entsprechender Forschungsreihen in den fünfziger Jahren hauptsächlich an Beschreibungen von Persönlichkeitsmerkmalen erfolgreicher Expatriats[2] orientiert und daraus interkulturelle Teilkompetenzen abgeleitet. Auf diese Weise sind umfassende Merkmalslisten entstanden, die interkulturelle Kompetenz additiv als Summe verschiedener Teilkompetenzen verstehen. Diese so genannten Listenmodelle sind angesichts der Fülle von Befunden nicht nur unabgeschlossen, sondern unterliegen vor allem einer gewissen Beliebigkeit, obwohl sie sich gerade wegen ihrer quantitativen Vielfalt und vermutlich auch ihrer vergleichsweise leichten Operationalisierbarkeit im Rahmen interkultureller Trainings als relativ stabile Merkmalskerne herauskristallisiert haben. Als Teilkompetenzen werden in solchen Listenmodellen hauptsächlich „Fremdsprachenkenntnisse“, „Aufgeschlossen-heit“, „Flexibilität“, „Empathie“, „Anpassungsfähigkeit“, „Optimismus“, „Ambiguitätstoleranz“, „Kontaktfähigkeit“ sowie „Rollendistanz“ aufgeführt (Vgl. Bolten 2007b:22).
In kritischer Abgrenzung zu den Listenmodellen, da diese aufgrund ihrer Vielfältigkeit in der Summe zu sehr differenten Definitionen dessen, was interkulturelle Kompetenz beinhaltet, führen, haben sich seit den neunziger Jahren im Anschluss an Gersten so genannte Strukturmodelle zur Beschreibung interkultureller Kompetenz etabliert. Diese ermöglichen aufgrund ihrer Systematik eine größere Verbindlichkeit. Sie stammen überwiegend aus der Sozialpsychologie und klassifizieren interkulturelle Kompetenz in drei interdependente Dimensionen: kognitive, affektive und verhaltensbezogene bzw. pragmatische Teilkonstrukte (Vgl. Stüdlein 1997:154ff.). Viele Autoren sprechen daher auch von der Dreidimensionalität interkultureller Kompetenz. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Dimensionen des Strukturmodells näher beleuchtet und abschließend kritisch analysiert und bewertet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1. Strukturmodell interkultureller Kompetenz (Gelbrich/Müller 2004:794)
2.1.1.1 Kognitive Dimension
Die kognitive Dimension setzt eine Aneignung von Wissen voraus und gilt daher als eine wesentliche Voraussetzung für die Interpretation des Verhaltens des fremdkulturellen Interaktionspartners und für die Reflexion des eigenen angemessenen und effizienten Verhaltens in interkulturellen Situationen. Schenk (2001) nennt diese Dimension auch „Interkulturelle Bewusstheit“. Kurz gesagt, beinhalten diese kognitiven Aspekte neben Kenntnissen der fremden oder anderen Kultur auch ein Wissen über anthropologische, psychologische, philosophische und soziologische Grundlagen menschlichen Verhaltens in der Auseinandersetzung mit Alterität und schließlich ein kritisches Wissen über die eigene Kultur (Vgl. Antor 2007:112).
Zu den Kenntnissen der fremden Kultur zählt vor allem, so sehr es auch von manchen Autoren kritisiert und müde belächelt wird, ein landeskundliches Wissen. Antor argumentiert, dass gerade solche Kenntnisse, zu denen er neben geografischen und geschichtlichen Aspekten, ein Wissen über politische Systeme und Institutionen sowie das Rechtssystem, die Wirtschaft auch Kunst, Literatur und Sprache genauso wie die codes of behaviour des fremdkulturellen Alltags zählt, einen kognitiven Rahmen geben, innerhalb dessen eine hermeneutische Annährung an eine andere Kultur erst möglich wird (Vgl. Antor 2007:113f.).
Bittner/Reisch betonen jedoch, dass sich die Wissenskompetente interkultureller Kompetenz nicht nur auf ein oberflächliches oder punktuelles Wissen vereinzelter Grundannahmen, Werte und Normen sowie Denk- und Verhaltensweisen beschränken sollte. Vielmehr beinhalte sie, dass das Grundmuster bzw. die innere Logik einer fremden Kultur erschlossen werden soll (Vgl. Bittner/Reisch 1994:126f.). An dieser Stelle wird die Bedeutung des Kulturverständnisses für die Annährung an den Begriff interkultureller Kompetenz abermals deutlich. Um den Einfluss von Kulturstandards auf das Verhalten in interkulturellen Überschneidungssituationen zu erfassen, ist es notwendig, ein Konzept und ein Verständnis dafür zu entwickeln, was Kultur ist, wodurch sie geprägt wird und worauf sie Auswirkungen haben kann.
Stüdlein schlägt daher eine Erweiterung der kognitiven Dimension um folgende Aspekte vor: Das Verständnis des Kulturkonzeptes bzw. des Phänomens Kultur, insbesondere ihres Einflusses auf Wahrnehmung, Denken, Einstellungen sowie Verhaltens- und Handlungsweisen. Diesem Aspekt muss eine zentrale Bedeutung beigemessen werden, da ohne ein entsprechendes Verständnis weder ein adäquates Verständnis der Kultur des Interaktionspartners noch das Verständnis der eigenen Kultur möglich ist. Ein bewusstes und tiefgehendes Verständnis der eigenen Kultur ist nach Auffassung verschiedener Autoren sogar bedeutender als die Kenntnisse über die Kultur des Interaktionspartners. Denn erst durch die Reflexion des Eigenen wird ein Verständnis der Kulturunterschiede zwischen den Interaktionspartnern auf den Ebenen basaler Annahmen, Werte und Normen sowie interkultureller Artefakte ermöglicht. Weiterhin sind ein Verständnis der Besonderheiten interkultureller Kommunikation und Interaktion und damit ein Verständnis ihrer inhärenten Komplexität bzw. ihren Barrieren und Problembereichen nötig. Dies beinhaltet ferner ein grundlegendes Verständnis davon, dass die Ursachen von Missverständnissen und Probleme zum größten Teil in der kulturellen Differenziertheit der Interaktionspartner zu finden sind (Vgl. Stüdlein 1997: 157ff.).
Als weiteren wichtigen Aspekt der interkulturellen Bewusstheit ist die Alteritätskompetenz zu erwähnen. Sie umfasst ein Wissen um die Notwendigkeit von Alterität, da ohne diese keine Subjektivität bzw. Identität möglich ist. Die Einsicht, dass das Andere oder das Fremde zur Bedingung des Eigenen nötig ist, kann entscheidend dazu beitragen, dass auf der affektiven Ebene Angst- und Ablehnungsreflexe gegenüber dem fremdkulturellen Interaktionspartner gemildert oder sogar vermieden werden können. Außerdem spielt das Wissen um Alterität eine wichtige Rolle beim Aufbau einer positiven und neugierigen Offenheit gegenüber fremden Kulturen und stellt auch damit eine Voraussetzung für einen friedfertigen und konstruktiven Umgang mit ihren Angehörigen dar (Vgl. Antor 2006:214f.). Schenk fügt diesen Aspekt betreffend eine „Awareness“ für sich selbst und für interkulturelle Prozesse hinzu. Erst durch ein klares Rollenkonzept seiner selbst sei der Mensch zur Übernahme fremdkultureller Perspektiven fähig (Vgl. Schenk 2001:56).
2.1.1.2 Affektive Dimension
Da sich interkulturelle Missverständnisse größtenteils und zu allererst auf der affektiven Ebene ereignen, ist für Bennett die interkulturelle Sensibilität die wichtigste Komponente der interkulturellen Kompetenz. Seiner Meinung nach seien die anderen Ebenen, welche er als „mindset“ und „skillset“ betitelt, zwar für die Entwicklung interkultureller Kompetenz notwendig, jedoch ohne die dritte Komponente der interkulturellen Sensibilität nicht ausreichend. Interkulturelle Sensibilität sei allerdings nicht nur als eine bloße positive Einstellung gegenüber kulturellen Unterschieden oder als der Wunsch, sich mit fremdkulturellen Menschen gut zu verstehen, zu betrachten. Vielmehr lässt sie sich als ein bewusstes Wahrnehmen der kulturellen Unterschiede zusammenfassen „The ability to experience cultural difference“ (Bennett 2001:218).
2.1.1.2.1 Exkurs. Milton Bennetts Entwicklungsmodell interkultureller Sensibilität
Die Sensibilisierung im interkulturellen Umgang gründet nach Bennett auf Wahrnehmung und Erfahrung. Ein von ihm postuliertes aus sechs Entwicklungsstufen der Wahrnehmung und des Umgangs mit interkulturellen Unterschieden bestehendes Modell geht von einer ethnozentrischen Weltsicht aus und endet in einer ethnorelativen Weltsicht. Der Mensch entwickelt also im Umgang mit kulturellen Unterschieden interkulturelle Sensibilität.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Entwicklungsmodell Interkultureller Sensibilität nach Milton Bennett (Bennett 1986:182).
Ausgangspunkt ist der Zustand der Verleugnung (denial), in welchem die Person ihre Kultur als die einzig wahre Realität erfahre, fremde Kulturen ignoriere und so Kulturunterschiede ebenso wenig wahrnehme. In der darauffolgenden Entwicklungsphase der Abwehr (defense) werde damit begonnen, andere Kulturen wahrzunehmen, allerdings auf stereotypisierende Weise. Die eigene Kultur gelte nach wie vor als die einzig wahre. Erst in der Minimalisierungs- oder Verharmlosungsphase (minimalization) werden menschliche, universelle Gemeinsamkeiten wahrgenommen und Unterschiede nivelliert, allerdings fehle es nach wie vor an einem kulturellen Selbstverständnis. In der anschließenden Phase, der Akzeptanz (acceptance), vollziehe sich ein signifikanter Schritt hin zum ethnorelativierenden Wahrnehmen. Das Individuum erkenne seinen eigenen kulturellen Kontext und akzeptiere die Unterschiede zu den fremden Kulturen. Entsprechende interkulturelle und funktionierende zwischenmenschliche Aktionsradien werden geschaffen und eine Neugierde auf sowie Respekt gegenüber den anderen Kulturen können wahrgenommen werden. Daran schließe die Anpassung oder Adaptierung an (adaption). Durch die Akzeptanz der kulturellen Unterschiede in der vorangegangenen Phase entwickele sich Empathie und so auch die Möglichkeit, nun die Welt ebenfalls aus dem Blickwinkel des fremdkulturellen Gegenübers wahrzunehmen. Dadurch werde gleichzeitig die Kommunikation erleichtert und ein bewusster Umgang mit den fremden Kulturen ermöglicht. Abgeschlossen wird das Entwicklungsmodell mit der Phase der Integration (integration). Der entwickelte multikulturelle Blickwinkel sei zu einem Teil der Persönlichkeit des Individuums geworden und ermögliche diesem, sich nun problemlos und reflektiert zwischen den Kulturen bewegen zu können (Vgl. Bennet 1986: 179-187).
„In the language of this model, a person who has integrated differences is one who can construe differences as processes, who can adapt to those differences, and who can additionally construe him or herself in various cultural ways“ (Bennett ebd.:186).
In anderen Konzeptualisierungen interkultureller Kompetenz ist die Bedeutung der affektiven Dimension eher umstritten. Zahlreiche Studien untersuchen interkulturelle Kompetenz vor dem Hintergrund eines eigenschaftstheoretischen Ansatzes und identifizieren Persönlichkeitsmerkmale und Einstellungen, welche den interkulturell kompetenten Menschen charakterisieren. Dazu gehören hauptsächlich: Ambiguitätstoleranz, Fähigkeit zur Stressbewältigung und Komplexitätsreduktion, Frustrationstoleranz und Ausdauer, Selbständigkeit, Selbstvertrauen und Selbstbeherrschung, Flexibilität und Empathie, ebenso wie Unvoreingenommenheit bzw. Vorurteilsfreiheit. Weiterhin Offenheit, Aufgeschlossenheit und Toleranz genauso wie ein geringer Grad an Ethnozentrismus und schließlich die Bereitschaft zur Akzeptanz, Respekt sowie zum interkulturellen Lernen (Vgl. Stüdlein 1997:154f.).
2.1.1.3 Verhaltensbezogene bzw. pragmatische Dimension
Eine Person ist nicht interkulturell kompetent, wenn sie zwar positive Persönlichkeitsmerkmale aufweist und über ein hohes Maß an kulturellem Wissen und Verständnis verfügt, aber dieses nicht auszudrücken und umzusetzen weiß. Die verhaltensbezogene Dimension beinhaltet aufgrunddessen Fähigkeiten, die es dem Individuum ermöglichen sollen, die auf der kognitiven und affektiven Ebene genannten Einstellungen und Fertigkeiten erfolgreich im interkulturellen Kontext umzusetzen und zu nutzen.
Antor nennt hier an erster Stelle die fremdsprachliche Kompetenz. Seiner Meinung nach sei es eine wichtige Grundvoraussetzung für produktiven interkulturellen Austausch, die Sprache des Anderen zu sprechen und dieses sei auch keineswegs durch den Einsatz eines Dolmetschers zu ersetzen. Er argumentiert damit, dass die Sprache mehr sei als nur ‚Transportmittel’ von Ideen und gedanklichen Mustern. Die Sprache gelte als wichtiges Instrument des Menschen, mit welchem er sich seine Welt konzeptualisiert und daher einen bedeutenden funktionalen Anteil an der Formung von Welt nimmt. Da auch Kulturen als Muster von Weltorganisationen sprachlich konstituiert sind, sei es unverzichtbar die Sprache des fremdkulturellen Interaktionspartners zu beherrschen, um ein partielles Eintauchen in dessen Horizont zu ermöglichen (Vgl. Antor 2007:121f.).
Stüdlein fasst die verhaltensbezogene Dimension in drei Grundfähigkeiten zusammen. Als Basisfähigkeit nennt sie den Willen und die Bereitschaft zur Kommunikation. Weiterhin muss die interkulturell kompetente Person über Kommunikationsfähigkeit verfügen, vor allem über eine ausgeprägte Fähigkeit des aktiven Zuhörens. Besonderer Bedeutung wird ebenfalls der Fähigkeit beigemessen, Respekt, Empathie und Flexibilität zu zeigen bzw. zu kommunizieren. Allerdings muss hier bedacht werden, dass die Bedeutung solchen Verhaltens zwar nahezu universell ist, die Art und Weise, wie Respekt etc. ausgedrückt und interpretiert wird, zwischen Kulturen jedoch substantiell variieren kann. Der Fähigkeit des aktiven Zuhörens wird deshalb die zentrale Bedeutung zugeschrieben, da nur auf diese Weise Deutungsunterschiede erfasst und Missverständnisse vermieden werden können.
Schließlich spielt die soziale Kompetenz, insbesondere die Fähigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen und Vertrauen aufbauen und pflegen zu können, eine tragende Rolle. Über gute persönliche Beziehungen sollen insbesondere mehr Informationen über angemessenes und effektives Verhalten sowie mehr Feedback über die eigenen Verhaltensweisen gewonnen werden können. Darüber hinaus schlägt Stüdlein vor, als weitere Faktoren der verhaltensbezogenen Dimension wertfreie Erkenntnis und Berücksichtigung kultureller Unterschiede, eine akkurate Attribution und die effektive Verwendung von Stereotypen anzufügen (Vgl. Stüdlein 1997:159ff.).
Antor ergänzt die Beherrschung der allgemeinen Regeln kommunikativer Kompetenz mit einer Verhandlungskompetenz und verweist auf das dialogische Modell des gegenseitig bereichernden und fordernden sowie befördernden Austausches, das als Basis für erfolgreiche interkulturelle Begegnungen auf der verhaltensbezogenen bzw. pragmatischen Ebene angesiedelt ist. „Der Prozess des Findens eines möglichst großen Fundamentes von Gemeinsamkeiten, das es dann auch ermöglicht, Unterschiede zu erkennen, anzuerkennen, zu bewundern oder auch nur zu ertragen, gestaltet sich im Sinne eines explorativen Aushandelns von Positionen im gemeinsamen Gespräch, und auch diese Art des interkulturellen Feilschens um Weltwahrnehmungs- und Weltgestaltungsmuster muss geübt werden. So hat Gick (1997) zu Recht darauf verwiesen, dass die Fähigkeit des ‚negotiating common ground’ eine wesentliche Grundlage interkultureller kommunikativer Kompetenz ist“ (Antor 2007:123).
2.1.2 Kritische Beurteilung
Trotz der Differenziertheit und Systematik des Strukturmodells lassen sich dennoch zahlreiche Kritikpunkte herausarbeiten. An erster Stelle ist die fehlende Kontextualität zu nennen, besonders sei hier auf die im ersten Kapitel erwähnte These von Bolten zu verweisen, dass Interkulturen nicht einfach vorhanden sind, sondern nur in Unabhängigkeit ihrer Beteiligten existieren. Durch das Nichtbeachten der situativen Variablen gerät die Gesamtkonzeption, aber besonders die affektive Dimension in den Fokus der Kritiker.
Schenk bemängelt insbesondere, dass auf diese Weise eine Betrachtung der personalen Eigenschaften und deren Ziele außer Acht gelassen werden und so die Zuordnung der Aspekte in eine der drei Dimensionen künstlich erscheinen lässt (Vgl. Schenk 2001:58).
Daran anknüpfend wird ebenso aus wissenschaftlicher Sicht gegen den eigenschaftstheoretischen Ansatz auf der affektiven Ebene argumentiert. Die aufgelisteten Persönlichkeitsmerkmale seien isoliert gemessen und werden in Korrelation zu bestimmten Merkmalen eines Erfolgs gesetzt, ohne eine jeweils spezifische Interaktionssituation zu berücksichtigen. So scheint es beispielsweise plausibel, dass Flexibilität in jeder Situation für Erfolg günstig ist, jedoch wären ferner weitere konkrete Information darüber wünschenswert, welche Merkmale für die Interaktion mit welchen Kulturen und für welche wesentlichen Situationen besonders beachtenswert wären. Außerdem sei an dieser Stelle hervorzuheben, dass erfolgsfördernde Eigenschaften nicht in allen Kulturen gleich definiert und gewertet werden (Vgl. Stüdlein 1997:155f.).
In diesem Zusammenhang muss auch darauf verwiesen werden, dass Charaktereigenschaften und Einstellungen nicht immer in dem erwarteten Verhalten resultieren. Einerseits besteht vor dem Hintergrund der kontrovers diskutierten Frage, inwieweit das Verhalten von den Einstellungen determiniert wird weitgehend Konsens darüber, dass es neben diesen auf jeden Fall noch weitere Einflussfaktoren gibt, andererseits können positive Eigenschaften und Einstellungen keine Effekte auslösen, wenn das Individuum nicht in der Lage ist, angemessen auf der verhaltensbezogenen Ebene zu interagieren, d.h. seinen positiven Einstellungen folgend zu kommunizieren.
Ebenso wenig wird in den Auflistungen deutlich, welche konkreten Verhaltensweisen sich überhaupt hinter den Eigenschaften verbergen. Ihnen wird eine fehlende Differenzierung vorgeworfen, da sie sich im Wesentlichen nicht von den üblichen Merkmalen, die einer erfolgreichen Führungskraft zugeschrieben werden, unterscheiden. Auch hier kann erneut von fehlender Kontextualität gesprochen werden. So bemerkt Schipper, dass Eigenschaften wie beispielsweise Taktgefühl, Empathie oder Toleranz in ihrer Generalität im Grunde Voraussetzungen für jede Art sozialer Kompetenz sind (Vgl. Schipper 2007: 30f). Stüdlein verweist außerdem auf eine geringe begriffliche Trennschärfe, die dazu führt, dass einige der genannten Eigenschaften widersprüchlich und kaum in einer Person vereinbar wären. So sei ihrer Meinung nach Empathie häufig mit Passivität und Introvertiertheit verbunden, so dass nur selten Offenheit, Selbstvertrauen etc. bei sehr empathischen Menschen zu finden sei (Vgl. Stüdlein 1997:155f.). Dieser Aussage stehe ich allerdings eher kritisch gegenüber, da es doch den vorangegangen Aussagen erstens widerspricht und zweitens über den Charakter einer Vermutung verfügt.
Da aber davon ausgegangen wird, dass die drei Dimensionen interkultureller Kompetenz in einem interdependenten Verhältnis zueinander stehen, ist es sinnvoll, die aufgeführten Persönlichkeitsmerkmale und Einstellungen als Hypothesen zu begreifen, welche einer weitergehenden Fundierung und Präzisierung unter konzeptionellen sowie methodischen Aspekten bedürfen. Des Weiteren können sie auch nur in dem Maß als relevant beurteilt werden, in dem sie das aktuelle Verhalten einer Person in einer interkulturellen Überschneidungssituation überhaupt bestimmen (àKontextbezug). Um folglich von Interkultureller Kompetenz im Ganzen zu sprechen, ist es notwendig, die Eigenschaftslisten der affektiven Dimension auf der verhaltensbezogenen Dimension umgesetzt zu verstehen (Vgl. Schipper 2007:30f.).
Knapp-Potthoff bezweifelt den gesamten Inhalt der affektiven Dimension bzw. die Erlernbarkeit oder Veränderbarkeit der Aspekte in einem Aufsatz von 1997 mit klaren Worten: „Während man davon ausgehen kann, dass ein Zuwachs an Wissen noch am relativ unproblematischsten erreicht werden kann, muss man die Veränderbarkeit von Persönlichkeitsmerkmalen wohl eher skeptisch einschätzen“ (Knapp-Potthoff 1997:182). Sie schlussfolgert daraus, dass die jeweiligen Varianten von interkultureller Kompetenz nicht für jeden bzw. jede realisierbar sein kann. Neben der kritischen Auseinandersetzung mit dieser Dimension Interkultureller Kompetenz, rückt sie in erster Linie die kognitive Dimension, insbesondere die Funktion des kulturbezogenen Wissens als Basis für die Interkulturelle Kompetenz, in den Fokus ihrer Kritik.
Kulturelle Informationen seien so vielfältig und differenziert, dass Knapp-Potthoff ihre Vermittelbarkeit ebenfalls anzweifelt. Ausgehend von der Annahme, dass Kulturen einem zeitlichen Wandel unterworfen sind und sich insbesondere oberflächennahe Elemente in relativ kurzen Zeitabständen beträchtlich verändern können, müsse dieses kulturspezifische Wissen, welches ja ein möglichst umfassendes und pluralistisches sein soll, permanent aktualisiert werden.
Die Tatsache, dass heutzutage nicht mehr von homogenen (National-) Kulturen oder monokulturell geprägten Individuen ausgegangen wird, verleiht der Frage nach der Differenziertheit des Kulturwissens zusätzlich Nachdruck. Welche Aspekte einer anderen Kultur sind so gesehen überhaupt interessant und relevant für interkulturelle Interaktion?
Auch hier steht wieder der fehlende Kontextbezug im Mittelpunkt der Kritik. Die Einsetzbarkeit des kulturellen Wissens scheint beliebig zu sein und birgt so die Gefahr, auf eine wahllose Anhäufung isolierter Einzelinformation reduziert zu werden, die für das Handeln in konkreten Interaktionen von geringer Bedeutung sein können. Ebenso wenig werde die Systematik und Komplexität der kulturellen Besonderheiten beachtet. Um diese in der Interaktion auch funktional verwenden zu können, können sie nicht in Form simpler Zuordnungen nach dem Muster ‚Land:Hauptstadt’ organisiert werden, sondern müssen als komplexe Schemata konstruiert werden, die Wahrnehmen und Handeln der Teilhaber einer Kultur beeinflussen.[3]
Schließlich lassen sich kulturelle Besonderheiten je nach Kontext in unterschiedlicher Weise, in unterschiedlicher Komplexität und in unterschiedlicher Tiefe beschreiben. Ohne also das Wissen immer wieder in einem spezifischen Kontext zu reflektieren und seine Adressaten bzw. Anwendergruppen einzubeziehen, fehlten diesem entscheidende funktionale Aspekte. Als zusätzliche Schwierigkeit benennt Knapp-Potthoff den Prozesscharakter des Wissenserwerbs von kulturbezogenen Wissen.
Da sowohl Kultur als auch Lernen als prozessuale Begriffe definiert werden, muss davon ausgegangen werden, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt das Kulturwissen notwendigerweise unvollständig, sehr grob oder sogar fehlerhaft sein könnte. Wenn daher kulturbezogene Lernprozesse frühzeitig abgebrochen oder nicht ausreichend unterstützt werden, kann etwas entstehen, was als Fossilierung kulturbezogenen Wissens bezeichnet werden kann (Vgl. Knapp-Potthoff 1997: 185-193).
Festzuhalten bleibt, dass, um kulturbezogenes Wissen als eine Kernkomponente interkultureller Kompetenz zu verstehen, folgende Annahmen berücksichtigt werden müssen:
- Ein solches Wissen müsste sich nicht nur auf eine fremde Kultur beziehen, sondern auf mehrere.[4]
- Das Wissen müsste möglichst umfangreich, systematisch und differenziert sein.
- Hinsichtlich der Beschreibungstiefe müsste es auf den Adressaten abgestimmt sein.
- Bereits während des Lernprozess muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass es sich immer um ein vorläufiges und ergänzungs- sowie differenzierungsbedürftiges Wissen handelt.
- Es ist nötig, dass das Wissen in seiner Relevanz für die Bewältigung interkultureller Kontaktsituationen immer wieder einer Reflexion unterzogen werden muss.
Wie bereits schon an anderer Stelle angedeutet, besteht in der alltäglichen Handlungswirklichkeit ein Interdependenzverhältnis zwischen der kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Teilkompetenz. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass alle drei Dimensionen einem gegenseitigen Durchdringungsprozess unterliegen und sich einander bedingen und beeinflussen. So werden die in der affektiven Dimension aufgelisteten Persönlichkeitsmerkmale zum Beispiel auf der verhaltensbezogenen Dimension deutlich.
[...]
[1] Der Begriff „Soziobiologie“ stammt aus der US-amerikanischen Verhaltensbiologie der 40er Jahre und wendet evolutionäre Theorien auf soziales Verhalten an. Soziobiologen sind bemüht anhand von Untersuchungen menschlicher Gesellschaften zu zeigen, dass auch menschliches Verhalten einer natürlichen Selektion und Reproduktionserfolgsdruck unterliegt (Vgl. Byron/Holcomb 2005)
[2] Ein Expatriat (engl. expatriate; von lat. ex aus, heraus; patria Vaterland) ist jemand, der vorübergehend oder dauerhaft, aber ohne Einbürgerung in einem anderen Land oder Kulturkreis lebt als dem seiner Abstammung.
[3] An dieser Stelle bleibt außerdem kritisch zu fragen, inwieweit ein solches deskriptives Wissen, jenes aus der Perspektive eines außenstehenden Beobachters formuliertes Wissen über eine spezifische Kultur, überhaupt identisch oder ansatzweise vergleichbar mit Wissen ist, über welches die Teilhaber der Kultur selbst verfügen?
[4] Allerdings sollte die Realisierbarkeit ebenfalls kritisch gesehen werden. Welche Kulturen sind mit mehreren Kulturen gemeint?
Details
- Titel
- Interkulturelle Kompetenz und Kosmopolitismus als pädagogische Herausforderung?
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 101
- Katalognummer
- V228496
- ISBN (eBook)
- 9783842814578
- Dateigröße
- 674 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- interkulturalität multikulturalität transkulturalität bildungskonzept diskursanalyse
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2009, Interkulturelle Kompetenz und Kosmopolitismus als pädagogische Herausforderung?, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/228496

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.