Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos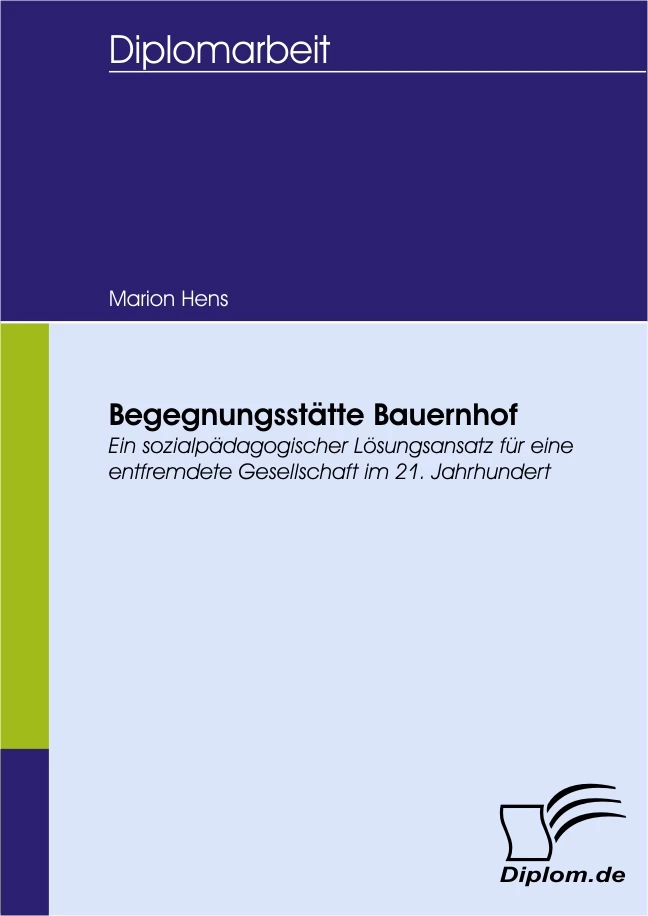
Begegnungsstätte Bauernhof
Diplomarbeit, 2010, 101 Seiten
Autor

Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Fachhochschule Düsseldorf (Sozial- und Kulturwissenschaften, Studiengang Sozialpädagogik)
Note
2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Themavorstellung
1.2 Vorgehensweise
2. Die Entfremdung und die menschliche Situation
2.1 Definitionen
2.2 Entfremdungstheorie nach Karl Marx
2.3 Das Wesen oder die „Situation des Menschen“ nach Erich Fromm
3. Heutige Situation: Entfremdung
3.1 ...von sich selbst
3.1.1 Marketing-Charakter
3.1.2 Haben und Sein
3.1.3 Stadtkinder, Naturabenteuer und Medienkonsum
3.2 ...von anderen Menschen
3.2.1 Individualisierung
3.2.2 Mann-Frau-Konflikt
3.2.3 Generationenkonflikt
3.3 Auswirkungen auf die Tiere und die Natur
3.3.1 Tierausbeutung
3.3.1.1 Schweine-Intensivtierhaltung
3.3.1.3 Tierversuche
3.3.2 Zerstörung der Natur/Umwelt
4. Zusammenfassung und Überleitung
4.1 Zusammenfassung
4.2 Überleitung
5. Die soziale Landwirtschaft
5.1 Was ist „Soziale Landwirtschaft“?
5.2 Internationale Projekte, Organisationen
5.3 Nationale Projekte, Organisationen
6. Die Jugendfarm
7. Zusammenfassung und Überleitung
7.1 Zusammenfassung
7.2 Überleitung
8. Begegnungsstätte Bauernhof
8.1 Methode: Tiergestützte Intervention
8.1.1 Kurze Einführung
8.1.2 Formen der Tiergestützten Intervention
8.1.3 Wirkungen von Tieren auf den Menschen
8.1.4 Beispiel: Tiergestützte Intervention mit einem Esel
8.2 Methode: Ökologisch-landwirtschaftliches Arbeiten
8.3 Methode: Künstlerisch-handwerkliches Arbeiten
8.4 Methode: Übung in der Kunst des Liebens nach Erich Fromm
9. Fazit
9.1 Zusammenfassung
9.2 Schlussbetrachtung
Quellenangaben
Literatur
Bilder, Grafiken
Anhang
Weitere Informationen im Internet
Ausbildung, Weiterbildung, Studium, Lehrgang zum Thema „Tiergestützte Pädagogik“
Informationsquellen zu Schulbauernhöfen in Deutschland
Adressen von Jugendfarmen in Deutschland (Homepage u. e-mail)
Erklärung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zum ersten mal in der Geschichte
hängt das physische Überleben der Menschheit
von einer radikalen seelischen Veränderung des Menschen ab
(Fromm, 1976)
1. Einleitung
1.1 Themavorstellung
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Entfremdung aus soziologischer und psychologischer Sicht, seiner Auswirkung und der Skizzierung eines Weges, ihm im Rahmen der sozialpädagogischen Intervention zu entgehen bzw. sich dessen Einfluss zu entziehen.
Stellen wir uns einen Tag in der Woche eines gewöhnlichen Angestellten in Deutschland vor. Er geht früh morgens zu seiner Arbeit, die er in der Regel nicht machen würde, wenn er kein Geld dafür bekommen würde. Er verrichtet seine Arbeit routinemäßig, jedoch ohne Hingabe, da die Ziele der Arbeit nicht die seinen sind. Wenn er abends nach Hause kommt, dann möchte er den anstrengenden Arbeitstag schnell vergessen und sucht sich Unterhaltung, die keinerlei weitere Anstrengung verursacht, da seine Energiereserven erschöpft sind. Diese Unterhaltung findet er meist beim fernsehen. Am nächsten Tag wiederholt sich diese Prozedur.[1]
So einen Tag erleben viele Menschen. Sie leben routiniert und gehen ihren Pflichten nach. Doch wer sagt ihnen, welche Pflichten sie zu erfüllen haben? Wäre es möglich, dass sie den falschen Pflichten nachkommen?
Wie könnte der Tag eines Menschen aussehen, an dem er Dinge tut, die ihm aus persönlichen Gründen wichtig sind und ihn mit tiefer Freude erfüllen?
Ich denke, viele Menschen fühlen sich heutzutage entfremdet, oder anders gesagt, sie sind nicht mit voller Anteilnahme an ihrem eigenen Leben beteiligt. Daher stelle ich folgende These auf: „Die Menschen wissen heute nicht mehr, wer sie sind. Dies hat schwerwiegende Folgen für sie und ihre Umwelt.“
1.2 Vorgehensweise
Zuerst werde ich versuchen anhand von Jaeggi und Marx darzustellen, was der Begriff „Entfremdung“ bedeutet. Wie fühlt sich ein entfremdeter Mensch? Woran merkt man, dass man entfremdet ist? Diese Fragen werden im ersten Teil des ersten Kapitels erörtert. Im zweiten Teil wird anhand von Marx erklärt, wie es zur Entfremdung gekommen sein könnte. Daraufhin wird im dritten Teil anhand der Theorie von Fromm über die „Situation des Menschen“ das Wesen des Menschen erläutert, um eine Idee zu bekommen, was der Unterschied zwischen „normal“ und „entfremdet“ sein könnte. Im zweiten Kapitel folgt eine Abhandlung über die Situation der Entfremdung im 21. Jahrhundert und ihrer Auswirkung auf die Menschen und die Umwelt. Dies ist der erste Teil der Arbeit und stellt die theoretische Grundlage über die Entfremdungsproblematik dar, auf die der zweite Teil aufgebaut ist.
Im zweiten Teil werde ich anhand von bereits vorhandenen und eigenen Ideen sozialpädagogische Handlungsmöglichkeiten beschreiben, die dem Phänomen der Entfremdung entgegenwirken können. Angefangen mit der Darstellung der sozialen Landwirtschaft und dem diesbezüglichen aktuellen Stand der Dinge, gehe ich über zu einer ihrer besonderen Formen, der Jugendfarm. Es folgt eine detaillierte Beschreibung darüber, was man sich unter einer Jugendfarm vorzustellen hat und wie sie konzeptionell aufgebaut ist. Im nächsten Punkt möchte ich die Idee einer „Begegnungsstätte Bauernhof“ entwerfen. Das Konzept der Begegnungsstätte Bauernhof ist dem der Jugendfarm ähnlich. Der Unterschied ist eine Bereicherung durch eine zusätzliche Methode, die auf die Entfremdungsproblematik zugeschnitten ist.
2. Die Entfremdung und die menschliche Situation
Was ist unter „Entfremdung“ zu verstehen? Und wovon kann sich ein Mensch entfremden? Diese Fragen werden in diesem Kapitel näher beleuchtet.
Zuerst werde ich versuchen darzustellen, was der Begriff „Entfremdung“ alles beinhalten kann. Dann folgt die Theorie von Karl Marx über die entfremdete Arbeit. Sie ist in der heutigen freien Marktwirtschaft noch genau so aktuell wie zu der Zeit, als sie verfasst wurde und kann daher sehr gut einige der derzeitigen Probleme offenlegen. Abschließend werde ich der Frage nachgehen, wovon ein Mensch sich entfremden kann, oder anders gesagt, wie ein Mensch wäre, wenn er nicht entfremdet ist. Hierfür habe ich die Theorie von Erich Fromm über die „Situation des Menschen“ herangezogen, da sie mir als die momentan plausibelste erscheint, die existiert.
2.1 Definitionen
Jaeggi gibt folgende Phänomene der Entfremdung an:
a) Im allgemeinen Sprachgebrauch redet man von „Entfremdung“, wenn man etwas tut, obwohl man es eigentlich gar nicht möchte. Man ist „fremdgesteuert“, also nicht „im Besitz seines Selbst“. Ein Beispiel wären Menschen, welche die Eigenschaften, Träume und Ideen von anderen Menschen besser finden als ihre eigenen und diese eigenen dann vernachlässigen oder komplett verleugnen.
b) Auch können Verhältnisse oder Tätigkeiten „entfremdet“ sein. Da wäre z. B. der Bauarbeiter, der den ganzen Tag auf seinen Feierabend wartet; der Bauer, der bei seiner Arbeit nur an Möglichkeiten der weiteren Profitmaximierung denkt; der Konsument, der sich jeden Tag Dinge kauft, die er nicht braucht; die Bekanntschaft, bei der man überlegt, wie sie einem von Nutzen sein könnte; der Dienstleister, der sich beim Gespräch mit seinem Kunden überlegt, wie dieser ihm nützlich sein könnte;...
c) Ebenfalls als „Entfremdung“ kann man die Isolierung aus sozialen Verhältnissen betrachten, z. B. von der Familie, von Freunden, von der Heimat, allgemein von Gemeinschaften. Diese Isolierung kann erfolgen durch „räumliche Trennung aus jeglichen Gründen“ also physisch, oder durch die nicht vorhandene Fähigkeit zur Identifikation mit dem jeweiligen sozialen Verhältnissen, also psychisch.
d) Als „entfremdet“ kann man auch die Beziehung eines Menschen zu anderen Menschen oder Dingen betrachten, sofern diese über Geld vermittelt wird. Es wird nicht mehr der konkrete Wert eines Menschen oder eines Dinges beurteilt, sondern sein abstrakter. Steht z.B. in einer Zeitung die Überschrift: „Millionenschaden durch Hurrikan“, dann wird das Unglück der Menschen, die gestorben sind oder Angehörige, Freunde oder ihre Heimat verloren haben, abstrahiert. Es wird in Geld ausgedrückt.
e) Der Mensch ist auch „entfremdet“ durch die immer weiter spezialisierte Arbeitsteilung. Im Arbeitsprozess ist nicht mehr sein komplettes Können und Wissen gefragt, sondern nur noch ein sehr kleiner Ausschnitt dessen. Somit kann sich der Arbeiter mit seinem Arbeitsgegenstand nicht mehr identifizieren.
f) „Entfremdet“ kann auch das Verhältnis zwischen Institutionen und Individuen sein. Dies ist der Fall, wenn Individuen die Institutionen zwar erschaffen haben, diese Institutionen aber so mächtig werden, dass sie quasi ein Eigenleben entwickeln und der Herrschaft der einzelnen Individuen übermächtig werden. Ein Beispiel wäre die freie Marktwirtschaft. Durch sie arbeitet der Mensch für den Profit und nicht für sich selbst.[2]
Jaeggi definiert den Begriff „Entfremdung“ folgendermaßen: „ Eine entfremdete ist eine defizitäre Beziehung, die man zu sich, zur Welt und zu den Anderen hat.“[3]
Nach Fromm fühlt sich ein entfremdeter Mensch nicht mehr als „Urheber seiner eigenen Taten“. Der Entfremdete hat die Beziehung zu sich selbst und allen anderen Menschen verloren und empfindet sich und seine Umwelt als dinghaft.[4]
2.2 Entfremdungstheorie nach Karl Marx
Marx beschreibt den Menschen, im Besonderen den Arbeiter, durch das Aufkommen des Kapitalismus und dem mit ihm verbundenem Privateigentum und der Arbeitsteilung als einen entfremdeten Menschen. Der Arbeiter kann sich nicht mehr mit dem Produkt seiner Arbeit identifizieren, da es nicht mehr ihm, sondern dem Kapitalisten gehört und er durch die Arbeitsteilung den gesamten Ablauf des hergestellten Produktes nicht mehr überblicken kann. „Das Produkt der Arbeit ist die Arbeit, die sich in einem Gegenstand fixiert, sachlich gemacht hat, es ist die Vergegenständlichung der Arbeit. Die Verwirklichung der Arbeit ist ihre Vergegenständlichung. Diese Verwirklichung der Arbeit erscheint im nationalökonomischen Zustand als Entwirklichung des Arbeiters, die Vergegenständlichung als Verlust und Knechtschaft des Gegenstandes, die Aneignung als Entfremdung, als Entäußerung.“[5]
Marx geht noch weiter. Wenn das Produkt der Arbeit den Arbeiter entfremdet, dann ist auch die ganze Tätigkeit der Arbeit an sich dem Arbeiter fremd. „Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. [...] Endlich erscheint die Äußerlichkeit der Arbeit für den Arbeiter darin, dass sie nicht sein eigen, sondern eines anderen angehört.“[6]
Die letzte Konsequenz in der Marxschen Entfremdungsanalyse besagt, dass der Mensch durch die Entfremdung des Produktes seiner Arbeit und der Arbeit an sich sich auch seinem Gattungswesen entfremdet. Das Gattungswesen des Menschen ist für Marx die „freie bewußte Tätigkeit.“[7] Der Mensch ist ein Gattungswesen, da er sich über seine Tätigkeiten bewusst ist. Seine Tätigkeiten sind die Spiegelung seiner Wünsche, seines Wollens. Ein Tier produziert auch Produkte zum Überleben, jedoch nur unmittelbar für die in dem Moment physisch nötigen Bedürfnisse. Ein Mensch dagegen produziert auch unabhängig von seinen physischen Bedürfnissen, seine Tätigkeiten sind „universell“. Er bearbeitet die Natur nach seinen Wünschen und spiegelt sich in ihr. Die Bearbeitung der Natur, kurz gesagt die Arbeit, gehört also zu seinem Gattungsleben. Wenn die Arbeit eine entfremdete ist, dann ist der Mensch auch seinem Gattungswesen entfremdet. Durch die entfremdete Arbeit ist der Mensch also von sich selbst, von den Dingen, von anderen Menschen und letztlich seinem Gattungswesen entfremdet.[8]
2.3 Das Wesen oder die „Situation des Menschen“ nach Erich Fromm
Wenn man behauptet, der Mensch habe sich entfremdet, dann muss es folglich einen „menschlichen Normalzustand“ geben, von dem man sich entfremden kann. Fromm beschreibt diesen Normalzustand als die „Situation des Menschen“.[9]
Der Mensch ist seinem physiologischen Aufbau nach den Tieren zugehörig. Jedoch unterscheidet er sich in einem wesentlichen Merkmal von ihnen. Er war sich irgendwann über seine eigene Existenz bewusst. Seine Taten waren nun nicht mehr von der Natur geleitet, heißt, von seinen Instinkten, sondern von ihm selbst. Der Mensch nimmt sich seither als eigenständiges und somit getrenntes Wesen wahr. Getrennt von anderen Menschen und von der Natur. Die Individualisierung hatte begonnen und mit ihr die Entwicklung der menschlichen Vernunft und die Vorstellung von einem freien Willen. Seitdem steckt der Mensch sein ganzes Leben über in dem Zwiespalt, zur Natur zu gehören und sich dennoch von ihr abzusondern. Er kann sich seiner Vernunft nicht mehr entledigen, sondern muss versuchen, durch sie die Natur und sich selbst zu beherrschen.[10]
Wenn die existentiellen Bedürfnisse eines Tieres, wie z. B. Nahrung oder Sex, befriedigt sind, dann ist auch das Tier befriedigt. Der Mensch benötigt zwar ebenfalls die Befriedigung dieser animalischen Grundbedürfnisse, jedoch macht ihn diese allein nicht zufrieden und glücklich. Er benötigt mehr. Seine rein menschlichen Bedürfnisse müssen ebenfalls befriedigt werden.[11]
Die stärkste Kraft, von der der Mensch angetrieben wird, ist die Überwindung der Dichotomie[12] seiner Existenz. Er möchte die Unbeschwertheit eines Tieres zurück erlangen und dennoch sich und seine Umwelt verstehen und beherrschen. Er ist verdammt dazu zu versuchen, seine verlorene animalische (natürliche) Harmonie durch eine neue menschliche zu ersetzen. Dies ist seine „menschliche Situation“. Alle Menschen aller Kulturen haben das gleiche Ziel: das Auffinden einer Lösung dieses Problems.[13]
Im folgenden werde ich die Auffassung Fromms über die „menschliche Situation“ näher erläutern:
Bedürfnis nach Bezogenheit
Da der Mensch sich darüber bewusst ist, aus der Einheit mit der Natur herausgeworfen worden zu sein und sich somit einsam und abgesondert fühlt, muss er sich mit anderen Menschen wieder neu verbinden. Dies geschieht entweder durch Liebe oder Sadomasochismus.[14] [15]
Sadomasochismus:
Ein masochistischer Mensch versucht sich mit einem anderen zu verbinden, indem er sich einer höheren Macht unterwirft, z. B. einem Führer, einem Gott, einem Sadisten. Der sadistische Mensch muss Macht über andere Menschen ausüben, um sich mit ihnen verbunden zu fühlen. Die Verbundenheit von Masochisten und Sadisten hat nichts mit Liebe zu tun. Sie ist eine gegenseitige Abhängigkeit unter Verlust der eigenen Integrität und Individualität.[16] Wenn die Definitionen in Punkt 1.1 von dem Begriff „Entfremdung“ also zustimmen, so kann man sagen, dass ein sadistischer oder masochistischer Mensch ein entfremdeter ist, da sein Wille und sein Handeln abhängig ist von der Person oder den Personen, mit der bzw. denen er eine Symbiose eingegangen ist.
Liebe:
Die einzige Möglichkeit der Verbindung zu anderen ohne Verlust der eigenen Integrität und Individualität ist die Liebe. Dabei ist die Liebe nicht ein von einem Objekt oder von einer Person abhängiger Zustand, sondern sie ist eine produktive und alle Lebewesen mit einschließende Tätigkeit.[17] „Liebe ist [...] die tätige und kreative Bezogenheit des Menschen zu seinem Mitmenschen, zu sich selbst und zur Natur.“[18] Tätig sein bedeutet dabei mehr als einfach nur etwas zu tun, z. B. ein Buch lesen oder sich mit jemandem unterhalten. Tätig sein ist die innere Aufnahme und Auseinandersetzung mit dem, was ich in jedem Moment erlebe. „Es bedeutet, sich selbst zu erneuern, zu wachsen, sich zu verströmen, zu lieben, das Gefängnis des eigenen isolierten Ichs zu transzendieren, sich zu interessieren, zu lauschen, zu geben.“[19] Man kann auch tätig sein, ohne sich zu bewegen, z. B. indem man meditiert.[20] Um nicht entfremdet zu sein, muss ein Mensch also lieben können.
Liebe durch Tätigsein nennt Fromm die „produktive Orientierung“. Die Anwendung dieser teilt er auf drei Bereiche auf: den Bereich des Denkens, des Handelns und des Fühlens.
Bereich des Denkens: Der Mensch muss seine Vernunft ausbilden um durch sie die Welt richtig erfassen zu können und sich keinen Illusionen mehr hingeben zu müssen.
Bereich des Handelns: Durch „produktive Arbeit“ ist der Mensch tätig, kann er also sich selbst transzendieren. Produktive Arbeit meint dabei, etwas vollständig aus eigener Kraft herzustellen. Beispielhaft dafür ist künstlerisches oder handwerkliches Arbeiten.
Bereich des Fühlens: Der Mensch muss sich durch die Liebe mit anderen Menschen und der Natur wieder neu verbinden, ohne dabei seine Integrität und seine Freiheit zu verlieren.[21]
Liebe hat allerdings, wie oft irrtümlich angenommen, nichts mit einem bestimmten Objekt oder einer einzigen auserwählten Person zu tun. Wer nur eine Person „liebt“ und allen anderen Menschen gleichgültig gegenüber steht, liebt nicht wirklich, sondern führt eine symbiotische[22] Beziehung. Liebe produktive Tätigkeit, die man erlernen und ausüben muss. Liebe ist eine Kunst und nicht ein zufälliges Glück, welches jemandem widerfährt. Die Auffassung, man müsse „nur auf den Richtigen warten, ist daher ein Trugschluss. „Wenn ich zu einem anderen sagen kann: „Ich liebe dich“, muss ich auch sagen können: „Ich liebe in dir auch alle anderen, ich liebe durch dich die ganze Welt, ich liebe in dir auch mich selbst.““[23] [24]
Bedürfnis nach Transzendenz
Der Mensch ist, wie alle anderen lebenden Wesen auch, ein natürliches Geschöpf. Er wird geboren, muss eine Zeit lang leben und dann sterben. Doch da der Mensch sich dessen durch seine Vernunft und sein Vorstellungsvermögen bewusst ist, kann er dies nicht passiv über sich ergehen lassen. Er hat das Bedürfnis nach Transzendenz. Das heißt, er möchte über seine Natur hinaus gehen, seine Passivität überwinden und in Aktivität umwandeln und somit selber zum Schöpfer werden. Er möchte und kann nicht mehr von der Natur bestimmt werden, sondern er muss nach seinen eigenen Zielen frei entscheiden. Diesen Drang befriedigt er z. B., indem er bewusst Kinder zeugt, Kunstwerke schafft, den Boden kultiviert, Dinge produziert oder sich Fragen über das Wesen der Dinge oder den Sinn des Lebens stellt.[25]
Wenn ein Mensch, aus welchem Grund auch immer, nicht in der Lage ist, sich schöpferisch zu betätigen, dann hat er eine weitere Möglichkeit, um seine natürliche Passivität zu überwinden: die Zerstörung. Allerdings führt diese Möglichkeit zu Leid, während der erste Weg dem Menschen Glück bereitet.[26]
Bedürfnis nach Verwurzelung
Der Mensch hat seine natürlichen Wurzeln verloren, als er anfing, sich selbst und die Natur zu reflektieren. Er hat seine selbstverständliche Zugehörigkeit zur Natur verloren. Er kann aber nicht ganz auf sich gestellt in der Welt leben, ohne jegliche Wurzeln, ohne Heimat, dann würde er verrückt werden. Um auf seine natürlichen Wurzeln verzichten zu können, muss er sich daher neue Wurzeln suchen: menschliche.[27]
Die erste natürliche Verbindung, welcher jeder Mensch einmal hatte, ist die Mutterbindung. Durch sie ist das erste, was der Mensch auf der Welt erfährt, bedingungslose Liebe und allumfassender Schutz (im glücklichen Fall [Anm. d. Verf.]). Der Mensch bekommt in seinem ersten Lebensjahr das Gefühl zu Hause zu sein, verwurzelt bei und mit seiner Mutter. Als Heranwachsender muss er sich jedoch mehr und mehr von seiner Mutter lösen. Aber er behält immer die „Sehnsucht nach jenem Zustand“, nach der „vorindividuelle[n] Existenz des Einsseins mit der Natur.“[28] Der Mensch muss sich von seinen natürlichen, oder anders ausgedrückt, von seinen „inzestuösen“ Bindungen lösen, um Individualität zu erlangen und seine Vernunft zu entwickeln. Ansonsten würde er für immer ein Kind bleiben .[29] Weitere inzestuöse Bindungsinstitutionen wären z. B. die Familie, die Sippe, der Staat oder die Nation. Diese Form der Bindung ist eine Möglichkeit, doch sie hindert den Menschen am individuellem Wachstum.[30]
Eine andere Form der Verwurzelung ist die „Brüderlichkeit“. Wenn der Mensch erkennt, dass alle Menschen denselben Ursprung haben, man könnte auch sagen, dieselbe Mutter; wenn er erkennt, dass jeder den gleichen menschlichen Kern und das Recht auf „Liebe und Glück“ hat, dann wäre die Verwurzelung menschlich.[31]
Da die Frauen der Teil der Menschheit sind, der schwanger werden und Kinder gebären kann und diese dann in der ersten Zeit aufziehen muss, sind sie stärker mit der Natur verwurzelt als Männer. Sie sind von Natur aus Schöpferinnen. Um diesen Unterschied auszugleichen, schafften sich die Männer eine eigene Welt mit ihren eigenen Ideen und Prinzipien. Man kann auch sagen, wie wurden schöpferisch, indem sie Ideen in die Welt gebaren. Durch diese Welt ersetzten sie ihre verlorene Bindung an die Natur, die einst ihr Ursprung war und ihnen Sicherheit gab.[32]
Das Positive des Matriarchats ist „ein Gefühl der Lebensbejahung, der Freiheit und Gleichheit [...].“, das Negative ist die Verhinderung der Entwicklung der Individualität und Vernunft der Menschen.[33] Das Positive des Patriarchats ist die Vernunft, die Disziplin, das Gewissen und der Individualismus. Das Negative ist die Hierarchie, die Unterdrückung, die Ungleichheit und die Unterwerfung.[34] Nach diesem Muster erziehen Eltern auch ihre Kinder, wodurch diese wiederum ein mütterliches und ein väterliches Gewissen bekommen. Das mütterliche Gewissen verzeiht jeden Fehler und vermittelt bedingungslose Liebe. Das väterliche Gewissen lobt und tadelt, und seine Zufriedenstellung ist an die Erfüllung seiner Bedingungen geknüpft. Um sich selbst und seine Mitmenschen gerecht beurteilen zu können, sollten beide Gewissensanteile miteinbezogen werden. Ansonsten ist die Beurteilung entstellt.[35]
Bedürfnis nach Identitätserleben
„Identität ist das Bewusstsein, ein unverwechselbares Individuum mit einer eigenen Lebensgeschichte zu sein, in seinem Handeln eine gewisse Konsequenz zu zeigen und in der Auseinandersetzung mit anderen eine Balance zwischen individuellen Ansprüchen und sozialen Erwartungen gefunden zu haben.“[36]
Lediglich der Mensch begreift sich als „Ich“. Er versteht seine Mitmenschen als getrennte Subjekte, die in der Lage sind, individuell zu handeln. Auch er selbst muss das Gefühl haben, ein Subjekt zu sein, das selbstbestimmt agieren kann. Er braucht eine Identität.
Bevor der Mensch einen gewissen Grad an Individuation erreicht hatte, hat er sich z.B. über seinen Clan definiert oder über seine wirtschaftliche Stellung. Im Mittelalter definierte man sich beispielsweise nicht als ein Mensch, der das Backhandwerk ausübt, sondern als Bäcker.
Durch die Abschaffung des Feudalismus und die Industrialisierung wurde das Individuum politisch und wirtschaftlich befreit. Nun hat jeder die Möglichkeit, eine individuelle Identität zu entwickeln, doch diese Freiheit verursacht Unsicherheit und Angst. Viele Menschen versuchen daher, sich über Herdenkonstrukte zu definieren, etwa über die Nation, den Berufsstand oder eine bestimmte Subkultur - sie sind dann „Deutscher“, „xy“ oder „Punker“.
Mit einer Gruppe konform zu gehen ist eine Möglichkeit Identität zu erfahren, jedoch unter Verlust seiner Individualität. Man ist nicht „Ich“, sondern „Wir“.[37]
Bedürfnis nach einem Rahmen der Orientierung und einem Objekt der Hingabe
Da der Mensch mit Vernunft ausgestattet ist, muss er alle Dinge, die ihm auf der Welt begegnen und ihm erstmal höchst seltsam vorkommen, in eine gewisse Beziehung zueinander bringen. Er braucht ein System, mit dem er sich in der Welt zurechtfinden kann, durch das sein Handeln nicht völlig orientierungslos wird. Bevor der Mensch sich selbst als „Ich“ erkannte, hat die Natur ihm den Rahmen der Orientierung geliefert. Nun weiß er sich als selbstständig denkendes und handelndes Individuum und muss sich selbst einen Orientierungsrahmen suchen. Dieser Rahmen muss subjektiv für ihn Sinn machen, er muss allerdings keine allgemeingültige Wahrheit beinhalten. Z. B. kann der Mensch an die Wiederauferstehung der menschlichen Seele glauben oder daran, dass er von Grund auf schlecht ist oder auch an die unhinterfragbare Allmacht der freien Marktwirtschaft. Der Orientierungsrahmen kann rational oder irrational begründet sein. Rational wäre er, wenn der Mensch die Dinge objektiv, heißt vernünftig, sieht und deren Erscheinung nicht durch seine Wünsche und Ängste verfärbt.[38]
Da der Mensch aber nicht nur aus seinem Verstand, sondern auch aus seinem Körper mit Gefühlen besteht, reicht es nicht aus, wenn er nur ein intellektuelles Konstrukt über die Ordnung der Welt in seinem Kopf hat. Er braucht auch ein Objekt der Hingabe, dem er sich mit seinem ganzen Wesen widmen kann, durch das er sich transzendieren kann. Dieses Objekt der Hingabe kann z. B. ein Ziel, eine Idee oder eine Macht sein.[39]
Fromms These von den Grundbedürfnissen eines Menschen kann man auf einen kurzen Nenner bringen: der Mensch muss Liebe erfahren, aktiv als auch passiv, um nicht entfremdet, sadomasochistisch, irrational, destruktiv, inzestuös und konform zu sein.
3. Heutige Situation: Entfremdung...
Wie sieht es im 21. Jahrhundert mit der Entfremdung des Menschen aus? Gibt es Hinweise, dass dieses Phänomen überhaupt zutrifft? Und wenn es zutrifft, wie macht sich die Entfremdung des Menschen bemerkbar?
Diesen Fragen werde ich in diesem Kapitel nachgehen. Ich habe dieses Kapitel in drei Teile gegliedert: 1. Die Entfremdung von sich selbst, 2. Die Entfremdung von anderen und 3. Die Auswirkungen auf die Natur/ Umwelt.
3.1 ...von sich selbst
3.1.1 Marketing-Charakter
Der industrialisierte Mensch fühlt sich heutzutage nur noch als Produkt, als Mix verschiedener Qualitäten, die es bestmöglich auf dem Warenmarkt zu verkaufen gilt. Fromm nennt dies die „Marketing-Orientierung“. Der Mensch dieser Orientierung besteht aus mehreren Hüllen, jedoch ohne Kern. Er ist Bäcker, Vater, Radfahrer, Biertrinker, Hebamme, Arbeitsloser, Spieler etc., aber er ist nicht einfach Mensch. Qualitäten wie Flexibilität, Ehrlichkeit, Ehrgeiz, Offenheit, Persönlichkeit u.s.w. sind das Kapital, welches als Tauschwaren-Mix die Identität des heutigen Menschen darstellen.[40] „Der Mensch kümmert sich nicht mehr um sein Leben und sein Glück, sondern um seine Verkäuflichkeit.“[41]
Ein Beispiel für die Marketing-Orientierung sind Profil-Anforderungen in Stellenanzeigen: „Sie sollten über eine gute Organisationsfähigkeit, Kundenorientierung und Zielstrebigkeit verfügen.“[42], oder „Wir suchen [...] mit folgender Qualifikation: [...] persönliches und fachliches Engagement [...] Verantwortungsbewusstsein, Kreativität und Teamfähigkeit [...] Spaß an der Arbeit“[43], oder „ Zu den Voraussetzungen gehören: [...] gute Umgangsformen, gepflegtes Äußeres und freundliches Auftreten werden erwartet“[44], oder „Sie sollten sein: pünktlich, zuverlässig, ordnungsliebend“[45] Bei diesen Profilbeispielen wird deutlich, dass ein Bewerber seinen Charakter auf dem Arbeitsmarkt anbieten und „verkaufen“ muss.
Ich möchte ein weiteres Beispiel hinzufügen, die sogenannten „Singlebörsen“. Hier werden Menschen auf ein paar wenige Charakterzüge und Eigenschaften reduziert. Diese Merkmal werden an der „Singlebörse“ angeboten mit der Hoffnung, ein „gutes Geschäft“, heißt, einen Lebenspartner, den man lieben und von dem man geliebt werden möchte, abzuschließen. Jedoch kann meiner Meinung nach eine Liebe, welche mit einem „guten Geschäft“ gleichgesetzt wird, nur eine entfremdete sein.
Auch die Vielzahl an Schönheitsoperationen in Deutschland lassen sich mit Fromms Theorie der Marketing-Orientierung deuten. Das Aussehen eines Menschen ist heutzutage sein Kapital. Um dieses Kapital zu vergrößern, nehmen viele Menschen schwierige Operationen und die damit einhergehenden Risiken in Kauf. Die Menschen haben den Drang, ihren Körper zu verändern. Sie scheinen sich in ihm fremd zu fühlen.
Leider gibt es in Deutschland keine offiziellen Erhebungen über die Gesamtzahl der durchgeführten Schönheitsoperationen pro Jahr. Es gibt lediglich eine Schätzung der GÄCD (Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie Deutschland e.V.), wonach es 2006 400.000 Schönheitsoperationen in Deutschland gab. Bei dieser Schätzung sind Faltenbehandlungen ausgenommen.[46]
3.1.2 Haben und Sein
Nach einer weiteren Theorie von Fromm gibt es zwei Existenzweisen, die des Habens und die des Seins. Die meisten Menschen der Industrieländer leben nach der Existenzweise des Habens. Sie sind bestrebt, etwas zu erwerben, um es zu besitzen und diesen Besitz zu vermehren. Es ist dabei nicht so von Bedeutung, ob der Besitz wirklich vom Besitzer gebraucht oder genutzt wird. Er kann mit ihm machen, was er will, denn er hat das ausschließliche Recht dazu.[47]
Diese Menschen identifizieren sich mit ihrem Besitz. Sie sind ihr Besitz. Ihr Eigentum bildet ihre Identität. Da die Objekte der Begierde, welche in den Besitz übergehen, meist gar nicht benötigt werden, sind sie tote Objekte und die Beziehung zwischen dem Besitzer und den Objekten ist eine leblose.[48]
Fromm nennt das auch das charakterbedingte Haben. Ihm gegenüber stellt er das funktionale Haben. Hierbei gehen nur Sachen in den Besitz eines Menschen über, die er existentiell benötigt, z. B. Werkzeug, ein Haus, Kleidung. Das funktionale Haben ist naturbedingt notwendig und steht in keinem Konflikt zum Sein. Das charakterbedingte Haben und die Existenzweise des Seins schließen sich aus.[49]
Die beiden Existenzweisen haben eine unterschiedliche Basis. Die des Habens ist auf Dinge bezogen, die des Seins auf Erlebnisse. Daher ist es schwer die Existenzweise des Seins zu beschreiben, denn Erlebnisse sind nur subjektiv erfahrbar.[50] [51]
Um die Existenzweise des Seins leben zu können, muss der Mensch frei, unabhängig und mit kritischer Vernunft ausgestattet sein. Menschen, welche nach dieser Existenzweise leben, sind tätig. Doch ihre Tätigkeit ist nicht bloß auf das Bewegen ihrer Körper oder ihrer Gehirnzellen reduziert, sondern sie ist allumfassend, sie ist der „produktive Gebrauch der menschlichen Kräfte.“[52] Sie ist mehr eine innere Tätigkeit, das Auseinandersetzen mit sich selbst und seiner Umwelt, welche auf ständige Erneuerung des eigenen Selbst hinausläuft.[53]
3.1.3 Stadtkinder, Naturabenteuer und Medienkonsum
Ich möchte diese Thematik mit den Aussagen von Stadtkindern, die zu Besuch auf einem Schulbauernhof waren, einführen:
„Warum habt ihr denn Eier in den Hühnerstall gelegt? Ein anderes Mal sagte ein Junge zu mir (während er das Schaf streichelte): Der Hund hat aber ein weiches Fell.“[54]
Leider gibt es heutzutage Kinder, die nicht wissen, dass Kühe nicht lila sind und wo die Milch herkommt. Sie wachsen in einem „naturfernen Großstadtmilieu“ auf, umgeben von Beton. In ihrer Freizeit gucken sie häufig fern oder spielen Computerspiele.[55] Durch die Konsummentalität der meisten Menschen werden Kinder mit Spielen überhäuft. Kinder übernehmen diese Mentalität, spielen ein paar Tage mit ihren neuen Spielsachen, doch dann werden diese schnell wieder langweilig. Ein gemeinsam mit anderen Kindern und/oder Erwachsenen erlebtes reales Abenteuer würde dem Kind dagegen nicht so schnell langweilig werden. Es würde sich noch lange damit beschäftigen. Kinder brauchen Abenteuer, dass wissen auch die Computerspielhersteller und Filmproduzenten und nutzen diesen Absatzmarkt. Sie stellen Filme und Computerspiele her, die speziell auf Kinder zugeschnitten sind. Doch die Wirkung dieser Medien ist für eine gesunde Kinderentwicklung hinderlich. Den Kindern fehlen durch den häufigen Medienkonsum die Erfahrungen aus erster Hand. Je mehr sie fernsehen und computerspielen, desto weniger können sie reale Abenteuer erleben und somit sich selbst und die Umwelt kennenlernen. Außerdem sind die Erlebnisse, die die Medien vermitteln, von den Herstellern vorgeben, die Kinder können also nicht selber eingreifen und den Ablauf der Handlung spontan ändern. Die Kinder verlieren somit ihre Spontanität und die Möglichkeit, sich an der Realität zu messen. Dieses Messen an der Realität ist jedoch besonders wichtig für den Aufbau des Selbstbewusstseins eines Kindes.[56]
Aber wo kann das Kind in der Stadt noch Abenteuer erleben? An vielen Plätzen ist es gefährlich für Kinder oder sogar verboten zu spielen. Am geeignetsten für ein Abenteuer wäre die unberührte Natur als Spielplatz, denn ein Kind „braucht Tiere, überhaupt Elementares, Wasser, Dreck, Gebüsche, Spielraum.“[57]
3.2 ...von anderen Menschen
3.2.1 Individualisierung
„ Individualisierung bedeutet, dass das Individuum zentraler Bezugspunkt für sich selbst und die Gesellschaft wird.“[58]
Durch die Individualisierung steht also nicht mehr die Gesellschaft im Mittelpunkt, sondern der einzelne Mensch. Ein Beispiel dafür sind die Menschenrechte, welche für jeden einzelnen Menschen auf der Welt gelten, egal welcher Gemeinschaft er angehört.
Die heute sehr weit fortgeschrittene Individualisierung hat für die Menschen der Industrienationen Vorteile, aber auch Nachteile. Die Menschen sind befreit von den Zwängen der Traditionen. Sie können selbst entscheiden, z.B. welchen Beruf sie ergreifen möchten oder welche Lebensform sie bevorzugen, z. B. ob Eheleben oder Singledasein. Es gibt keine traditionelle Vorherbestimmtheit mehr, jeder ist frei selbst zu bestimmen, wie er leben möchte.[59]
Andererseits hat der Mensch heute nicht nur die Wahl zu entscheiden, sondern er muss sich entscheiden. Das kann auch eine große Last für das Individuum sein. Jeder ist verantwortlich für alles, was er tut und muss sich selbstständig um die Tätigkeiten seines Lebens und die Erfüllung seiner Wünsche kümmern. Das bedeutet, dass jeder auch die mehr oder weniger großen Risiken seiner Entscheidungen zu tragen hat.[60] Im 21. Jahrhundert ist das individuelle Risiko, das es zu tragen gilt, aber nicht mehr das einzige Problem, das auf dem Individuum lastet.
[...]
[1] vgl. FROMM, 2007, S. 124
[2] vgl. JAEGGI, 2005, S. 21-22
[3] JAEGGI, 2005, S. 23
[4] vgl. FROMM, 2006, S. 107
[5] MARX, 1844, S. 511-512: http://www.marxists.org/.../index.htm (01.11.09)
[6] MARX, 1844, S. 514: http://www.marxists.org/.../index.htm (01.11.09)
[7] MARX, 1844, S. 516: http://www.marxists.org/.../index.htm (01.11.09)
[8] Vgl. MARX, 1844, S. 517: http://www.marxists.org/.../index.htm (01.11.09)
[9] vgl. FROMM, 2006, S. 26
[10] vgl. FROMM, 2006, S. 26-27
[11] vgl. FROMM, 2006, S. 28-29
[12] Aufteilung in zwei Mengen, die nicht miteinander vereinbar sind
[13] vgl. FROMM, 2006, S. 31-32
[14] vgl. FROMM, 2006, S. 32 ff.
[15] Ich denke, er muss sich nicht nur mit anderen Menschen wieder neu verbinden, sondern mit allem Existierendem überhaupt.
[16] vgl. FROMM, 2006, S. 33-34
[17] vgl. FROMM, 2006, S. 34
[18] FROMM, 2006, S. 34
[19] FROMM, 2009, S. 110
[20] vgl. FROMM, 2009, S. 110
[21] vgl. FROMM, 2006, S. 34
[22] Das bedeutet, dass man nur aus gegenseitiger Nützlichkeit miteinander zu tun hat. Ist der andere einem nicht mehr nützlich wird das gegenseitige Verhältnis wertlos.
[23] FROMM, 2007, S. 59
[24] vgl. FROMM, 2007, S. 58-59
[25] vgl. FROMM, 2006, S. 38
[26] vgl. FROMM, 2006, S. 38-39
[27] vgl. FROMM, 2006, S. 39-40
[28] vgl. FROMM, 2006, S. 40-42
[29] vgl. BACHOFEN, 1954 in: FROMM, 2006, S. 45
[30] vgl. FROMM, 2006, S. 42
[31] vgl. FROMM, 2006, S. 55
[32] vgl. FROMM, 2006, S. 46
[33] vgl. FROMM, 2006, S. 45
[34] vgl. FROMM, 2006, S. 47
[35] vgl. FROMM, 2006, S. 47-48
[36] ABELS, 2006, S. 254
[37] vgl. FROMM, 2006, S. 58-60
[38] vgl. FROMM, 2006, S. 60-61
[39] vgl. FROMM, 1982, S. 31
[40] vgl. FROMM, 2006, S. 124-125; FROMM, 2009, S. 180
[41] FROMM, 2009, S. 181
[42] vgl. JOBBOERSE DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT: http://jobboerse.arbeitsagentur.de/.../stellenangeboteFinden.html?execution=e1s2&benc=7zGlPQw7OvMPD2bwiDH3rEsF38RYwfK2lwLtZXwCBrY6GoibTQj5AA%3D%3D&benc=LAfKxUEj92WcUrsqboICO%2FohoO7XvvgfSNRw%2FubARe9NKIACf2I4Zg%3D%3D (3.11.09)
[43] vgl. JOBBOERSE DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT: http://jobboerse.arbeitsagentur.de/.../stellenangeboteFinden.html?execution=e1s2&benc=NK3BMkqvaKoWbT4X4SBDLu64RulUgesvNwJldGdS1Q7gpaJgu0z3TQ%3D%3D&benc=hfpiFFDwGBwAYJOoZOcsDUAed%2FkIm6cC4CKuwt84VsFnEQ1NaAJlAg%3D%3D (3.11.09)
[44] vgl. JOBBOERSE DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT: http://jobboerse.arbeitsagentur.de/.../stellenangeboteFinden.html?execution=e1s3&benc=RH6icIECSBFdL6gkfQVJgVF%2FUOU0OHtlSSgqioZprn9IblkXXQERiQ%3D%3D&benc=COSaImkclqe0uIqxMy73haU%2Bq59IB9ahR7vnaCVHmFxVn5sXz8CECA%3D%3D (3.11.09)
[45] vgl. JOBBOERSE DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT: http://jobboerse.arbeitsagentur.de/.../stellenangeboteFinden.html?execution=e1s3&benc=sTuz0IygpKezXO0lSU2%2B%2B%2F0MWZd6MDxvzwcyZxgK%2BWR9k1odY8VFMw%3D%3D&benc=F%2F7gD1HmcOg1ZOa%2Fr6Sy6FscSgRvLtZuqW45bZKLRcNDobs7kbS1oQ%3D%3D (3.11.09)
[46] vgl. GESELLSCHAFT FÜR ÄSTHETISCHE CHIRURGIE DEUTSCHLAND: http://www.gacd.de/.../2007-09-14-statistik-schoenheits-op-2006.html (20.11.09)
[47] vgl. FROMM, 2009, S. 89-90
[48] vgl. FROMM, 2009, S. 98-99
[49] vgl. FROMM, 2009, S. 108
[50] vgl. FROMM, 2009, S. 109
[51] [Anm. d. Verf.]: Heutzutage sind die meisten Erlebnisse nicht mehr echt. Wir schauen uns täglich mehrere Stunden eine Scheinwelt im Fernsehen oder im Kino an, gehen in den Zoo, in Freizeitparks oder zu sonstigen „Erlebnisstätten“. Jedoch sind die dort erfahrenen Erlebnisse inszeniert und meist spontan nicht beeinflussbar. Sie haben also nichts mit einem echten und natürlichen Erlebnis zu tun.
Das viele nicht mehr in der Lage sind mit anderen Menschen ein Erlebnis ohne „Erlebnisstätten“ zu erfahren, dieses aber dennoch ersehnen, zeigt die riesige Anzahl an Wirtshäusern in Deutschland. Hier versuchen die Menschen echte zwischenmenschliche Erlebnisse zu erfahren, was ihnen jedoch nur mit dem Hilfsmittel Alkohol, meist gepaart mit Nikotin, gelingt.
[52] FROMM, 2009, S. 110
[53] vgl. FROMM, 2009, S. 110
[54] Interview per e-mail mit Cathy von Rantzau, Schulbauernhof Helle e.V., 08.09.09
[55] vgl. HEDEWIG, 2000, S. 3
[56] vgl. LANG, 2006, S. 19-21
[57] Mitscherlich, 1965, S. 24 in: Gebhard, 2009, S. 74
[58] JUNGE, 2002, S. 7
[59] vgl. JUNGE, 2002, S. 12
[60] vgl. JUNGE, 2002, S. 12-13
Details
- Titel
- Begegnungsstätte Bauernhof
- Untertitel
- Ein sozialpädagogischer Lösungsansatz für eine entfremdete Gesellschaft im 21. Jahrhundert
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 101
- Katalognummer
- V228142
- ISBN (eBook)
- 9783842806658
- Dateigröße
- 2648 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- entfremdung marx fromm soziale landwirtschaft bauernhof
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2010, Begegnungsstätte Bauernhof, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/228142

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.


