Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos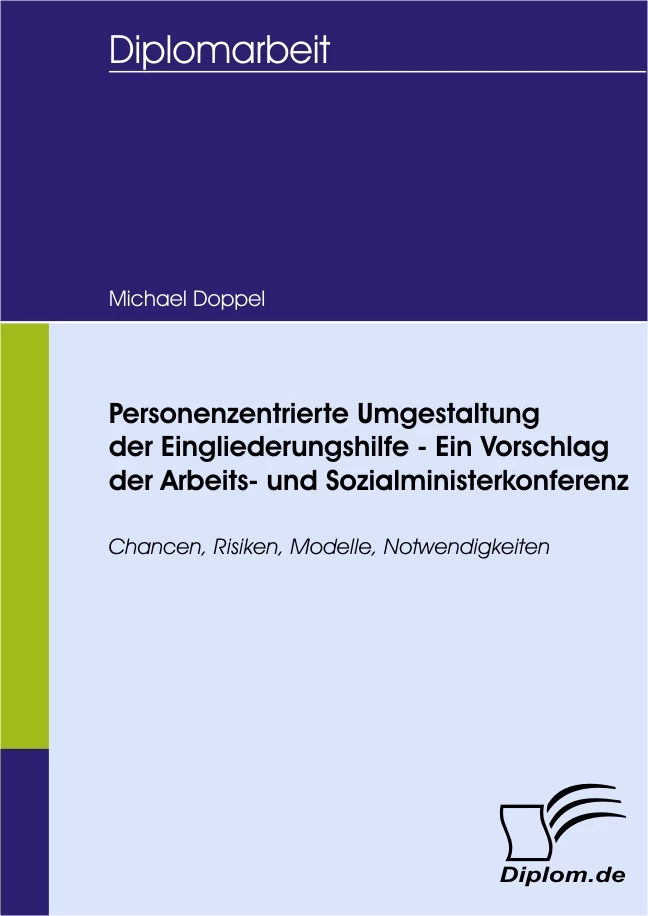
Personenzentrierte Umgestaltung der Eingliederungshilfe - Ein Vorschlag der Arbeits- und Sozialministerkonferenz
Diplomarbeit, 2010, 135 Seiten
Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Fachhochschule Erfurt (Sozialwesen, Studiengang Soziale Arbeit und Sozialpädagogik)
Note
1,0
Leseprobe
Inhalt
Eidesstattliche Erklärung zur Diplomarbeit
Vorwort
Einleitung
1. Die Vorschläge der Arbeits- und Sozialministerkonferenz
1.1. Hintergrund: UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen
1.2. Kernaussagen der ASMK zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
2. Bedarfsermittlung und Teilhabemanagement
2.1. Personenzentrierte Teilhabeleistung
2.1.2. Der Personenzentrierte Ansatz
2.2. Hilfebedarfsermittlung
2.2.1. Anforderungen nach dem Personenzentrierten Ansatz
2.2.2. Ergänzende Anforderungen
2.2.2.1. Exkurs: Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe
2.2.2.2. Bedeutung und Potential sozialräumlicher Methoden für die Behindertenhilfe
2.2.2.3. Risiken
2.2.2.4. Notwendigkeiten
2.2.3. Konsequenzen für die Hilfeplanung
2.2.4. Zusammenfassung
2.3. Verfahren und Instrumente der Hilfeplanung
2.4. Kritische Würdigung der Verfahren
2.4.1. „Metzler-Verfahren“
2.4.2. Integrierter Behandlungs- und Rehabilitationsplan
2.4.3. Individueller Hilfeplan
2.4.4. Integrierte Teilhabeplanung
2.4.5. Teilhabeplanung Rheinland-Pfalz
2.5. Auswertung
3. Widerstände
4. Personenzentrierte Finanzierung
4.1. Finanzierungsumstellung mittels Budgets
4.2. Finanzierungsmodelle (best practice)
4.2.1. Beispiel: Finanzierungsumstellung im Bereich der Eingliederungshilfe für psychisch behinderte Menschen in der Region Rostock
4.2.2. Beispiel „Community Care“ der Evangelischen Stiftung Alsterdorf
4.2.3.: Beispiel: Zeitbasierte Finanzierung der Eingliederungshilfe in Erfurt
4.3. Auswertung der Modelle
5. Resümee
Literaturverzeichnis
Anlagen: Die Beschlüsse der ASMK zur Eingliederungshilfe 2007-2009
84. Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2007
85. Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2008
Vorschlagspapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen“ der ASMK
86. Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2009
Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen“ der ASMK
Eidesstattliche Erklärung zur Diplomarbeit
Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig und eigenhändig verfasst und alle verwendeten Mittel kenntlich gemacht habe.
Ich versichere außerdem, dass die vorliegende Arbeit noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt und noch nicht veröffentlicht wurde.
Ilmenau, den 08.02.2010
Michael Doppel
Vorwort
Bemühungen, die Landschaft der „Eingliederungshilfe“ zu verändern, nehme ich wahr, seit ich in dieses Arbeitsfeld involviert bin; das sind nunmehr 19 Jahre. Die Bemühungen gehen dabei von allen Beteiligten aus: Leistungserbringer, Kostenträger, Legislative; viel zu selten auch von den Adressaten der Hilfeform. Die jeweilige Motivation ist dabei sehr unterschiedlich.
Auch das nehme ich wahr: Jedes Bemühen, jede Veränderung, initiiert durch wen auch immer, stößt dabei auf erheblichen Widerstand der jeweils anderen Beteiligten. Und nur selten wird die Motivation für den Widerstand offen geäußert, in der Regel werden formale Gründe vorgeschoben oder es wird verzögert und gebremst. Dazu später mehr.
Die vorliegende Arbeit soll einen winzigen Beitrag dazu leisten, im Interesse der Adressaten der Eingliederungshilfe die Landschaft so zu verändern, dass Hilfen individueller als bisher erbracht werden können.
Diese Diplomarbeit versucht, durch die Beleuchtung von wichtigen Teilaspekten der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe, wie sie von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz vorgeschlagen wurde, die Notwendigkeit und das Potential der angestrebten Entwicklung zu erfassen. Dabei wird Bezug genommen auf die aus Sicht vieler Praktikerinnen dringendsten noch ungeklärten Probleme und deren Lösung sowie aktuell offene Fragen.
Dabei danke ich meinem Arbeitgeber, der Lebenshilfe Ilm-Kreis e.V., für seine Unterstützung in Form von Freistellungen und großzügigeren Terminsetzungen; meiner Frau und meinem Sohn für ihre Rücksichtnahme; meinen KollegInnen für ihre Geduld.
Gender-Hinweis: Im folgenden Text werden männliche und weibliche Bezeichnungen wild durcheinander benutzt. Zum Einen soll so die Lesbarkeit besser als mit der simultanen Nennung beider Formen gewährleistet, gleichzeitig jedoch Diskriminierung vermieden werden. Die Auswahl geschah willkürlich nach Gefühl und Tagesform, man möge mich bitte nicht anhand statistischer Auswertung voreilig in die eine oder andere Schublade stopfen.
Und noch ein Wort zur verwendeten Sprache: Jeder Begriff zur Bezeichnung von Menschen mit anhaltenden Schwierigkeiten im geistigen, körperlichen oder psychischen Bereich ist umstritten. Vorgeschlagene Alternativen, z.B. „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ von people first sind zu verharmlosend, andere, wie „Menschen mit Behinderungserfahrung“ für viele (noch) zu unverständlich. Nutzer, Klientin, erst recht „Kunde“ – auch nach jahrelangem Ringen hat noch niemand eine konsensfähige Lösung. Deshalb habe ich mich entschlossen, angesichts des Umstands, dass vorliegende Arbeit eher von Profis gelesen wird und nur vor dem Hintergrund des deutschen Sozialrechts handelt, die sozialrechtliche Formulierung „Menschen mit Behinderungen[1] “ zu wählen, geht es um die praktische Ebene, greife ich auch auf Nutzer und Klientin zurück.
Etwas abgewichen von der sozialrechtlichen Formulierung bin ich hingegen bei der „seelischen Behinderung“. Da vorliegende Arbeit gewissen Ansprüchen an Wissenschaftlichkeit genügen soll, mir jedoch noch kein überzeugender Beweis für die Existenz der „Seele“ vorliegt, habe ich mich stattdessen für die Bezeichnung „psychische Behinderung“ entschieden.
Einleitung
Kurzer Rückblick: Vor dem Hintergrund der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat die von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (im Folgenden: ASMK) im Jahre 1997 eingesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein Vorschlagspapier zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe erarbeitet. Das Papier wurde von der 85. ASMK im November 2008 angenommen. Die Arbeits- und Sozialminister sehen im Vorschlagspapier „ eine geeignete Grundlage für die weitere Vorbereitung der Reformgesetzgebung und stellen es zur Diskussion“ (ASMK 2008, siehe Anlagen). Die Diskussion hat stattgefunden, alle Verbände von Leistungserbringern, Angehörige und Betroffene haben Stellungnahmen abgegeben.
Am wesentlichsten im Vorschlagspapier erscheint mir der deutlich formulierte Wille, „die Eingliederungshilfe von einer überwiegend einrichtungszentrierten Hilfe zu einer personenzentrierten Hilfe neu auszurichten“ (ASMK-Vorschlag 2008). Diese Neuausrichtung beinhaltet aus praktischer Sicht m.E. vor allem zwei ungeklärte Aspekte, die ich in vorliegender Arbeit erhellen möchte:
Personenzentrierung - Was bedeutet das?
Umstellung der Finanzierung – wie könnte das gehen?
Notwendig erscheint mir das deshalb, weil zwar personenzentrierte Hilfen seit über zehn Jahren um sich greifen, aber
- bisher nahezu ausschließlich im Bereich der Gemeindepsychiatrie,
- dabei bis heute noch nicht flächendeckend,
- oft missverstanden,
- in einigen Regionen nur sehr formal und/oder bruchstückhaft umgesetzt sind und nicht inhaltlich „gelebt“ werden,
- und den Akteuren im weitaus größeren Bereich der Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung zumeist völlig unbekannt sind.[2]
Die 86. ASMK hat aktuell (November 2009) auf Basis der vorangegangenen Diskussionen die Bundesregierung aufgefordert, die von der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe tangierten Gesetzlichkeiten so zu reformieren, dass die Umsetzung der Vorschläge nicht formal behindert wird. Nach Aussage von Ulrich Krüger, Aktion Psychisch Kranke e.V., besteht parteiübergreifender Konsens im Bundestag, diese Gesetzesreform während der aktuellen Legislaturperiode vorzunehmen. Es wird also ernst, auch wenn auf der Ebene, die ich wahrnehme (Einrichtungsleiterinnen, Mitarbeiter, Geschäftsführerinnen) bei Leistungserbringern gegenwärtig eher eine Haltung wie „Abwarten und Tee trinken“ vorzuherrschen scheint.
Im folgenden will ich versuchen zu erhellen, wie vor Ort die praktische Umsetzung erfolgen könnte, ohne dass die Adressaten der Eingliederungshilfe oder die Leistungserbringer bei einer solch tiefgreifenden Reform mit ihren spezifischen Bedürfnissen auf der Strecke bleiben. Aus Sicht der Praxis, sowohl aus Sicht von Leistungserbringern, Kostenträgern wie auch den Adressaten ist die Umsetzung mit zahlreichen Fragen verknüpft. Auf einige, mir besonders schwerwiegend erscheinende, will ich im vorliegenden Text Antworten suchen. Denn für „die Praxis beginnt die Unmöglichkeit oft dort, wo der Wissenschaftler [und der Minister? M.D.] noch nicht einmal ernsthafte Schwierigkeiten sieht“, hat Luhmann einst treffend formuliert (Luhmann 2000, S. 20).
Daneben möchte ich erhellen, was es mit der von der ASMK vorgeschlagenen Sozialraumorientierung auf sich hat. Ist das der gefühlte hundertdreizehnte Paradigmenwechsel der Sozialen Arbeit, gleich nach der Kundenorientierung (Nr. 112)? Und können oder sollten wir das auch aussitzen?
1. Die Vorschläge der Arbeits- und Sozialministerkonferenz
1.1. Hintergrund: UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen
Im März 2009 ist in Deutschland das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte der Menschen mit Behinderungen in Kraft getreten. Dem ging ein jahrelanger Diskussionsprozess auf allen Ebenen voraus.
Der deutschen Übersetzung wurde vorgeworfen, den im englischen Original verwendeten Begriff „Inclusion“ in böser Absicht mit „Integration“ übersetzt zu haben, wovon sich aus einem verbreiteten, unzulässig verkürzten Verständnis von „Integration“ wesentlich weniger Handlungsbedarf für die Bundesrepublik Deutschland ableiten würde. Diese Diskussion will ich hier nicht aufgreifen, denn sei es wie es sei, die ASMK spricht in ihrer Auslegung der Konvention von „Inklusion“ und kommt somit dem Inhalt etwas näher als die offizielle Übersetzung.
In Artikel 19 der „offiziellen“ Übersetzung heißt es unter der Überschrift „ Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft“:
„Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, dass
a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben;
b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig ist;
c) gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen Rechnung tragen.“
In Artikel 27 heißt es zu „Arbeit und Beschäftigung“ u.a.:
„Die Vertragsstaaten erkennen das gleiche Recht behinderter Menschen auf Arbeit an; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen[3] und für behinderte Menschen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wurde. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die während der Beschäftigung eine Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte, einschließlich des Erlasses von Rechtsvorschriften, (…)“
Es würde den Rahmen vorliegender Arbeit sprengen, auch noch weitere Details aus Artikel 27 oder andere wichtige Artikel der Konvention näher zu beleuchten; insbesondere Artikel 24, der sich mit dem Bildungssystem[4] befasst, verdient in Deutschland besondere Aufmerksamkeit.
Die o.g. kurzen Auszüge beinhalten bereits jede Menge Handlungsbedarf. Wenn Menschen mit Behinderungen frei entscheiden, wo und mit wem sie leben und nicht auf besondere Wohnformen verwiesen werden dürfen und sie gleichzeitig ein Recht auf die dann notwendige persönliche Assistenz haben sollen, beinhaltet dieser Punkt allein bereits dramatischen Handlungsbedarf aller Beteiligter im System der Eingliederungshilfe.
Der Originaltext der Konvention erntet von Seiten aller Akteure Lob und Zustimmung und ist ein Meilenstein im Hinblick auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen, auf das vertretene Menschenbild und den davon abgeleiteten gesamtgesellschaftlichen Handlungsbedarf[5]. Die Konvention zeigt eine deutliche Abkehr von der bisher gestatteten Entrechtung von Menschen mit Behinderungen. Artikel 7 der „Erklärung der Rechte geistig behinderter Menschen“ der UN von 1971 lautete noch: „Wenn geistig Behinderte wegen des Schweregrades ihrer Behinderung unfähig sind, alle ihre Rechte in bedeutsamer Weise auszuüben, oder wenn es notwendig werden sollte, einige oder alle diese Rechte zu beschränken oder abzuerkennen, muss das für die Beschränkung der Aberkennung dieser Rechte angewandte Verfahren geeignete Schutzmaßnahmen gegen jede Form von Missachtung enthalten.“ (zit. nach Jantzen 2004). Die veränderte Sichtweise steht heute der damaligen diametral entgegen. Es war noch kürzlich Konsens, dass es gegebenenfalls notwendig sei, den behinderten Menschen alle ihre Rechte zu entziehen.
Umstritten sind, wie bereits erwähnt, die offizielle deutsche Übersetzung sowie die Auslegung des Textes durch die Bundesregierung mit der der Konvention beigefügten Denkschrift[6]. Netzwerk Artikel 3 hat darum eine „Schattenübersetzung“ veröffentlicht, die dem Original wesentlich näher kommt[7].
Grundlegende Zweifel meldet die „Soltauer Initiative“ unter dem Titel „Moralisch aufwärts im Abschwung?“[8] an: Sie befürchtet, dass die Konvention nur den Charakter einer „Sonntagsrede“ oder „schönen Hochglanzbroschüre“ hat, die tatsächliche Praxis jedoch das Gegenteil der Konvention bewirke. Gerhard KRONENBERGER[9] hat sich kritisch damit auseinandergesetzt, und spricht mir aus dem Herzen. Die Befürchtungen der Initiative bestehen zu Recht, und alle Akteure mit verbindlichen ethischen bzw. berufsethischen Bezugspunkten werden sie wohl teilen, die Argumente jedoch sind im Einzelnen kaum nachvollziehbar. So ist mir aus meiner Berufspraxis kein Fall bekannt, dass durch die in unserem ambulanten Hilfeangebot vollzogene Umstellung der Finanzierung auf Fachleistungsstunden auch nur einer Klientin weniger Hilfe zuteil geworden wäre, als sie benötigt. Und die angeprangerte „Minutenzählerei“ ist sicher eine lästige Routine, aber eben Routine; und hinter keinem Mitarbeiter steht eine Kontrolleurin („Controller“) mit einer Stoppuhr…
1.2. Kernaussagen der ASMK zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
Für die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die im November 2008 durch die 86. ASMK angenommen wurden, galten gemäß der Vorgabe durch die 85. ASMK 2007 folgende Grundsätze als „Eckpunkte einer Gesamtstrategie, die das Ziel verfolgt die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft – beginnend in Kinderbetreuungseinrichtungen über Schulen bis zum Arbeitsmarkt und Wohnen – zu verwirklichen“ (ASMK-2007):
Eckpunkte der ASMK-Gesamtstrategie[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
Von diesen Eckpunkten ausgehend, machte die Arbeitsgruppe der ASMK 2008 eine Reihe von Vorschlägen, deren Kernaussagen ich so skizziere:
Abkehr von der einrichtungsbezogenen, Hinwendung zur personenzentrierten Hilfe:
a) die gebotene Versorgung und Teilhabeleistung erfolgt unabhängig von der Wohnform
b) dazu konzentriert sich die Eingliederungshilfe auf die „reine“ Fachmaßnahme: die notwendige Unterstützungsleistung
c) neben der Unterstützungsleistung werden innerhalb der Systematik des SGB XII die Kosten der Unterkunft sowie die Leistungen zur Existenzsicherung übernommen
d) dabei sollen die Menschen mit Behinderungen mitbestimmen, welche Dienste, wo und von wem sie in Anspruch nehmen wollen; wie bisher: in angemessenem Umfang.
Nachdem zu den Vorschlägen im Jahre 2009 im Rahmen von Anhörungen die Stellungnahmen von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und Selbstvertretungen eingeholt wurden, hat die 86. ASMK im November 2009 beschlossen, die Bundesregierung zu bitten, „zur Umsetzung der Eckpunkte [der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, MD] den Entwurf eines Reformgesetzes zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe so rechtzeitig vorzulegen, dass dieses in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden kann.“ (ASMK Beschluss 2009).
Parallel zu den Gesetzesvorbereitungen sollen folgende Fragestellungen vertieft bearbeitet werden:
- „Entwicklung von Maßstäben für praktikable, möglichst bundesweit vergleichbare und auf Partizipation beruhende Verfahren der Bedarfsermittlung und des Teilhabemanagements,
- Trennung der Leistungen zum Lebensunterhalt einschließlich Wohnen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe,
- Förderung des (trägerübergreifenden) Persönlichen Budgets,
- Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
- Abgrenzung der Eingliederungshilfe zu Leistungen der Pflegeversicherung und zur Hilfe zur Pflege.“ (ASMK Beschluss 2009)
Diese Fragen sollen so rasch bearbeitet werden, dass ihre Ergebnisse in die Gesetzgebung noch einfließen können.
Im Weiteren hält es die ASMK 2009 für notwendig, „die inklusive Sozialraumgestaltung zu fördern“, da nur so die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe ihre volle Wirkung entfalten könne. Darum beauftragt sie „die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, insbesondere mit den Kommunalen Spitzenverbänden Handlungsstrategien zum Auf- und Ausbau eines inklusiven Sozialraumes zu erarbeiten.“ (ASMK Beschluss 2009).
Da sich die aktuellen Beschlüsse 2009 auf die von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe der ASMK erarbeiteten Eckpunkte unmittelbar beziehen, will ich an dieser Stelle die für den Fokus der vorliegenden Arbeit wesentlichsten zitieren:
„Im Kern geht es um eine qualitative Weiterentwicklung des Rechts im SGB XII für Menschen mit Behinderungen zur vorrangigen Unterstützung einer individuellen Lebensführung im Lichte der VN-Konvention. Für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf müssen komplexe Leistungen gesichert sein.
- Neuausrichtung der Eingliederungshilfe
Die Eingliederungshilfe wird unter Beibehaltung der Grundsätze von Erforderlichkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit neu ausgerichtet. Dabei steht - orientiert an der VN-Konvention - der Mensch mit Behinderungen mit seinem Recht auf Selbstbestimmung im Vordergrund:
- Die Eingliederungshilfe wird von einer überwiegend einrichtungszentrierten zu einer personenzentrierten Hilfe. Es ist ein Verfahren zu etablieren, das den Menschen mit Behinderungen in seiner Situation ganzheitlich erfasst, ihn aktiv einbezieht und sein Wunsch- und Wahlrecht beachtet (Teilhabemanagement).
- Damit der Mensch mit Behinderungen seine notwendigen Unterstützungsbedarfe wohnortnah decken kann und Wahlmöglichkeiten zwischen Leistungserbringern bestehen, sind die notwendigen Beratungs- und Unterstützungsangebote auf regionaler Ebene zu entwickeln (Sozialraumorientierung).
- Die Gesamtverantwortung für die Steuerung der Teilhabeleistung – von der Bedarfsfeststellung bis zur Wirkungskontrolle – obliegt den Trägern der Sozialhilfe.
- Zur Sicherstellung der Qualität ist eine Wirkungskontrolle der Leistungserbringung zu etablieren.
- Um die Beschäftigungschancen von Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erhöhen, wird ein berufliches Orientierungsverfahren eingeführt.
- Wesentlich behinderte Menschen erhalten die Möglichkeit, ihre Bedarfe nicht nur in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen, sondern auch bei anderen Anbietern oder in anderer Form zu decken.
- Personenzentrierte Hilfe
- Die notwendige Unterstützung des Menschen mit Behinderungen orientiert sich nicht mehr an einer bestimmten Wohnform. Die Charakterisierung von Leistungen der Eingliederungshilfe in ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen der Eingliederungshilfe entfällt daher.
- Es ist sichergestellt, dass der Bedarf des Menschen mit Behinderungen individuell, bedarfsgerecht und umfassend gedeckt wird. Die Bedarfsermittlung und -feststellung erstrecken sich auf alle Lebenslagen des Menschen mit Behinderungen. Die Kriterien der Bedarfsermittlung werden nach bundeseinheitlichen Maßstäben entwickelt[10].
- Die bisherigen Regelungen zur Zumutbarkeit sind nicht mehr erforderlich. Das Wunsch- und Wahlrecht wird weiterhin gewährleistet.
- Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden - bei weiterhin offenem Leistungskatalog - als individuelle Fachleistungen[11] ausgestaltet. Die vertragsrechtlichen Regelungen sind zu Regelungen über die Vereinbarung zum Inhalt und zur Finanzierung der Leistungen der Eingliederungshilfe umzugestalten[12]. Dazu gehört auch bei Bedarf die Beratung und Unterstützung des Menschen mit Behinderungen zur Sicherung einer ganzheitlichen Inanspruchnahme der Leistungen.
- Wie Menschen ohne Behinderungen erhalten die Menschen mit Behinderungen daneben existenzsichernde Leistungen zum Lebensunterhalt und Leistungen zum Wohnen.
- Teilhabemanagement, Partizipation, Personal
- Der Mensch mit Behinderungen wird während des gesamten Prozesses im Rahmen eines Teilhabemanagements im erforderlichen Umfang unterstützt und begleitet. Das Teilhabemanagement ist ein partizipatives Verfahren, das auf dem ermittelten und festgestellten individuellen Bedarf des Leistungsberechtigten basiert, die durchzuführenden notwendigen Maßnahmen erfasst und wirkungsorientiert die Qualität steuert. Dadurch werden auch die Bedarfsfeststellung, die Leistungen sowie die Finanzierung für den Betroffenen transparent und nachvollziehbar. Es wird eine "Zielvereinbarung" geschlossen. Diese Vereinbarung zwischen dem Leistungsträger und dem Leistungsberechtigten ist zeitlich zu befristen und nach Maßgabe des sich ggf. verändernden Bedarfs anzupassen.
- Der Mensch mit Behinderungen hat die Möglichkeit, in jedem Verfahrensabschnitt neben seiner rechtlichen Betreuerin oder seinem rechtlichen Betreuer und seinen Angehörigen eine Person seines Vertrauens zu den Gesprächen hinzuzuziehen. Die Art der Partizipation ist ausdrücklich zu regeln.
- Verschiedene mögliche Leistungsformen werden entsprechend dem zu deckenden Bedarf gleichwertig zur Wahl gestellt. Weil Eigenverantwortung und Selbstbestimmung durch die Leistungsform des Persönlichen Budgets in besonderer Weise gefördert werden, soll diese Leistungsform von Beginn an aktiv und verstärkt angeboten werden.
- Einzelne einfache, regelmäßig wiederkehrende Bedarfe können mit Zustimmung des Menschen mit Behinderungen auch durch Geldpauschalen abgedeckt werden (z.B. Förderung der Mobilität).
- Gesamtsteuerungsverantwortung des Trägers der Sozialhilfe
- Der Träger der Sozialhilfe stellt den Menschen mit Behinderungen mit seinen Bedarfen, seiner persönlichen Lebensplanung und seinem Wunsch- und Wahlrecht in den Mittelpunkt.
- Um die auf die Person ausgerichtete Eingliederungshilfe steuern zu können, erhält der Träger der Sozialhilfe eine besondere trägerübergreifende Koordinations- und Strukturverantwortung, die er unter Einbindung des Menschen mit Behinderungen wahrnimmt. Im Interesse des Menschen mit Behinderungen erfolgt eine gesetzliche Regelung, dass der Träger der Sozialhilfe bei Leistungsträger-übergreifenden Bedarfskonstellationen im Auftrag und im Namen der anderen beteiligten - auch vorrangigen - Leistungsträger handeln kann („Beauftragter“). Das schließt die Regelungen über Vorleistungspflichten des Sozialhilfeträgers ein.
- Der Träger der Sozialhilfe wirkt darauf hin, dass bedarfsgerechte Angebote für Menschen mit Behinderungen in seinem Verantwortungsgebiet zur Verfügung stehen. Um das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit Behinderungen zu stärken, sollte ihnen eine Auswahl aus verschiedenen Angeboten möglich sein.
- Sowohl die Aufgaben im Rahmen des Teilhabemanagements wie auch die Koordination aufeinander abgestimmter Leistungen erfordern bei den Sozialhilfeträgern eine auf diese neuen Aufgabenstellungen ausgerichtete Organisationsentwicklung und Personalausstattung. Dazu gehört auch der Aus- und Aufbau von erforderlichen Beratungsstrukturen. Hierbei sollen vorhandene Beratungsstrukturen, z.B. die Gemeinsamen Servicestellen, genutzt werden.
- Förderung individueller Wohnformen und inklusiver Sozialraum
- Die Neuausrichtung der Eingliederungshilfe muss durch den Aus- und Aufbau sozialräumlicher Unterstützungsstrukturen begleitet werden. Wesentliche Elemente des Sozialraums sind die Barrierefreiheit, ehrenamtliche Strukturen, „Hilfe-Mix-Strukturen“ wohnortnahe Begegnungs- und Beratungsstrukturen, eine Vielfalt an Wohnformen, Fachdienste zur Sicherstellung der Versorgung und zur Erbringung der fachlichen Leistungen sowie Netzwerkstrukturen. Familiäre Strukturen sind zu unterstützen. Um bedarfsgerechte Leistungen erbringen zu können, ist eine Kooperation der Leistungsträger und -anbieter unabdingbar. Zur Realisierung eines inklusiven Sozialraums sind auch Regelungen in den Ländern erforderlich. Der schon bestehende Prozess zur Schaffung eines inklusiven Sozialraums - auch im Rahmen der Daseinsvorsorge - wird zügig fortgesetzt, damit so schnell wie möglich ausreichende Grundstrukturen vorhanden sind.
- Die Konversion stationärer Einrichtungen wird unterstützt. Bei Zweckänderungen von Einrichtungen sollen Rückforderungen von Zuwendungen vermieden und Wege gefunden werden, negative betriebswirtschaftliche Konsequenzen für den Einrichtungsträger abzufedern.
- Wirkungskontrolle
Es bedarf einer Wirkungskontrolle sowohl gegenüber den Leistungsberechtigten als auch auf der Vertragsebene. So ist festzustellen, ob und in welchem Maße die jeweiligen individuellen Leistungen und die vertraglich vereinbarten Leistungen geeignet sind, die vereinbarten Ziele der Eingliederungshilfe zu erreichen. Hierfür sind konkrete Kriterien zu erarbeiten. Die vereinbarten Eingliederungs- und Teilhabeziele sind Grundlage der Wirkungskontrolle bei den Leistungserbringern.“ (ASMK-AG 2009)
Es geht also um eine tiefgreifende Umgestaltung des Gesamtsystems der Eingliederungshilfe vor dem Hintergrund der UN-Konvention. Bei jedem umzugestaltenden Teilaspekt muss das skizzierte komplexe Gesamtsystem mitgedacht und zur Zielbestimmung herangezogen werden, damit die Teilaspekte ihre beabsichtigte Wirkung entfalten können.
2. Bedarfsermittlung und Teilhabemanagement
2.1. Personenzentrierte Teilhabeleistung
Es soll eine Entwicklung zu einer personenzentrierten Teilhabeleistung durch eine stärkere Berücksichtigung der individuellen Bedarfe und Beachtung des Selbstbestimmungsrechtes der Menschen mit Behinderungen geben.
Wenn Hilfen bzw. Leistungen „personenzentriert“ erbracht werden sollen, kann dies nur unter Beachtung des Personenzentrierten Ansatzes geschehen. Wenngleich die Hinwendung zu personenzentrierten Hilfen insbesondere im Bereich der Hilfen für Menschen mit psychischer Behinderung bereits seit über zehn Jahren erfolgt, ist sie für diesen Personenkreis zum Einen noch nicht von allen Leistungserbringern flächendeckend begonnen worden, zum Anderen selbst in den Regionen, die entsprechende Implementationsprojekte durchgeführt haben, meist noch nicht umfassend umgesetzt. Völliges Neuland jedoch ist der personenzentrierte Ansatz im Bereich der Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung. Insofern ist es notwendig, sich mit den Aussagen des Ansatzes nochmals grundlegend auseinanderzusetzen, wenn sich die Landschaft der Eingliederungshilfe insgesamt in diese Richtung entwickeln soll[13]. Unterbleibt eine Auseinandersetzung, sehe ich die große Gefahr, dass – wie in vielen Regionen - nur ein Zerrbild des Ansatzes Eingang in die Praxis findet: Eine verstümmelte, formale Variante, ein „bürokratisches Monstrum“, dem sich alle Beteiligten unterwerfen, ohne dass vom Ansatz herrührende (durchaus positive, wenn man sie denn sehen will…) Impulse Eingang in eine veränderte Praxis der fachlich-inhaltlichen Gestaltung der Hilfeleistung finden.
2.1.2. Der Personenzentrierte Ansatz
„Personenzentrierte Hilfen“ hat sich als eine gefährliche Bezeichnung entpuppt, die zu verbreiteten Missverständnissen führte und führt: Als das Konzept in den 90er Jahren entwickelt wurde, sollte der gewählte Begriff signalisieren, dass nunmehr subjektorientiert vom Menschen her mit seinen Bedürfnissen und Ressourcen aus gedacht werden solle als deutliche Gegenposition zum „einrichtungszentrierten Denken“. Einrichtungszentriertes Denken heißt: Wir offerieren unser Angebot, die Klientinnen passen sich dem an bzw. werden unreflektiert – pragmatisch „passend gemacht“.
Das verbreitete Missverständnis beruht auf der fälschlichen Annahme, die PERSON ALLEIN sei Gegenstand der Betrachtung. So etwa wie in jedem x-beliebigen Leitbild im sozialen Bereich: „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt.“
Der personenzentrierte Ansatz ist jedoch anders konzipiert. Gerade er betont mit seinem Grundsatz „Nichtprofessionelle Hilfe zuerst!“ bereits bei der Hilfeplanung das Potential von Hilfemöglichkeiten im Umfeld, außerhalb der traditionellen Institution. Ein grundsätzlicher Bruch mit der „Einrichtungszentrierung“. Damit steht er keinem der Prinzipien und Konzepte Trialog, Gemeinwesen-, Netzwerk oder (umfassender) Sozialraumorientierung entgegen. Insofern mag die geäußerte Kritik, Personenzentrierung sei geradezu das Gegenteil von Sozialraumorientierung, zwar in Bezug auf eine häufig anzutreffende Praxis gerechtfertigt sein, nicht jedoch für das Konzept. Es kommt eben darauf an, was man damit macht.
„Das ist doch alles Käse! Wir machen das schon immer! Unsere Leistungen waren schon immer am Bedarf der Klienten ausgerichtet!“: So formulierte es der Geschäftsführer eines Leistungserbringers in unserer Region während einer Diskussion zum Thema Personenzentrierte Hilfen.
Dabei wissen alle Beteiligten, zumindest wenn sie zur Reflexion willens und fähig sind, dass das so nicht stimmt. Die Landschaft ist noch immer bestimmt durch festgelegte, ausgehandelte, relativ starre einrichtungsbezogene Angebote[14]. Die Nutzer der Angebote passen sich dem an oder werden passend gemacht; gelingt das nicht, werden sie weiter verwiesen oder bleiben unversorgt. Ausführlich dazu: Gromann 2001, S. 5-6.
Nach der Psychiatrie-Enquête von 1975 ist die Versorgungslandschaft gerade für Menschen mit psychischen Erkrankungen erheblich verbessert worden. Dennoch kann keine Rede davon sein, dass Grundsätze wie „ambulant vor stationär“, Ziele der Enquête wie das Vermeiden der Ausgliederung von Behinderten aus ihren Lebensbereichen oder Vermeidung von Krankenhausbehandlung durch ambulante und komplementäre Angebote (vgl. Enquête S. 189) umfassend verwirklicht sind. Vor diesem Hintergrund hat das Bundesgesundheitsministerium ein 1992 bis 1996 ein Forschungsprojekt mit dem Auftrag gefördert, Grundlagen zur Personalbemessung sowie entsprechende strukturelle Rahmenbedingungen für eine bedarfsgerechte Versorgung im ambulanten und komplementären Bereich zu erarbeiten.
Die eingesetzte Arbeitsgruppe hat das Konzept der „Personenzentrierten Hilfen“ erarbeitet, vgl. KAUDER 1999.
Das Konzept beinhaltet:
- personenbezogene statt institutionsbezogene Arbeitsweise,
- bedarfsorientierte statt angebotsorientierte Arbeit,
- Lebensfeldbezug und subjektorientierter Ansatz,
- Trennung von Wohn- und Hilfeform,
- Aufhebung der starren Trennung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfeangeboten,
- stärkere Einbeziehung der Klienten in den Prozess der Therapieplanung und Hilfebedarfsermittlung,
- Überwindung der engen Institutionsgrenzen in Richtung eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes sowie Förderung regionaler Pflichtversorgung (vgl. 1998, S. 583).
Damit beschreibt das Konzept der Personenzentrierten Hilfen sehr umfassende Änderungen der Versorgung psychisch erkrankter Menschen, die nun, gemäß ASMK-Beschluss, auf den gesamten Bereich der Versorgung von Menschen mit Behinderungen übertragen werden soll.
Damit verknüpft ist eine Vielzahl praktischer Probleme, die umgehend einer Klärung bedürfen. Einer Auswahl m.E. besonders drängender Probleme sind die folgenden Abschnitte gewidmet.
2.2. Hilfebedarfsermittlung
2.2.1. Anforderungen nach dem Personenzentrierten Ansatz
Wenn Hilfen nach dem Personenzentrierten Ansatz personenbezogen, bedarfsorientiert, lebensfeldbezogen und subjektorientiert erbracht werden sollen, müssen die dazu benötigten Informationen erfasst werden. Dies kann man dem Zufall oder vertrauensvoll der unüberprüfbaren und nicht anzuzweifelnden Professionalität der helfenden Mitarbeiterschaft überlassen, wie von Dörner vehement vertreten (vgl. Dörner 2004, S. 39). „Ohne zu schreiben, kann man nicht denken; jedenfalls nicht in anspruchsvoller, anschlussfähiger Weise.“, hätte Luhmann hierzu entgegnet (Luhmann 1992, S. 53). - Man kann auch der „Soltauer Initiative“[15] folgen, sie kritisiert hierzu: „Wir nehmen wahr: Ein verwirrendes Gemisch aus politisch bedingtem Spardruck, Kontrollbedürfnissen von Leistungsträgern, Rechtfertigungsbemühungen von Leistungserbringern, sowie von Seiten aller Beteiligten eine geradezu manische Neigung zur Anwendung unterschiedlichster Instrumente, die das alles regulieren sollen. Ein Begriff wie „ personenzentriert “ als Titel flächendeckender normierender Hilfeplanung wird zu einem Widerspruch in sich.“ (Schernus 2004, S. 35). Zur letztgenannten Hypothese ist zu entgegnen, dass die angeprangerte Hilfeplanung zwar normiert in ihrer Form als Planungsinstrument ist, aber eben nicht „normierend“; weder vom Konzept her noch aus Klienten- oder Angehörigen-Perspektive.
Man kann aber auch den Standpunkt vertreten, dass es
a) auch für Klienten im Prozess der Hilfeleistung hilfreich sein kann, den aktuellen Willen[16] der Klienten gemeinsam mit ihm zu ergründen und zu verschriftlichen[17], dies betont den Prozesscharakter einer Hilfeplanung,
b) angesichts der zahlreichen Zwänge, Widrigkeiten und unvorhersehbaren Wendungen im Alltag der Hilfeleistung eine schriftliche Fixierung hilfreich sein kann, den „roten Faden“, sprich das Ziel, nicht aus dem Auge zu verlieren,
c) hilfreich sein kann, gegenüber Kosten- und anderen Anspruchsträgern jederzeit überprüfbar den Nachweis führen zu können, dass das konkrete Tun im Rahmen der Hilfeleistung vereinbart, notwendig und angemessen ist[18].
Benötigt wird, folgt man dem letztgenannten Standpunkt, ein entsprechendes Instrument zur Hilfebedarfsermittlung und –planung.
Entsprechend der Prinzipien des Ansatzes müssen die Klienten und beteiligte Fachkräfte in die lebensfeldbezogene Hilfeplanung einbezogen sein, folglich muss ein Instrument zur Planung und Bedarfserfassung dies gewährleisten. Das entsprechend des Ansatzes bedarfsorientierte Verfahren muss ermöglichen, klare, überschaubare Zielsetzungen zu formulieren. Es muss gewährleisten, nichtprofessionelle Unterstützungsmöglichkeiten im Umfeld vorrangig einzubeziehen. Der Personenzentrierte Ansatz als Komplexleistungsprogramm verlangt im Weiteren, dass alle beteiligten Professionen in den Planungsprozess einbezogen werden.
Ein den Prinzipien des Personenzentrierten Ansatzes genügendes Verfahren der Hilfeplanung und –bedarfserfassung eignet sich immer auch zur Anwendung im Rahmen persönlicher Budgets. Deren Ausweitung ist ebenfalls eines der erklärten Ziele der ASMK.
Im Bereich der Hilfen für psychisch erkrankte Menschen hat sich dafür der Integrierte Behandlungs- und Rehabilitationsplan etabliert. Nicht zufällig: Er ist genauso wie der Personenzentrierte Ansatz selbst ein Ergebnis der o.g. Arbeitsgruppe, die ihren Arbeitsauftrag offenbar nicht nur theoretisch-sozialwissenschaftlich bearbeitet hat, sondern praktikable und praxistaugliche Lösungen gesucht hat.
2.2.2. Ergänzende Anforderungen
Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe der ASMK 2008 betont, dass „ Stärkung von Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Selbsthilfepotentialen, Annäherung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen an die allgemeinen Lebensbedingungen“ kennzeichnend für die Neuausrichtung der Eingliederungshilfe sein soll. Damit betont die AG Kernaussagen des Empowerment-Konzeptes (Herriger 2002)[19]. Noch immer ist der Blick der Professionals, auch und gerade bei den Professionals im Bereich „Menschen mit geistiger Behinderung“, geprägt von einem defizitorientierten Fürsorgedenken[20]. Das Grundideal der Sozialen Arbeit, sich selbst im Erfolgsfalle überflüssig zu machen, ist damit niemals auch nur näherungsweise zu erreichen. Wer nur Defizite sieht, verstellt sich die Möglichkeit, Entwicklungspotenziale zu sehen: Wer das Defizit, Schuhe binden oder ein fünf-Gänge-Menü zubereiten zu können zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen macht[21], wird niemals im Blick haben können, dass auch Menschen, die das nicht hinbekommen, vollwertige und gleichberechtigte Teile unserer Gesellschaft sein können, die daneben ein - trotz der Defizite – selbstbestimmtes, erfülltes Leben führen können. Diesem Ideal kann man sich nur nähern, wenn die Ressourcen, die Möglichkeiten, das Entwicklungspotenzial in den Fokus genommen werden. Folglich muss sich der Blickwinkel der Professionals verändern. Davon geht in jedem Fall die Anforderung aus, ressourcen- statt defizitorientiert auch Hilfebedarfe zu erfassen.
Eine weitere Anforderung ist die Sozialraumorientierung. Da sie als Konzept erst in den letzten zwei, drei Jahren Eingang in die Fachdiskussion und – abgesehen von lokalen Einzelprojekten - noch lange nicht in die Praxis der Behindertenhilfe gefunden hat, will ich sie hier einer näheren Betrachtung unterziehen.
2.2.2.1. Exkurs: Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe
Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe liegt als Konzept nicht nur brach, sondern stößt auf Widerwillen: Fallunspezifisch zu arbeiten, gehört gerade nicht zur Tradition in der Behindertenhilfe. Hier gehört es auf Mitarbeiterebene gerade zur verteidigten Grundhaltung, ausschließlich individuell-fallbezogen zu arbeiten. Die heute „frisch“ ausgebildeten Heilerziehungspflegerinnen und Heilpädagogen, aber auch Erzieherinnen und Sozialpädagogen haben nach meiner Erfahrung in der Regel noch nie davon gehört, lediglich eine Minderheit kennt wenigstens den Begriff, aber nicht seine Inhalte und seine Bedeutung. Die übergroße Mehrheit ist darauf getrimmt, ausschließlich am Individuum „herumzufummeln“ (Dörner 2004).
Darum will ich im Folgenden auf die Bedeutung und das Potential sozialräumlicher Methoden für den Bereich der Behindertenhilfe zu sprechen kommen. Es gibt vielversprechende erste Ansätze in der Behindertenhilfe (ausführlich dazu: DHG-Schriften 2008), die Jugendhilfe ist dennoch weit voraus.
2.2.2.2. Bedeutung und Potential sozialräumlicher Methoden für die Behindertenhilfe
Die Behindertenhilfe in Deutschland befindet sich in einer Sackgasse. Jahrzehntelang gestiegene Ausgaben brachten enorme qualitative Verbesserungen der Lebensbedingungen mit sich.
Abb.: Gestiegene Ausgaben der letzten Jahre. Quelle: Statistisches Bundesamt
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gegenwärtig entfallen 58 % der Ausgaben der Sozialhilfe auf den Bereich Eingliederungshilfe. Noch immer sind die Ausgaben steigend, die Fallzahlen im Bereich Wohnen sind von 2000 bis 2008 um etwa 30 % gestiegen. Alle Kämmerer stöhnen, Projekte mit der viel versprechenden Bezeichnung KoDE („Kostendämpfung in der Eingliederungshilfe[22] “) u.ä. finden hohe Beachtung[23].
Zielvorgaben der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung, in Deutschland geltende gesetzliche Vorgaben, Zielvorstellungen aller Leistungserbringer und ihrer Verbände beinhalten stets Integration, Teilhabe, Inklusion. Trotz dramatisch gestiegener Ausgaben kann dennoch von einer echten Integration, geschweige denn einer Inklusion noch lange keine Rede sein:
Einerseits gibt es noch immer große und sehr große Anstalten, die einen großen Teil der Menschen mit Behinderungen versorgen. Schon daraus resultiert, dass Menschen mit Behinderungen noch längst nicht so präsent in der öffentlichen Wahrnehmung sind, wie es ihrem tatsächlichen Anteil an der Bevölkerung entspricht.[24] Bundesweite Initiativen, wie seit etwa drei Jahren „Daheim statt Heim“, die daran grundsätzlich etwas ändern wollen, stoßen auf den subtilen Widerstand vieler großer Einrichtungsträger[25].
[...]
[1] Wohlwissend, dass ich Menschen damit wehtue. Wir begleiten Leute, die sagen mir klipp und klar ins Gesicht „Ich bin doch nicht behindert! Ich kann zwar nicht Lesen und Schreiben, aber behindert bin ich nicht.“
[2] Ausnahmen sind jene Akteure in diesem Bereich, die auch psychisch erkrankte Menschen versorgen. Da jedoch bei größeren Leistungserbringern die Arbeitsbereiche (zu Recht) intern nach Behinderungsformen getrennt sind, gibt es meist einen nur geringen fachlichen Austausch beider Systeme.
[3] Im Original „inclusive“; gemeint ist also nicht die Integration in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Original:
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
[4] Im Original: „inclusive education system“, in der „offiziellen“ Übersetzung „integratives Bildungssystem“, in Auslegung der Bundesregierung „einbeziehendes Bildungssystem“. Original:
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
[5] Und der ist enorm. Als jemand, der beruflich mit Menschen mit lebenslangen Behinderungen zu tun hat, lautete meine These schon lange vor der UN-Konvention: Menschen mit Behinderungen werden in Deutschland systematisch von der Geburt bis zum Tode die basalen Menschenrechte vorenthalten.
[6] Quelle: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/108/1610808.pdf
[7] Quelle: http://www.netzwerk-artikel-3.de/
[8] Quelle: http://www.psychiatrie.de/dgsp/soltauer_initiative/article/Soltauer_Initiative_09.html
[9] in Soziale Psychiatrie 01/2010, S. 58
[10] Vgl. Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge zur Bedarfsermittlung und Hilfeplanung in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
[11] Der Begriff dient der inhaltlichen Abgrenzung von Eingliederungshilfe und Lebensunterhalt bzw. Wohnen.
[12] siehe dazu im Einzelnen die Darlegungen des Vorschlagspapiers zur ASMK 2008, Abschnitt III, Ziffer 2.4, die im Rahmen der Anhörung auf keine Bedenken gestoßen sind.
[13] SOLL ist hier der treffende Begriff, denn Veränderungen der gewohnten Vollzüge stoßen nach meiner Wahrnehmung auf allen Ebenen auf Widerstände. Ausführlich dazu unten im entsprechenden Abschnitt.
[14] Das ist auch einer der Hemmschuhe bei der Einführung und Umsetzung „persönlicher Budgets“.
[15] vgl. http://psychiatrie.de/dgsp/soltauer_initiative/
[16] Der Wille ist mehr als der Wunsch. Er umfasst im Gegensatz zum Wunsch eigene Handlungsbeiträge und „zwingt“ somit auch Klientinnen im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht zum eigenen Handeln im Rahmen ihrer Möglichkeiten statt zum endlosen reinen Empfang von Hilfe durch Dritte.
[17] Klientinnen sind ebenso wenig wie die übrige Menschheit stets rational und planmäßig vorgehende Subjekte. Bisweilen kann es hilfreich sein, sie an einst festgelegte, diskutierte und reflektierte Ziele zu erinnern. Oder es ist ein m.E. Quantensprung im Hilfeprozess, wenn die durch Klienten festgelegten Ziele nicht erreicht wurden und dann anhand der Verschriftlichung mit Unterschrift am Ende eines Planungsprozesses reflektiert werden kann, warum diese Ziele nicht erreicht wurden. Gab es konkrete Hindernisse, welche?... oder waren die Ziele zu hochgesteckt, zu unrealistisch?
[18] In einer unserer Einrichtungen für psychisch erkrankte Menschen begleiten wir derzeit eine Klientin, deren gesetzlicher Betreuer höchst widersprüchlich und wechselhaft in den an uns gerichteten Erwartungen und Ansprüchen ist. Beschwerden seinerseits sind die Folge. Für uns ist es ungemein hilfreich, in einer solchen Situation auf die schriftlich fixierten, mit allen Beteiligten und besonders der Klientin selbst vereinbarten Ziele und Maßnahmen inklusive des Votums der Hilfeplankonferenz verweisen zu können.
[19] Der aus der Bürgerrechtsbewegung stammende Begriff Empowerment wird zu Recht vermieden: Er beinhaltet auch die Verteilungsgerechtigkeit (vgl Theunissen / Plaute 2002, S. 28ff), denn ohne sie verkommt Selbstbestimmung zur inhaltsleeren, schönen Worthülse: „Rechte ohne Ressourcen zu besitzen ist ein grausamer Scherz“ (Rappaport, 1985, S.268) Der Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit taucht in den Vorschlägen der ASMK nur insoweit auf, als ein anzustrebendes „angemessenes Gleichgewicht“ zu erzielen sei zwischen den Anforderungen der Menschen mit Behinderung und dem, was die Gesellschaft dafür zu geben bereit sei. Leider ist es nicht viel, was vor dem Hintergrund jahrhundertelanger Entrechtung und Ausgrenzung die demokratische Mehrheit der „Normalbürger“ der Minderheit „Behinderte“ gegenüber als „angemessen“ definiert und durchsetzt. Wenn ich mal gehässig einen Taschenrechner zur Hand nehme und anhand der vom Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (vgl. http://www.zzf.de/presse/markt/) veröffentlichten Zahlen zur Heimtierpopulation in Deutschland nachrechne, was allein Hunde und Katzen in Deutschland für Kosten verursachen, lande ich bei ca. 10 Mrd. Euro. Das entspricht schon fast den jährlichen Kosten der Eingliederungshilfe – dabei habe ich noch nicht die eine Million Pferde und nicht die vielen Millionen Meerschweinchen, Kanarienvögel usw. eingerechnet… Ich habe nichts gegen Tiere, es ging mir hier nur um die Relation.
[20] Ich weiß, wovon ich rede. Ich leite ein Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung; die Hälfte der Menschen gilt als schwerst- bzw. mehrfachbehindert.
[21] Fürs Schuhebinden gibt es mittlerweile Klettverschlüsse. Das Menü kann mittels Fertigprodukten und Tiefkühlkost kompensiert werden – und zwar unabhängig davon, was ich persönlich davon halte.
[22] http://www.sozialpsychiatrie-mv.de/PKP/aktuellesprojekt.html
[23] Nun ja, Banker würden angesichts der Kosten, um die die Eingliederungshilfe ringt, nur lächeln. Routiniert verbraten sie ganz andere Summen.
[24] So berichtet etwa die ehemalige Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Karin Evers-Meyer, wie ihre Mutter von einer Rundreise durch Holland und Frankreich aufgeregt zurückkehrte. Sie war der Ansicht, dort habe eine Seuche oder eine andere schreckliche Ursache zum massenweisen Auftreten von Menschen mit Behinderungen geführt. - Dem ist jedoch keineswegs so, die Menschen leben dort nur wesentlich gemeindeintegrierter. (Mdl. Mitteilung.)
[25] Lange haben kaum Vertreter der Lebenshilfe-Vereine bzw. -träger hier unterschrieben. Auch die Caritas fällt als „zurückhaltend“ auf. Nach meiner Wahrnehmung tun sich insbesondere Heim leitungen schwer damit. http://www.bundesinitiative-daheim-statt-heim.de
Details
- Titel
- Personenzentrierte Umgestaltung der Eingliederungshilfe - Ein Vorschlag der Arbeits- und Sozialministerkonferenz
- Untertitel
- Chancen, Risiken, Modelle, Notwendigkeiten
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 135
- Katalognummer
- V227981
- ISBN (eBook)
- 9783842803145
- Dateigröße
- 1939 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- sozialraumorientierung hilfeplanung personenzentrierte hilfe eingliederungshilfe behindertenhilfe
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2010, Personenzentrierte Umgestaltung der Eingliederungshilfe - Ein Vorschlag der Arbeits- und Sozialministerkonferenz, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/227981
- Angelegt am
- 19.5.2017

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.



