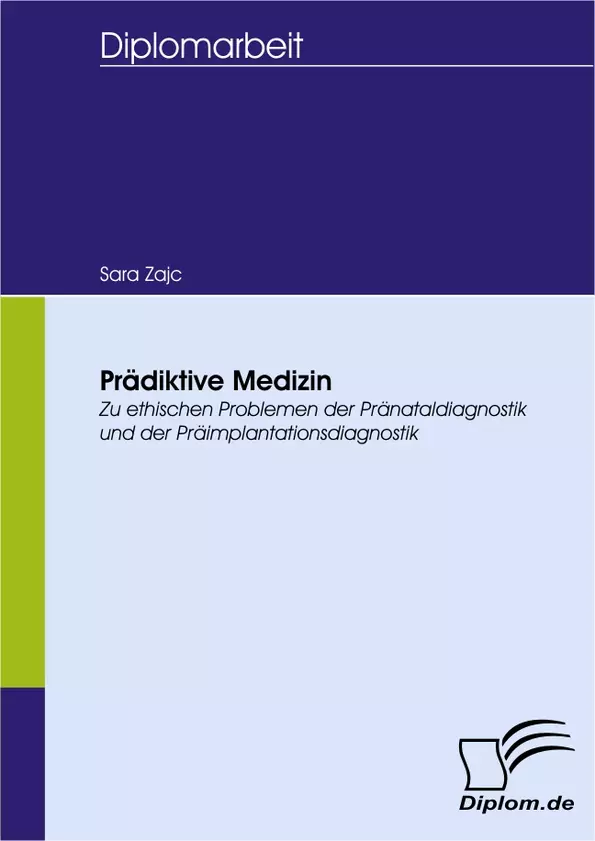Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos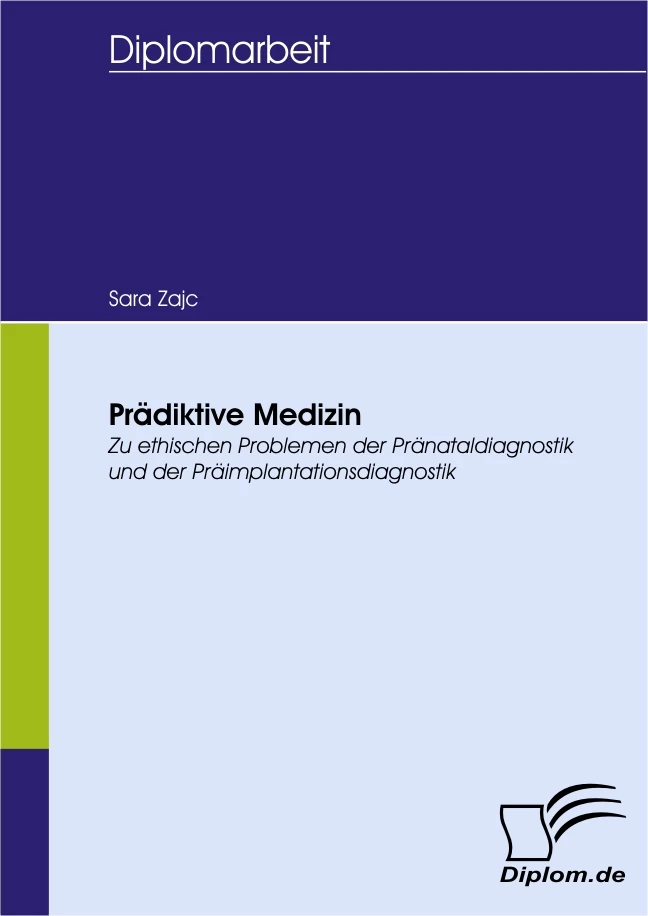
Prädiktive Medizin
Diplomarbeit, 2010, 123 Seiten
Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Note
2,2
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Bioethik und prädiktive Medizin
2.1 Der Begriff „Bioethik“
2.2 Einordnung der Bioethik und der Medizinethik
2.3 Der Begriff „Prädiktive Medizin“
2.4 Ethische Probleme der prädiktiven Medizin
2.5 Pränatale Diagnostik
2.6 Präimplantationsdiagnostik
3 Der moralische Status von Embryonen und Feten
3.1 Zur Debatte um den Begriff der „Person“
3.2 Der Beginn des menschlichen Lebens
3.3 Der Beginn der Schutzwürdigkeit
3.4 Absolute Schutzkonzepte
3.4.1 Das Potentialitätsargument
3.4.2 Das Speziesargument
3.4.3 Das Identitätsargument
3.4.4 Das Kontinuumsargument
3.5 Graduelle Schutzkonzepte
3.5.1 Die Gradualistische Position
3.5.2 Die Utilitaristische Position
4 Die Gesetzeslage in Deutschland und Österreich
4.1 Pränatale Diagnostik und Schwangerschaftsabbruch
4.1.1 Wegfall der embryopathischen Indikation in Deutschland
4.1.2 Der Schwangerschaftsabbruch im österreichischen Strafrecht
4.1.3 Regelungen für genetische Untersuchungen in Deutschland
4.2 Präimplantationsdiagnostik und Embryonenschutz
4.2.1 Das Embryonenschutzgesetz in Deutschland
4.2.2 Das Fortpflanzungsmedizingesetz in Österreich
5 Pränataldiagnostik (PND)
5.1 Methoden
5.1.1 Die nicht-invasiven Methoden
5.1.1.1 Ultraschalluntersuchung (Sonographie)
5.1.1.2 Ersttrimester-Screening
5.1.1.3 Untersuchung des mütterlichen Bluts (Triple-Test)
5.1.1.4 Entwicklung neuer nicht-invasiver Methoden
5.1.2 Die invasiven Methoden
5.1.2.1 Fruchtwasserpunktion (Amniozentese)
5.1.2.2 Plazentapunktion (Chorionzottenbiopsie)
5.1.2.3 Nabelschnurpunktion (Chordozentese)
5.2 Chancen, Risiken, Folgen
5.2.1 Risiken der invasiven Methoden
5.2.2 Fehldiagnosen und Erkennungsraten
5.2.3 Schwangerschaft und Betreuung
5.2.4 Akzeptanz und soziologische Folgen
5.2.5 Psychische Folgen für die Mutter-Kind-Beziehung
5.3 Ethik
5.3.1 Beratung, Autonomie und informierte Zustimmung
5.3.2 Ethische Verantwortung der Ärzte
5.3.3 Problematische Aspekte bei der Ergebnismitteilung
5.3.4 Das Fehlen therapeutischer Möglichkeiten und die Konsequenzen
5.3.5 Gesellschaftliche Auswirkungen
5.3.6 Schwangerschaft auf Probe
6 Präimplantationsdiagnostik (PID)
6.1 Methoden
6.1.1 In-vitro-Fertilisation (IVF) – Biopsie – Embryotransfer
6.1.2 Polkörperdiagnostik
6.1.3 Embryobiopsie
6.1.4 Verbrauch und Umgang mit überzähligen Embryonen
6.2 Chancen, Risiken, Folgen
6.2.1 Erfolgschancen von IVF und PID
6.2.2 Gesundheitliche Risiken der IVF
6.2.3 Psychische Belastungen und Mehrlingsschwangerschaften
6.3 Ethik
6.3.1 Zur Frage der Indikation
6.3.2 Zeugung auf Probe und Selektion – PID vs. PND
6.3.3 Totipotente Zellen und Embryonenforschung
6.3.4 Autonomieverlust und Alternativen
6.3.5 Zum Vorwurf der Diskriminierung und Eugenik
6.3.6 Perspektiven
7 Schlussbetrachtung
Glossar
Literatur- und Quellenverzeichnis
1 Einleitung
Pränataldiagnostische Untersuchungen im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge sind heute kaum noch aus der Gesellschaft wegzudenken. Die pränatale Diagnostik hat sich in den letzten Jahren zu einem Instrument entwickelt, das nicht mehr nur bei einigen wenigen angewendet wird, sondern bei nahezu jeder Schwangerschaft. Da sich die diagnostischen Möglichkeiten in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt haben, verschärft sich zunehmend die Diskussion um die Entwicklung der prädiktiven Medizin, während der Bedarf an ethischer Orientierung wächst. Bereits in einer sehr frühen Phase des menschlichen Lebens können Veränderungen im Erbgut festgestellt werden, die zu körperlichen oder geistigen Fehlbildungen führen können. Das Spektrum diagnostizierbarer genetisch bedingter Krankheiten wird dabei immer größer. Gleichzeitig wächst aber auch die Kritik an der pränatalen Diagnostik, insbesondere da, wo entsprechende therapeutische Möglichkeiten fehlen und somit nach der Intention gefragt werden muss. Kritiker sprechen von einer „Perfektionierung“ der Schwangerschaft und befürchten das Entstehen eines „Automatismus“ aus Diagnostik und anschließendem Schwangerschaftsabbruch.
Mit der Etablierung der Präimplantationsdiagnostik im Rahmen der künstlichen Befruchtung hat die Debatte um die gezielte Beeinflussung der menschlichen Fortpflanzung einen neuen Höhepunkt erreicht. Mit der genetischen Untersuchung künstlich erzeugter Embryonen außerhalb des weiblichen Körpers stößt die Medizin in Grenzbereiche ärztlichen Handelns vor, die schwerwiegende rechtliche und ethische Probleme aufwerfen, vor allem die Frage, „ob es mit der Würde menschlichen Lebens vereinbar ist, unter Vorbehalt erzeugt und erst nach einer genetischen Untersuchung für existenz- und entwicklungswürdig befunden zu werden.“[1] Ein weiterer Aspekt kreist um die Frage, ob es moralisch vertretbar ist, Embryonen zu wissenschaftlichen und therapeutischen Forschungszwecken zu verwenden.
In der ethischen Beurteilung der Pränataldiagnostik und der Präimplantationsdiagnostik lassen sich drei perspektivische Ansätze unterscheiden: die schützenswerten Belange des Embryos, jene der betroffenen Frauen bzw. Paare und die der gesamten Gesellschaft. Gesellschaftliche Interessen sind z.B. der Schutz kranker und behinderter Menschen vor Kränkung und Diskriminierung sowie die Vermeidung unerwünschter Entwicklungen, die mit den neuen Möglichkeiten verbunden sein könnten, z.B. überzogene Ansprüche an die Gesundheit, eugenische Tendenzen oder ein schleichender Respektverlust vor dem menschlichen Leben und naturgegebenen Prozessen. Dabei ist zu bedenken, dass die Fortpflanzungsmedizin sich erst am Anfang ihrer Entwicklung befindet, was neue Fragen aufwirft. Könnte die Technik zukünftig nicht mehr nur zur Diagnostik pathogener Erbanlagen genutzt werden, sondern z.B. auch dazu, anhand erwünschter genetischer Eigenschaften das Wunschkind auszuwählen?
Der zweite Aspekt kreist um die persönlichen Belange der Frauen und Paare, die im Falle eines Schwangerschaftskonfliktes mit denen des Embryos kollidieren können. Angesichts der zunehmenden Möglichkeiten zur Vermeidung der Geburt kranker und behinderter Kinder ist zudem nach dem Vorhandensein von Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung zu fragen: Sind autonome Entscheidungen unter ärztlicher und gesellschaftlicher Einflussnahme und dem sozialen Druck, gesunde Kinder bekommen zu „müssen“, überhaupt noch möglich?
Vor allem aber steht die Frage nach dem moralischen Status des Embryos, da dieser auch für die Beurteilung der persönlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen von maßgeblicher Bedeutung ist. Sowohl beim Schwangerschaftsabbruch nach Pränataldiagnostik als auch bei der Verwerfung von Embryonen nach Präimplantationsdiagnostik nimmt die Frage nach der Schutzwürdigkeit des ungeborenen Lebens bzw. jene nach dem Beginn des menschlichen Lebens eine Schlüsselstellung ein. Ab welchem Entwicklungsstadium kann man von einer Person sprechen, deren Leben schützenswert und deren Würde unantastbar ist?
Anliegen dieser Arbeit ist es, unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen einen Beitrag zur Diskussion um die ethische Bewertung der neuen medizinischen Möglichkeiten zu leisten. Dazu werden nach einer allgemeinen Einführung in die Bereiche Bioethik und Medizinethik verschiedene Argumente bezüglich des Embryonenstatus vorgestellt sowie die rechtliche Lage in Österreich und Deutschland erörtert. Im Hauptteil der Arbeit werden die Methoden, Problemfelder und ethischen Aspekte der jeweiligen Diagnostik im Einzelnen untersucht. Dabei wird neben der zentralen Frage, ob eine genetische Selektion ethisch zu rechtfertigen ist, auf die mit den Verfahren verbundenen Gefahren für die Gesellschaft ebenso eingegangen, wie auf die Risiken und Belastungen für die betroffenen Frauen und Paare, die sich oftmals in einem schweren Gewissenskonflikt befinden.
2 Bioethik und prädiktive Medizin
2.1 Der Begriff „Bioethik“
„Bioethik ist zu einem schillernden Begriff geworden, mit dem sehr Unterschiedliches bezeichnet wird“[2], schreiben Düwell und Steigleder im Vorwort ihrer Monographie. In Parlamenten gibt es Bioethik-Kommissionen, in Kliniken und Firmen etablieren sich bioethische Berater, an Universitäten wird über bioethische Fragen geforscht und öffentliche Debatten verhandeln Bioethik-Konventionen. Doch trotz ganz unterschiedlicher Kontexte und verschiedener thematischer Felder, in denen bioethische Fragen diskutiert werden, ist die Bioethik im Kern eine wissenschaftliche Unternehmung, die den Umgang mit neuen medizinisch-biologischen Möglichkeiten aus ethischer Sicht reflektiert.[3]
Das noch relativ junge Fachgebiet Bioethik ist in den USA der 1960er Jahre aus der verstärkten Beschäftigung mit Fragestellungen der normativen Ethik hervorgegangen. Die Bezeichnung bioethics wurde zu Beginn der 1970er Jahre eingeführt. Seit dem sind ganz unterschiedliche Verwendungsweisen mit dem Begriff verbunden. Während das in den USA vorherrschende Verständnis von bioethics auf eine Alternative zur traditionellen am Standesethos von Ärzten orientierten Medizinethik zurückgeht, erweitert um medizinnahe Problemstellungen in der Biologie[4], gebrauchte der Onkologe Van Rensselaer Potter, der den Terminus bioethics als erster prägte, ihn für sein Programm einer Synthese von biologischem Wissen und humanem Wertesystem, wobei er vor allem das Problem der Überlebensbedingungen der menschlichen Gattung und ihrer Kulturen in der natürlichen Umwelt im Blick hatte.[5] Heute wird Bioethik als Teilgebiet der Angewandten Ethik verstanden, da sie „sich nicht mit Grundlegungsfragen, sondern mit der ethischen Beurteilung besonderer Probleme des heutigen Lebens beschäftigt.“[6]
In Deutschland setzte eine stärkere Beschäftigung mit Angewandter Ethik erst Mitte der 1980er Jahre ein, ausgelöst durch die Debatte um Gentechnologie und Reproduktionsmedizin. Die Beschäftigung mit Bioethik führte im Folgenden zu ersten Ansätzen von Institutionalisierungen, da deutlich geworden war, dass es nicht nur um Änderungen in der Medizin ging, sondern zunehmend auch um eine Veränderungen der Medizin und ihren Rahmenbedingungen selbst.[7] Denn eine jede bioethische Diskussion kann nur dann relevant sein, wenn sie dem Anspruch gerecht wird, mit der rasanten Entwicklung in der Medizin und den Biowissenschaften auch Schritt zu halten, was allerdings eines der größten Schwierigkeiten der Bioethik darstellt.
2.2 Einordnung der Bioethik und der Medizinethik
Unter dem Oberbegriff Bioethik werden neben der Medizinethik auch die ökologische Ethik, die Tierethik sowie die Bevölkerungsethik zusammengefasst. Noch weiter gefasst wird Bioethik verstanden als Beschäftigung mit allen ethischen Fragestellungen, die überhaupt mit menschlichen Eingriffen bzw. Eingriffsmöglichkeiten in Zeugungs-, Lebens-, und Sterbeprozesse zu tun haben[8], bzw. mit Problemkontexten, in denen das „Lebendige“ zum Problem geworden ist, wie Düwell und Steigleder schreiben, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass der Begriff innerhalb der Bereiche der Angewandten Ethik nicht klar einzuordnen ist, da Bioethik im Sinne von Ethik im Umgang mit dem Lebendigen nur einen Teil der Medizinethik trifft. Die Beschränkung der Bioethik auf Biomedizinische Ethik stelle sich als zu eng dar, da sie der Tatsache nicht gerecht wird, dass die Anwendungen der Biologie nicht auf den Kontext der Medizin beschränkt sind. Allerdings, und darauf weisen die Autoren ausdrücklich hin, sei die Uneindeutigkeit des Begriffs Bioethik kein Nachteil, sondern sie biete vielmehr die Chance, auf fachübergreifende Zusammenhänge hinzuweisen und offen zu sein für Fragen, die unser moralisches Alltagsbewusstsein überfordern. Für viele liege die Annahme nahe, dass die Fragen, die beispielsweise in der Medizin auftauchen, am ehesten auch von einem ausgewiesenen Mediziner beantwortet werden können. Dabei werde aber übersehen, dass die dringlichen moralischen Fragen, z.B. der prädiktiven Medizin, Probleme betreffen, die zum einen nicht auf die Medizin beschränkt sind und die zum anderen von einer fachübergreifenden Komplexität und gesellschaftlicher Relevanz sind, dass sie zusätzlicher spezifischer Kompetenzen bedürfen, um angemessen bearbeitet zu werden.[9]
In diesem Sinne befasst sich die Medizinethik, der am intensivsten bearbeitete Bereich der Bioethik, mit Fragen nach dem moralisch Gesollten, Erlaubten und Zulässigen im Umgang mit menschlicher Krankheit und Gesundheit.[10] Doch wie Schöne-Seifert betont, sind bereits Krankheit und Gesundheit Begriffe, „deren Konturen sich zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Kulturen deutlich unterscheiden. Veränderlich ist auch das Spektrum möglichen ‚Umgangs’ mit kranken Menschen: insbesondere vergrößert es sich rapide mit dem Kenntniszuwachs der modernen Medizin und Technologie. Und da schließlich auch die generellen menschlichen Moralauffassungen deutlich variieren, sind bereits die Fragestellungen der Medizinethik in weiten Teilen zeit- und kulturspezifisch.“[11]
Durch gendiagnostische Verfahren ist es heute möglich, bestimmte Krankheitsdispositionen bereits präsymptomatisch festzustellen und so erscheint es nur folgerichtig, dass sich die prädiktive Medizin zu einem Schwerpunkt der Medizin- und Bioethik entwickelt hat. Die Frage danach, was als gesund bzw. was als krank gilt, erhält durch die prädiktive Medizin nicht nur eine völlig neue Dimension, sie bewirkt auch, dass die Aufgaben der modernen Medizin hinterfragt werden müssen. Inwieweit ist z.B. eine erhöhte Disposition für eine Krankheit überhaupt ein Grund für ärztliches Handeln? Wenn es möglich ist, Behinderungen vorgeburtlich zu erkennen, stellt sich die Frage, wie mit dieser Möglichkeit umzugehen ist. Ganz grundsätzlich ist danach zu fragen, wie Behinderungen zu sehen sind und ob sie sich von lediglich unerwünschten Eigenschaften überhaupt abgrenzen lassen. Hierbei handelt es sich nicht um Fragen, die auf die Arzt-Patienten-Beziehung beschränkt sind, sondern deren Beantwortung gesellschaftlich beeinflusst ist und selbst wiederum Rückwirkungen auf die Gesellschaft hat.[12] Technische und wohl insbesondere biotechnische Entwicklungen kommen immer im Kontext gesellschaftlicher Erwartungshaltungen zur Anwendung und beeinflussen zugleich die Einstellungen der Menschen.[13] Diesen Wechselwirkungen kommt bei jeder Erörterung der ethischen Aspekte in der prädiktiven Medizin eine wesentliche Bedeutung zu.
2.3 Der Begriff „Prädiktive Medizin“
Unter dem Begriff der p rädiktiven Medizin werden verschiedene Konzepte zusammengefasst, deren Ziel die Voraussage der Krankheitsgeschichte für einen einzelnen Menschen ist. Dabei geht es um Voraussagen zu Gesundheit, Lebenserwartung und gesundheitsgefährdenden Risiken bestimmter Lebensstile sowie den damit verbundenen Möglichkeiten vorbeugender Maßnahmen. Prädiktive Diagnostik basiert auf Erkenntnissen, nach denen bestimmte Merkmale, Erkrankungen und Behinderungen aus bestimmten genetischen Anlagen abgeleitet werden können[14] und meint die „Diagnosestellung einer Erbanlage oder Disposition noch vor dem Auftreten klinischer Symptome.“[15] Die Anwendung prädiktiver Verfahren im pränatalen Bereich führt zur Pränatalen Diagnostik (PND) und zur Präimplantationsdiagnostik (PID).[16]
Mit der zunehmenden Entschlüsselung der Lage der Gene im menschlichen Genom haben sich die Möglichkeiten genetischer Untersuchungen in den letzten Jahren nachdrücklich erweitert. Dabei sind derzeit nicht mehr nur Erbkrankheiten mit einem einzigen defekten Gen (monogenetisch bedingte Erkrankungen) erkennbar, sondern auch Krankheiten, die durch das Zusammenspiel mehrerer Gene zustande kommen und bei denen neben genetischen auch andere bekannte oder unbekannte Faktoren außerhalb des Körpers zusammenwirken (multifaktoriell bedingte Erkrankungen). Bei den multifaktoriell bedingten Erkrankungen, die die überwiegende Zahl darstellen, steht die Forschung allerdings erst am Anfang. Viele Fragen sind noch ungeklärt, weshalb keine den monogenetisch bedingten Erkrankungen vergleichbare Risikodiagnose möglich ist. Dennoch bedeutet die fast vollständige Entschlüsselung des menschlichen Genoms eine Erweiterung des Spektrums vorgeburtlich diagnostizierbarer Krankheiten unterschiedlichen Schweregrads und mit unterschiedlichem Zeitpunkt ihrer Ausprägung. So kann z.B. bei den seltener auftretenden monogenetisch bedingten Krankheiten der Ausbruch infolge genetischer Dispositionen und unabhängig von Umweltfaktoren sowohl in einer frühen als auch in einer späteren Lebensphase erfolgen. Dementsprechend können die ethischen Probleme, die durch genetische Untersuchungen auf solche Krankheiten aufgeworfen werden, sehr unterschiedlich sein.[17]
2.4 Ethische Probleme der prädiktiven Medizin
Das ethische Grundproblem der prädiktiven Medizin besteht in dem Missverhältnis zwischen Wissen und Hilflosigkeit, zwischen den diagnostischen Möglichkeiten einerseits und den fehlenden Möglichkeiten medizinischer Hilfeleistung (Therapie, Prävention) andererseits. Dabei geht es vor allem um die Frage nach dem Sinn eine Indikation, d.h. welches Ziel wird mit dem Wissensgewinn einer Diagnose überhaupt verfolgt; um die Frage nach dem Umgang mit dem diagnostischen Wissen[18], sowie um die Frage nach den praktischen Konsequenzen, die aus dem Wissen gezogen werden.[19]
In der prädiktiven Medizin ist ein Befund oft lediglich eine Wahrscheinlichkeitsaussage über den Ausbruch einer Krankheit oder Fehlbildung. Eine frühzeitige Diagnostizierung von Krankheitsdispositionen erlaubt z.B. die Verhütung bzw. Behandlung der Krankheit, die Verringerung der Krankheitsrisiken durch eine entsprechende Lebensführung sowie die Vermeidung einer Weitergabe der Krankheitsdisposition an mögliche Kinder. Allerdings bewegt sie sich dabei immer im Spannungsfeld zwischen medizinischer Vorsorge und eugenischen Interessen bzw. überzogenen Gesundheitsvorstellungen. In ethischer Hinsicht geht es deshalb vor allem um eine Vermeidung des Missbrauchs der prädiktiven Diagnostik. Prädiktive Medizin unterstützt – ob sie das beabsichtigt oder nicht – ein biologistisches Menschenverständnis, welches den Menschen von seiner genetischen Ausstattung her erklärt, was mit der Gefahr verbunden ist, Ausgrenzungen von zukünftigen Kranken gegenüber Gesunden und Diskriminierungen nach erbstark bzw. erbschwach Vorschub zu leisten.[20]
2.5 Pränatale Diagnostik
Pränatale Diagnostik bzw. Pränataldiagnostik (PND) bietet die Möglichkeit, Fehlbildungen und Krankheitsanlagen während der Schwangerschaft zu erkennen.[21] Die Techniken zur Untersuchung menschlicher Chromosomen haben sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend verbessert, so dass eine Analyse der genetischen Anlagen heute zu einem deutlich früheren Zeitpunkt vorgenommen werden kann als noch vor ein paar Jahren. Parallel dazu hat eine Weiterentwicklung bei den biochemischen und sonographischen Analysen stattgefunden. Viele dieser Methoden sind in die Leistungskataloge der Krankenkassen aufgenommen worden und damit zum Bestandteil der routinemäßigen Schwangerenbetreuung geworden. Infolgedessen blieb es nicht aus, dass sich auch ein Wandel in der subjektiven Wahrnehmung in Bezug auf die medizinische Schwangerenvorsorge vollzog. Schwangere stehen heute vor der Wahl, eine Vielzahl von Möglichkeiten pränataler Diagnostik in Anspruch nehmen zu können. Dabei müssen medizinische, aber vor allem ethisch-moralische Entscheidungen getroffen werden, die bei vielen Eltern ganz zwangsläufig zu einer völlig neuen Bewertung z.B. behinderten Lebens führen.[22]
Pränatale Diagnostik kann einerseits zur Beruhigung dienen, indem sie ein bestimmtes Erkrankungsrisiko ausschließt bzw. den Eltern die Möglichkeit bietet, sich auf eine zu erwartende Erkrankung oder Behinderung des Kindes vorzubereiten, sie kann aber auch dazu führen, dass die werdenden Eltern sich zu einem Schwangerschaftsabbruch entschließen. Nur in den seltensten Fällen besteht die Möglichkeit einer frühzeitigen Therapie. Bei genetischen Veränderungen gibt es gar keine vorgeburtlichen Therapien, bei körperlichen Fehlbildungen sind sie nur in extrem seltenen Fällen möglich. Das Spannungsverhältnis zwischen dem Wohl des Ungeborenen einerseits und den Ansprüchen und Ängsten der Eltern andererseits definiert die Problematik der pränatalen Diagnostik. Allein Sinn und Zweck der Diagnose stellen ein ernsthaftes ethisches Problem dar, da das hohe Risiko, eine Schädigung des Embryos herbeizuführen, insbesondere bei den invasiv-pränataldiagnostischen Methoden, in vielen Fällen weder durch den (fehlenden) therapeutischen Nutzen noch durch die (geringe) genetisch bedingte Beeinträchtigung des heranwachsenden Kindes zu rechtfertigen ist. Ethisch vertretbar ist die Pränataldiagnostik nur, wenn sie das Lebensrecht des Ungeborenen achtet, auch wenn dabei eine Abwägung zwischen den Interessen der Eltern einerseits und denen des Kindes andererseits kaum ausbleiben kann.[23]
2.6 Präimplantationsdiagnostik
Mit dem Begriff Präimplantationsdiagnostik (PID) wird die genetische Diagnostik an einem in vitro befindlichen Embryo bezeichnet, bevor dieser einer Frau implantiert wird. Sie ermöglicht es, Embryonen, die durch eine künstliche Befruchtung außerhalb des Mutterleibs erzeugt worden sind, Zellen zu entnehmen und deren Erbgut auf bestimmte genetische Merkmale, Chromosomenstörungen bzw. das Vorliegen krankheitsrelevanter Merkmale hin zu untersuchen. Da dem Embryo wegen seiner geringen Größe (4 bis 10 Zellen) nicht mehr als eine oder zwei Zellen entnommen werden können, stellt die Untersuchung hohe Ansprüche an die dafür verwendete Methodik sowie an die Qualifikation des Personals. In den ersten Versuchen konzentrierte man sich daher auf die Untersuchung von Merkmalen, die unter diesen Bedingungen sicher zu bestimmen waren. Da von vielen X-chromosomal gebundenen Erbkrankheiten meist nur männliche Kinder betroffen sind, wurden die ersten Diagnosen durchgeführt, um das Geschlecht von Embryonen zu bestimmen, bei denen das Risiko einer geschlechtschromosomal gebundenen Erbkrankheit vorlag (z.B. Hämophilie). So kann der Transfer eines männlichen Embryonen und damit die Geburt eines Jungen, der möglicherweise von der Krankheit betroffen ist, vermieden werden. Bald gelang es, auch Veränderungen in einzelnen Genen sichtbar zu machen. In den USA kommt die PID seit 1990 zur Anwendung.
Bereits durch die erstmals 1978 erfolgreich durchgeführte In-vitro-Fertilisation (IVF) wurden menschliche Embryonen in ihrem frühesten Entwicklungsstadium außerhalb des weiblichen Körpers zugänglich. Bis zur ersten Befruchtung außerhalb des Mutterleibes war eine lange Zeit der Forschung nötig, in der mehr als 200 Embryonen verbraucht wurden. Die Techniken zur Untersuchung des genetischen Status von In-vitro-Embryonen haben sich in den letzten Jahren vor allem in den USA, Großbritannien und Belgien etabliert. Sie zielen darauf ab, erkennbare pathologische Veränderungen am Erbmaterial der Eizelle oder des Embryos bereits vor der Etablierung einer Schwangerschaft zu erkennen, um Embryonen mit krankhaften Gen- bzw. Chromosomenveränderungen vom Transfer in den Körper der Frau auszuschließen. Somit handelt es sich bei der PID – im Gegensatz zur Pränataldiagnostik, bei der es um die Untersuchung einer vorliegenden Schwangerschaft und bei einem pathologischen Befund um die Frage ihrer Weiterführung geht – um eine Selektionstechnik, bei der unter mehreren erzeugten Embryonen nur diejenigen ausgewählt und implantiert werden, die die untersuchten genetischen Merkmale nicht aufweisen.[24]
Ziel der PID ist es, Paaren mit einem erhöhten Risiko für Erbkrankheiten ihren Wunsch nach einem genetisch nicht belasteten Kind erfüllen. „Mit Hilfe zyto- und molekulargenetischer Methoden können [...] schon in einer sehr frühen Phase der Entwicklung menschlichen Lebens Veränderungen (Mutationen) im Erbgut untersucht und erkannt werden, die auch zu schweren körperlichen und geistigen Fehlbildungen führen.“[25] Das Verfahren hilft damit, Enttäuschungen und Probleme zu vermeiden, die durch die Geburt eines behinderten Kindes ausgelöst werden können und stellt eine Alternative für risikobehaftete Eltern dar, die sich weder für einen Kinderverzicht noch für eine Adoption entscheiden wollen. Der Vorteil ist, dass dem Paar auf diese Weise von vornherein die mit einem Schwangerschaftsabbruch infolge eines pränataldiagnostischen Befundes verbundenen Belastungen erspart bleiben.[26]
Die ethische Problematik des Verfahrens liegt darin begründet, dass die Embryonen in der klaren Absicht erzeugt werden, gegebenenfalls vernichtet zu werden, womit die in dieser Arbeit zu erörternde Frage aufgeworfen wird, ob das Ziel, also die Erfüllung eines Kinderwunsches, ein solches Mittel zu seiner Realisierung rechtfertigt. Zudem wirft die PID eine Reihe weiterer, sowohl für die Betroffenen als auch für die Gesellschaft relevante, Fragestellungen auf, insbesondere danach, ob der selektive Embryotransfer ein Werturteil gegenüber dem Leben mit Krankheit und Behinderung darstellt, ob die Sichtbarmachung genetischer Merkmale beim Embryo zu übertriebenen Gesundheitsvorstellungen führt sowie ob sich hierbei eugenische und diskriminierende Tendenzen abzeichnen. Insbesondere auch die Tatsache, dass die untersuchten, möglicherweise totipotenten Zellen [27] im Rahmen der Diagnostik zerstört werden, wird in der Literatur als höchst bedenklich eingestuft.[28]
3 Der moralische Status von Embryonen und Feten
In der Bioethikdebatte nimmt die Frage nach dem moralischen Status von Embryonen und Feten eine Schlüsselstellung ein. Stellte sich diese Frage in der Vergangenheit ausschließlich in Bezug auf den Abbruch einer bereits eingetretenen Schwangerschaft, so muss sie jetzt durch die Möglichkeit der Existenz von Embryos in vitro auf den Komplex Fortpflanzungsmedizin, Präimplantationsdiagnostik und Embryonenforschung ausgedehnt werden. So wird etwa die Erzeugung, die Forschung und der Verbrauch von menschlichen Embryonen davon abhängig gemacht, welcher moralische Status ihnen zukommt: Sind Embryonen schon Menschen im Sinne des Grundgesetzes und genießen sie damit Würde und konstitutionelle Rechte? Wann beginnt eigentlich das menschliche Leben und nach welchen Kriterien bemisst sich dessen Schutzwürdigkeit?
3.1 Zur Debatte um den Begriff der „Person“
Die Diskussion um den – an sich schon äußerst schwierigen – Fragenkomplex wird noch einmal erschwert durch verschiedene Definitionen des zentralen Begriffs der Person, der von einigen Autoren benutzt wird, um achtens- und schützenswerte Individuen von solchen abzugrenzen, die keinen Anspruch auf Würde, Schutz und Lebensrecht erhalten. Auch wenn sich z.B. Steigleder überzeugt gibt, dass „nach Auffassung vieler Moralphilosophen […] die Unterschiede hinsichtlich des moralischen Status von Personen und Nicht-Personen tiefgreifend“[29] sind, ist es unter Medizinethikern seit Jahren ein fundamentaler Streitpunkt, ob man in einem normativ relevanten Sinne überhaupt zwischen Personen und Nicht-Personen unterscheiden könne und dürfe.[30]
Besonders einflussreich ist das Kriterium des Personseins in der Bioethik-Diskussion im angelsächsischen Raum. Ausgehend von dem Philosophen Michael Tooley stützen eine Reihe von Autoren ihre Argumentation auf die Prämisse der Personalität, wobei in den verschiedenen Konzepten deren Zuschreibung bzw. Vorenthaltung über die Gewährung bzw. Nichtgewährung eines individuellen Lebensschutzes entscheidet. Unklar bleibt dagegen oft, welches Kriterium konkret über den Personenstatus entscheidet. Angesichts der Gefahr von Missverständnissen und der Vielfalt von Interpretationsmöglichkeiten, welche Eigenschaften und Fähigkeiten (z.B. Selbstbewusstsein, Schmerzempfinden) denn überhaupt mit einer Person zu verbinden sind, liegt für viele Kritiker der Verdacht einer Scheinlegitimation nahe. Für Leist beispielsweise kann es für die moralische Beurteilung des Tötens nicht relevant sein, ob jemand durch Selbstbewusstsein oder andere Eigenschaften als Person wertgeschätzt wird, sondern relevant ist für ihn nur, dass das herangezogene Kriterium (hier: Selbstbewusstsein) selbst gegen das Töten spricht, weshalb er es grundsätzlich problematisch findet, das Statusproblem von Embryonen unter die Klärung des Personseins zu stellen.[31]
Problematisch bei allen Argumentationen, die den Begriff der Person zur Grundlage ihrer Ethik machen, scheint die Tatsache, dass ausgewählte Eigenschaften in den Mittelpunkt gestellt werden und nicht deren Träger selbst, weshalb sich der Personenstatus zwangsläufig auch auf nicht-menschliche Individuen ausweiten lässt. Umgekehrt lassen sich menschliche Individuen vom Schutz ausschließen, weil sie bestimmten Kriterien nicht entsprechen. „Im Ergebnis werden nicht das Individuum, die ‚Person’-tragende Substanz, sondern deren Eigenschaften geachtet“, schreibt Oduncu[32] und warnt davor, dass der Instrumentalisierung von Embryonen zu fremden Zwecken damit Tür und Tor geöffnet wird. Eine Ethik, die lediglich aufgrund von aktuellen vorweisbaren Eigenschaften einem Individuum einen Personenstatus zuerkennt, einem anderen nicht, entbehre jeder Grundlage.[33]
Aus Sicht derjenigen, die eine Unterscheidung zwischen Person und Nicht-Person ablehnen, „erscheint es besonders infam, unter Verwendung eines nur scheinbar deskriptiven und geläufigen Alltagsbegriffes wie ‚Person’ Embryonen […] zu diskriminieren“, gibt Schöne-Seifert[34] zu bedenken. Und Steigleder stellt die rhetorische Frage, welche spezifische Eigenschaft es denn sei, die dem Menschen im Unterschied zum Tier einen moralischen Status verleihe, um in Bezugnahme zur traditionellen Antwort – der Mensch sei ein animal rationale und die Vernünftigkeit begründe den Unterschied – zu der Feststellung zu gelangen, dass damit die Kategorie Würde ja nur auf einen Teil der Menschen anwendbar wäre, nämlich auf rationale, bewusste und selbstbewusste Wesen. Will man solche Menschen Personen nennen, dann sei es angemessener von Personen würde statt von Menschenwürde zu sprechen. Der Begriff Menschen würde und die mit ihr einhergehenden Menschen rechte schienen in diesem Sinne auf Handlungsfähige beschränkt zu sein und würden jene Menschen, die diese Eigenschaften nicht haben, also Embryonen und Feten, auch nicht umfassen. Die Trennlinie verliefe nicht zwischen Mensch und Tier sondern zwischen Mensch und Mensch.[35]
3.2 Der Beginn des menschlichen Lebens
Die Kriterien Vernünftigkeit oder Personalität scheinen also wenig geeignet zu sein, Würde und einen moralischen Status zu begründen. Welches Kriterium entscheidet aber dann über den Wert menschlichen Lebens? Wann beginnt menschliches Leben? Und: Muss nicht eigentlich auch zwischen menschlichem Leben (was ja auch in der unbefruchteten Eizelle und im Spermium existiert) und menschlichem Individuum (dessen Leben erst nach Vereinigung der beiden haploiden Kerne beginnt) unterschieden werden?
Die Debatte um dieses Thema ist durch eine Verknüpfung von biologischen, sozialen und metaphysischen Argumenten gekennzeichnet.[36] Und doch findet die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens in Abhängigkeit von kulturellen, religiösen, wissenschaftlichen und weltanschaulichen Gesichtspunkten ganz unterschiedliche Antworten. Einige außerhalb der europäisch-monotheistischen Prägung stehende Kulturen legen den Beginn des Menschseins erst in den Zeitraum nach der Geburt und bewerten den Schwangerschaftsabbruch oder die Tötung von Neugeborenen als legitim. Andere Auffassungen sehen die Herausbildung von Hirnstrukturen nach der 6. Schwangerschaftswoche (SSW) bzw. die Einnistung (Nidation) der befruchteten Eizelle (Zygote) in den Uterus zwischen dem 4. und 8. Tag nach der Befruchtung als wesentlich für den Beginn des Personseins an. Die christliche Tradition setzt den Personbeginn mit der Bildung der Zygote gleich, was als Beseelung bezeichnet wird.[37]
Auch in der wissenschaftlich-medizinischen Forschung wird die Verschmelzung der Kerne von Ei- und Samenzelle heute als der biologische Beginn des menschlichen Lebens angesehen. Seit Ende der 1960er Jahre steht die molekulargenetische fundierte Einsicht, dass die Zygote die wesentlichen prospektiven Potenzen zur vollständigen menschlichen Entwicklung aufweist.[38] Die Zygote besitzt ein humanspezifisches und einzigartiges Genom und ist unter geeigneten Bedingungen in der Lage, sich zur Gestalt eines erwachsenden Menschen zu entwickeln. Nach biologisch-medizinischen Erkenntnissen beginnt mit der Kernverschmelzung eine kontinuierliche sich selbst steuernde Entwicklung des Embryos, der dabei als eine funktionelle, dynamische und sich selbst organisierende Einheit agiert. Auf diesem Urteil basiert auch der im Embryonenschutzgesetz gefundene Konsens, den Embryo von der Kernverschmelzung an als schützenswert zu behandeln.[39] An dieser Stelle erscheint es sinnvoll, die in der Literatur verwendeten speziellen Bezeichnungen für vorgeburtliches Leben zu differenzieren. Es wird unterschieden zwischen den Begriffen befruchtete Eizelle, Zygote, Präembryo, Embryo und Fetus (Fötus).[40]
Die Bezeichnung befruchtete Eizelle wird von vielen Autoren abgelehnt, da sie den Eindruck eines fließenden Übergangs von einem Stadium (unbefruchtetes Ei) zum anderen (befruchtetes Ei) vermittelt, während es sich ihrer Meinung nach bei der Befruchtung in Wirklichkeit um einen entscheidenden Bruch zwischen Nichtperson und Person handelt, um den Anfang des menschlichen bzw. personalen Lebens. Dennoch spricht das österreichische Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) z.B. von befruchteten und entwicklungsfähigen Eizellen, und vermeidet damit ganz bewusst eine normative Definition der Begriffe Embryo und Zygote, was vor allem mit dem österreichischen Abtreibungsrecht und den in diesem Zusammenhang relevanten grundrechtlichen Klärungen zum Recht auf Leben zusammenhängt[41], worauf an anderer Stelle näher eingegangen wird.[42]
Bei der Befruchtung verschmelzen Ei- und Samenzelle zur Zygote. Demgemäß wird nahezu einstimmig von einer Zygote gesprochen, wenn sich zwei Gameten vereinigen und durch das Eindringen des Spermiums in das Plasma der Eizelle eine neue Zelle entsteht, die bereits die volle artspezifische genetische Information besitzt. „Die 46 Chromosomen in der Zygote sind eine neue Art, eine neue Wirklichkeit, so daß gesagt werden kann, daß alle Eigenschaften, die ein Erwachsener aus der Evolution erhält, bereits in der Zygote enthalten sind.“[43] Dass diese Einsicht noch keineswegs einer eindeutigen Antwort auf die Frage, ob es sich bei Zygote und Person um ein und denselben Menschen handelt, gleichkommt, darauf verweist Körner, wenn er schreibt: „Zygote und Person sind in der Grundkonstitution der Gene identisch, und sie sind ‚entwicklungsidentisch’ dasselbe Individuum. Aber Zygote und Person sind zugleich nicht identisch, denn weder hat die Zygote die Eigenschaften der Person, noch sind alle wesentlichen Eigenschaften der Person schon in den Genen eindeutig festgelegt.“[44]
Nicht nur Steigleder ist der Überzeugung, dass zwischen der befruchteten Eizelle und ihren weiteren Entwicklungsstadien bis zum 14. Tag (Präembryo) und dem eigentlichen Embryo im strikten Sinne unterschieden werden muss.[45] In großen Teilen der Fachliteratur wird die ersten 14 Tage nach der Befruchtung betreffend nahezu selbstverständlich statt von Embryo von Präembryo ge sprochen, wobei der Begriff nach Ansicht von Kritikern untrennbar mit einer Bewertung des moralischen Status ungeborenen Lebens und mit der Liberalisierung der Forschung an ihm verbunden ist. Wie Körtner betont, ist das Bemühen um terminologische Klärung „kein bloßes Spiel mit Worten, weil mit den unterschiedlichen Begriffen verschiedene ontologische und ethische Optionen verbunden sind. Ob man z.B. die Zygote als artspezifisches menschliches Leben oder aber, wie manche kirchliche Stellungnahmen als ‚embryonalen Menschen’ auffasst, macht ethisch und in letzter Konsequenz auch rechtlich einen erheblichen Unterschied.“[46] Und so wurde die Bezeichnung preembryo 1986 in Großbritannien auch eingeführt, um mögliche gesetzliche Beschränkungen in der frühen Embryonenforschung zu umgehen.[47] Seitdem steht die Bezeichnung heftig in der Kritik und wird von manchen Autoren als „Konstrukt der Juristen“ angesehen bzw. als „begriffliche Etikettierung“[48], die von der ethischen Problematik der Embryonenforschung ablenken soll, indem sie suggeriere, dass das Leben des Menschen nicht mit der Befruchtung beginne.
In Übereinstimmung mit dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer bezeichnet der Begriff Embryo das Stadium nach Abschluss der Keimzellenverschmelzung bis zum Abschluss der Organogenese in der 8. Woche nach der Befruchtung. Im deutschen Embryonenschutzgesetz ist eindeutig festgelegt, dass als Embryo bereits „die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an“[49] gilt.
Das Ende des zweiten Monats halten Embryologen für einen wichtigen Einschnitt, da die einsetzende Knochenbildung anzeigt, dass die strukturelle Aufbauphase in eine funktionelle übergeht. Die Körperform ist zu diesem Zeitpunkt gut sichtbar. Daher rührt auch die aus dem Griechischen stammende Unterscheidung zwischen Embryo (= schwellen) und Fetus oder Fötus, der das Junge bzw. die Leibesfrucht bezeichnet. Zumeist wird mit Abschluss der Organogenese, d.h. nach der Ausbildung der inneren Organe von der Fetalperiode gesprochen, die von der 9. Woche nach der Befruchtung bis zur Geburt andauert.[50]
3.3 Der Beginn der Schutzwürdigkeit
In direktem Zusammenhang mit der Debatte um den Beginn des menschlichen Lebens steht die Frage nach dem Beginn der sozialen Schutzwürdigkeit. Durch welche Faktoren beginnt vorgeburtliches Leben moralisch relevant und damit ein schutzwürdiges Gut zu sein bzw. an welches Kriterium kann Schutzwürdigkeit gebunden werden? Der Schutz des Embryos vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung (Zygote) an bildet dabei die grundsätzlichste Position, während so genannte graduelle Konzepte die Schutzwürdigkeit von einer bestimmten Stufe der embryonalen Entwicklung abhängig machen.[51]
Während die meisten Autoren es als problematisch ansehen, dass nach einer objektiven unverrückbaren Grenzmarke für den Beginn der Schutzwürdigkeit vorwiegend mittels naturwissenschaftlicher Fakten gesucht wird, während eine solche Entscheidung doch im Grunde nichts anderes als eine an praktischen Lebensumständen und weltanschaulichen Ideologien ausgerichtete Wertefrage sein kann, fordert Hans-Martin Sass für die ethische Bewertung des Anfangs des menschlichen Lebens ähnlich konsensfähige Kriterien zu finden, wie es mit der Hirntodfeststellung für das Lebensende gelungen sei.[52] Da die Vernunft das wohl bestimmendste Merkmal der Gattung Mensch ist, und auch in Analogie zum Hirntodmodell, liegt es Sass zufolge nahe, den Beginn des menschlichen Lebens bzw. den seiner Schutzwürdigkeit mit dem Beginn von Hirnaktivitäten zu verbinden. Sass sieht die Notwendigkeit für einen „vollen rechtlichen Schutz und die volle ethische Solidarität und Achtung“[53] des menschlichen Lebens mit dem ersten Auftreten neuronaler Aktivitäten im Hirnstamm um den 57. Tag nach der Befruchtung gegeben. Zuvor könne lediglich von biologisch menschlichem Leben, Organleben, Zell-Leben, oder Gewebeleben gesprochen werden. „Die durch die Synapsenbildung erst ermöglichte Funktionsfähigkeit des Gehirns ist biologisches Korrelat zum personalen Leben des menschlichen Individuums. Erst die zentrale neuronale Steuerung, Schmerzempfindung und Kommunikation, Bewußtsein und Selbstbewußtsein machen den Menschen aus.“[54] Als Konsequenz aus seinem Konzept fordert Sass, dass der rechtlich sanktionierte Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. SSW aufgegeben und ersetzt wird durch eine Frist, die nicht über den 57. Tag nach der Befruchtung hinausgeht. Außerdem sollte die Forschung an frühen Embryonen bis zu diesem Zeitpunkt zugelassen werden, den Schutz vor Missbrauch vorausgesetzt.[55]
Problematisch an allen Gehirnleben-Definitionen ist die Tatsache, dass sich der gesamte neuronale Reifungsprozess über einen sehr langen Zeitraum erstreckt, der selbst nach der Geburt nicht vollständig abgeschlossen ist. Somit kann im Grunde auch kein bestimmter Zeitpunkt festgelegt werden, ab welchem die Reifung des Nervensystems für Zuschreibungen wie Personalität oder Schutzwürdigkeit ausreicht.[56] Im Gegensatz zum Hirntod-Modell gibt es keinen Konsens darüber, ab welchem Zeitpunkt das Gehirn ausreichend „Leben“ enthält, um den Embryo zum Menschen erklären zu können. Seine Definition begründet Sass z.B. damit, dass die Neuronen spätestens 57 Tage nach der Befruchtung ihre Teilungsfähigkeit verlieren, wobei die für die biologische Funktionsfähigkeit des Gehirns notwendigen Vernetzungen (Synapsen) frühestens am 70. Tag auftreten. Das sich bildende Gehirn ist also bereits nach zwei Monaten vorhanden, bis sich die ca. fünf Milliarden Zellen gänzlich entwickelt haben, dauert es allerdings neun Monate und erst nach sieben oder acht Jahren sind die unzähligen Verknüpfungen komplett. Da keine Einigkeit darüber besteht, welche Funktionen des Gehirns realisiert sein müssen, um berechtigterweise vom Beginn des Hirnlebens sprechen zu können, kann auch kein übereinstimmender Zeitpunkt in der embryonalen Entwicklung gefunden werden, um vom Beginn des Menschseins sprechen zu können. Hinzu kommt die Tatsache, dass man im Grunde schon ein Mensch sein muss, um ein Gehirn entwickeln zu können, denn das Leben ist nicht einem funktionierenden Gehirn zu verdanken, sondern umgedreht führt die Entwicklung des Organismus erst zur Entstehung des Gehirns, das daher auch kaum den Ausschlag für biologisch menschliches Leben geben kann.[57]
Da man weder nach dem 57. noch nach dem 70. Embryonentag von funktionsfähigem Gehirngewebe sprechen kann, sieht Körner in dem Ansatz von Sass, der den Beginn der Bildung synaptischer Strukturen als den Beginn des Menschseins deklariert, daher auch nichts anderes als die symbolische Zuweisung einer Funktion, die sich erst im späteren Leben realisiert, genau genommen also um eine dem Bereich der Potentialität zugehörige Auslegung.[58] Auch Breuer schreibt: „Die potentielle Möglichkeit der Gehirnentwicklung ist somit ausreichend, um der Zygote bzw. dem Embryo den gleichen Wert beizumessen wie dem entwickelten Menschen, da die Anlage für die Entstehung eines Gehirns bzw. für die Ausübung von gehirnabhängigen Leistungen vorhanden ist.“[59]
Das hier als Potentialität bezeichnete Kriterium verweist auf eine von insgesamt sechs Argumentationen in der ethischen Debatte um moralischen Status und Schutzwürdigkeit von Embryonen. Auch wenn Honnefelder[60] schreibt, Kontinuums-, Identitäts-, Potentialitäts- und Speziesargument seien nicht voneinander zu trennen, da sie sich alle wechselseitig bedingen, und auch wenn Merkel[61] betont, dass letztlich keines dieser Argumente den Schutzanspruch des Embryos z.B. gegenüber dem Wunsch prospektiver Eltern auf ein genetisch gesundes Kind plausibel begründen kann, werden die Grundposition im Folgenden einzeln dargelegt.
3.4 Absolute Schutzkonzepte
3.4.1 Das Potentialitätsargument
Das von Michael Tooley 1974 so benannte Potentialitätsargument gilt als das einflussreichste und stärkste der sechs Argumente. Problematisch ist allerdings, dass der Begriff der Potentialität je nach Quelle sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Das Argument gründet sich im Wesentlichen auf zwei Sichtweisen, nach denen Embryonen ab der Befruchtung einen moralischen Anspruch auf Lebensschutz haben, weil sie:
a) das Potential, d.h. das reale Vermögen besitzen, sich unter bestimmten Bedingungen zu einem geborenen Menschen zu entwickeln;
b) sämtliche Eigenschaften und Fähigkeiten, die einem geborenen Menschen Würde verleihen, zwar noch nicht real, so doch zweifelsohne potentiell besitzen, d.h. es handelt sich um künftig erwartbare Eigenschaften, weshalb man Embryonen auch so behandeln müsse, als besäßen sie diese schon tatsächlich aktual.[62]
Aus dem undifferenzierten Gebrauch des Begriffs der Potentialität ergeben sich eine Reihe von Schwierigkeiten für die Begründung des Potentialitätsarguments, wie Breuer feststellt: „Einerseits besteht die Möglichkeit herauszustellen, daß der Embryo potentiell ein menschliches Wesen bezeichnet und andererseits, daß der Embryo ein menschliches Wesen mit potentiellen Eigenschaften ist. Während erstere die Potentialität des Embryos auf sein Personsein beziehen, wird sie von anderen auf die Entfaltung seiner Fähigkeiten (des Personverhaltens) bezogen, wobei im zweiten Fall vorausgesetzt wird, daß der Embryo bereits ein Mensch ist.“[63]
Viele Kritiker weisen das Potentialitätsargument als unplausibel zurück. Das populärste Gegenargument gibt zu bedenken, dass es grundsätzlich nicht einzusehen sei, warum Potentialität moralisch relevant sein soll, da schließlich ein potentieller Olympiasieger auch nicht bereits als Olympiasieger gilt, Prinz Charles als potentieller König nicht bereits die Rechte eines Königs in Anspruch nehmen könne und ein potentieller Mörder nicht schon hinter Gitter gehalten werde. Wie an diesen Beispielen zu sehen, werden potentielle und aktuelle Eigenschaften und Zustände in der Regel also keineswegs gleichgesetzt.[64] Düwell wendet gegen das Prinz-Charles-Argument berechtigterweise ein, dass Prinz Charles dennoch einen anderen Status hat als z.B. ein Londoner Taxifahrer, was auf das Thema bezogen bedeute, dass potentielle Personen zwar nicht den gleichen Status wie Personen haben, aber gleichwohl bleibe festzustellen, sie haben einen moralischen Status.[65] Sass unterscheidet dagegen zwischen der aktiven Potentialität z.B. schlafender Menschen und der passiven Potentialität, zu deren Realisierung noch etwas Zusätzliches hinzutreten muss. So haben alle Menschen die passive Potentialität, z.B. Bundeskanzler zu werden, doch werden daraus keinerlei Rechte für den Einzelnen abgeleitet.[66]
Zudem wird gegen das Potentialitätsargument der Einwand hervorgebracht, dass man dann ja auch Gameten und möglicherweise sogar allen menschlichen Körperzellen Würde zusprechen müsste, da sie ebenso die Potentialität besitzen, unter geeigneten Bedingungen zu Embryonen und später zu Menschen heranzureifen.[67] „Da aber niemand ernsthaft auf die Idee käme, für Ei- und Samenzelle einen moralischen Schutzstatus zu fordern, wiewohl sie das gleiche Potential wie der Embryo hätten, tauge ein solches Potential offensichtlich nicht dazu, jenen Status zu begründen“[68], schreibt der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel. Gegen das „Abgrenzungsproblem“[69], wie es Leist nennt, wäre einzuwenden, dass Keimzellen lediglich die Potentialität besitzen, zu einem Menschen zu werden, während Zygoten und Embryonen dem gegenüber die Potentialität haben, sich selbst zu entwickeln. Wie Breuer darlegt, sei dies eine radikale Verschiedenartigkeit des Potentials, worin seiner Ansicht nach auch begründet liege, dass nur dem Embryo bzw. der Zygote, nicht aber einzelnen anderen Zellen der Status einer Person zugesprochen werden muss.[70] Steigleder verweist auf Buckles Vorschlag einer Differenzierung zwischen der Potenz (des Präembryos), etwas hervorzubringen, nämlich den eigentlichen Embryo, und der Potenz (des Embryos), etwas zu werden, nämlich ein handlungsfähiger Mensch. Wir können nicht sagen, dass wir einmal eine befruchtete Eizelle waren, sondern nur, dass es einmal befruchtete Eizellen gegeben hat, welche den Embryo hervorbrachten, der wir einmal waren. Somit gelte das Potentialitätsargument für menschliche Embryonen im strikten Sinne, nicht aber für Präembryonen, so Steigleder.[71]
Noch schwieriger gestaltet sich die Argumentation, wenn es sich um verbrauchende Embryonenforschung und Präimplantationsdiagnostik handelt. Merkel macht darauf aufmerksam, dass es ein Unterschied sei, ob der Embryo im Wege einer natürlichen Zeugung entstanden sei, oder ob es sich um einen durch künstliche Befruchtung erzeugten Embryo handle. Denn ohne die äußere Intervention eines Transfers in eine Gebärmutter kann sich der in-vitro -fertilisierte und noch nicht implantierte Embryo nicht zum geborenen Menschen entwickeln. Daher besitze er, nach Ansicht vieler Autoren, kein selbstständiges Entwicklungspotential und damit auch keinen moralischen Status. Merkel selbst allerdings hält diese Argumentation für die Klärung einer moralischen Frage für wenig überzeugend, da nahezu jedes Potential von günstigen Bedingungen seiner äußeren Umwelt abhänge. Einen moralischen Status abzulehnen mit der Begründung, das Potential sei in Wahrheit keines, da dessen Verwirklichung von dem Eingreifen dritter abhänge, sei nicht plausibel, da die Pflicht zur Implantation ja gerade zu jenen normalen Umweltbedingungen gehöre, deren Vorhandensein für die Klärung der Frage, ob von einem Potential die Rede sein kann, vorausgesetzt werden muss.[72]
Die gegensätzlichen Argumente für und wider das Potentialitätsargument lassen zumindest Zweifel an dessen Relevanz zur Klärung der Frage des moralischen Status von Embryonen aufkommen. Anton Leist formuliert es deutlicher: „Föten sind zwar potentiell erwachsene Menschen, aber das ist moralisch irrelevant.“[73]
3.4.2 Das Speziesargument
Anhänger des Speziesarguments sind der Auffassung, dass Embryonen allein deshalb einen moralischen Status und Schutzwürdigkeit besitzen, da sie biologisch der Spezies Homo sapiens angehören und alle Angehörigen dieser Spezies nach dem Prinzip der Gleichbehandlung ein Grundrecht auf Leben haben, ganz unabhängig davon, welche tatsächlichen Eigenschaften sie aktual haben.
Doch gerade das Gebot der Gleichbehandlung wird von Kritikern gegen dieses Argument ausgelegt, da es beinhaltet, Gleiches gleich zu behandeln und daher kann es einen Schutz des Embryos erst dann gewährleisten, wenn zuvor dessen Status als der eines normativ Gleichen feststeht. Doch darum wird ja gerade erst gestritten.[74] Ähnlich lautende Argumente sehen es als unbegründet an, dass aus einer bloß biologischen Eigenschaft (der Mitgliedschaft zur Spezies Mensch) irgendetwas Normatives folgt. Unplausibel, so der Vorwurf, sei das Speziesargument vor allem, wenn es speziesistisch[75] interpretiert würde, also all jene Wesen, die nicht zur Spezies Mensch gehören, aus dem Schutzbereich der Moral ausklammern würde.[76] Man brauche sich, um die Zusammenhänge zu verdeutlichen, nur einmal zu fragen, so Merkel, ob es plausibel wäre zu sagen, „allein deshalb, weil die molekulare Mikrostruktur der Basenpaare unserer DNA so und so beschaffen ist, haben wir so etwas Anspruchsvolles wie fundamentale Rechte.“[77]
Merkel zufolge liege das Speziesargument einem naturalistischen Fehlschluss auf und besitzt daher keine Gültigkeit: Embryonen mögen sehr wohl ein Schutzrecht beanspruchen, aber dies folge nicht aus deren Gattungszugehörigkeit. Denn auch bei allen geborenen Menschen wird die Tatsache, dass sie Grundrechte haben, nicht aus dem bloßen Faktum ihrer biologischen Beschaffenheit als Mitglieder einer bestimmten Spezies abgeleitet. Allein speziestypische, moralisch schutzwürdige Eigenschaften können dies begründen. Frühe Embryonen weisen keine einzige dieser Eigenschaften auf. Der Einwand, dass im Grunde die Eigenschaften und nicht die Spezieszugehörigkeit ausschlaggebend für die Schutzwürdigkeit sind, wird noch einleuchtender, durch das von Tooley hervorgebrachte und von Leist aufgegriffene (wenn auch etwas abwegige) Beispiel der intelligenten Außerirdischen, die man ja aus moralischen Gründen auch nicht vernichten würde, nicht weil sie der Spezies homo sapiens angehören, sondern weil sie eine Reihe von Eigenschaften mit den Menschen teilen.[78]
3.4.3 Das Identitätsargument
Der Grundgedanke des Identitätsarguments verweist auf das intuitive Selbstverständnis des Ichs, wenn es – die eigene Herkunft betreffend – die Personalität auf den Akt der Befruchtung zurückprojiziert, indem man z.B. sagt: „ ICH wurde von X und Y als meinen leiblichen Eltern gezeugt.“[79] Das Identitätsargument besagt im Wesentlichen: „Aus der Identität des Erwachsenen mit dem Embryo, aus dem er sich entwickelt hat, und der Tatsache, daß der Erwachsene eine Menschenwürde hat, kann man auf die Würde des Embryos schließen.“[80] Das Argument basiert auf den zwei zentralen Annahmen, dass die Menschenwürde dem Menschen essentiell ist und nicht erst im Laufe seiner Existenz erworben wird, und dass der Embryo seiner Natur nach mit dem daraus hervorgehenden Mensch tatsächlich identisch ist. Die Argumentation stützt sich auf die Überzeugung, dass die Schutzwürdigkeit demnach von keinem anderen Sachverhalt abhängig zu machen ist als dem, dass schon beim frühesten Embryo in entscheidender Hinsicht eine Identität mit der Person, die später aus ihm werden kann, besteht. Die Frage nach dem Beginn der eigenen Identität kann allein durch den Hinweis auf die Vereinigung von Ei- und Samenkern eine befriedigende Antwort finden.[81]
Dabei ist zu fragen, was der Begriff Identität eigentlich bedeutet, d.h. was konkret die entscheidende Hinsicht ist, in der frühester Embryo und späterer Mensch identisch sind. Die Antwort zeigt, dass sich nur eine einzige Identitätsbeziehung herstellen lässt, nämlich die der DNA, des individuellen menschlichen Genoms[82]. Es handelt sich also um eine Identität, die als genetisch-biologische Identität verstanden wird und sich bereits in der aus der Befruchtung hervorgegangenen Zygote konstituiert hat. Dagegen kritisiert Leist, dass einige genetische Details sich erst nach der Befruchtung ausbilden und genetische Anlagen, etwa bei Menschen mit dem Down-Syndrom, auch im weiteren Leben verändert werden.[83] In ähnlicher Weise betont Engels, dass die Zygote allein noch nicht den späteren Menschen darstelle, sondern dieser sich erst in einer komplexen Wechselwirkung zwischen Zygote bzw. Embryo und Umwelt herausbilde: „Identität scheint dann, wenn überhaupt, nur der DNA eines Organismus zuzukommen, während Gene ihrer Rolle als expressionsrelevante Informationsträger in entscheidendem Maße durch den Kontext mitbestimmt werden.“[84] Bereits die Erörterung des Speziesarguments habe gezeigt, so Merkel, dass die Mikrostruktur der DNA allein (als bloße biologische Eigenschaft) nicht ausreiche, eine ethische Schutznorm zu begründen.[85]
Andere Autoren sehen mit dem Identitätsargument vor allem zwei Hauptschwierigkeiten verbunden. Zum einen wird die Identitätsbehauptung angezweifelt, da in den ersten 14 Tagen nach der Befruchtung noch die Möglichkeit einer Zwillings- bzw. Mehrlingsbildung besteht, was ausschließt, von genau einem Individuum zu sprechen. Zum anderen gebe es ein Abgrenzungsproblem, da der eigentliche Embryo erst relativ spät in der Entwicklung sichtbar und abgrenzbar sei, wohingegen vorher lediglich ein Zellhaufen existiere, aus dem zwar dann auch der eigentliche Embryo, aber eben auch die Plazenta hervorgehe.[86]
3.4.4 Das Kontinuumsargument
Vertreter des Kontinuumsarguments sind der Ansicht, dass „jeder Versuch, in der Entwicklung eines Embryos hin bis zu einem geborenen und später erwachsenen Menschen einen Einschnitt zu setzen, willkürlich wäre.“[87] Die Argumentation wird von der Anschauung getragen, dass jeder Embryo einen moralischen Status und Würde besitzt, da er sich unter normalen Bedingungen in einem kontinuierlichen Prozess zu einem geborenen – also Würde besitzenden – menschlichen Wesen entwickelt. Die Begründung erfolgt durch Übertragung des moralischen Status vom geborenen auf den ungeborenen Menschen aufgrund der Kontinuität der Entwicklung, die ohne moralrelevante Einschnitte erfolgt, so dass Schutzwürdigkeit von Anfang an, d.h. mit Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, vorliegt.[88]
Doch wie Merkel schreibt, könne man aus dem Umstand, dass etwas ein Kontinuum sei und keine natürlichen Einschnitte aufweise, nicht schließen, dass es für solche von außen gelegten Einschnitte keine guten Gründe gebe. So würden wir z.B. auch in das natürliche Kontinuum der menschlichen Existenz nach der Geburt zahlreiche normativ bedeutsame Einschnitte legen, von der Strafmündigkeit bis hin zum Tod, der ebenfalls ein Einschnitt sei, den wir setzten, denn das Kontinuum der natürlichen Vorgänge (unseres Körpers) gehe bis hin zum endgültigen physischen Zerfall weiter. Willkürlich seien all diese Einschnitte nicht, willkürlich und unvernünftig wäre es im Gegenteil, sie zu unterlassen. Daher sei das Kontinuumsargument nicht dazu geeignet, die Frage zu beantworten, ob einem Embryo ein subjektiv moralisches Lebensgrundrecht zugeschrieben werden könne oder nicht, so Merkel.[89]
Andere Autoren sehen in der Entwicklung des Embryos in Wahrheit einen diskontinuierlichen Prozess, der als entscheidender Einwand gegen das Kontinuumsargument angeführt wird. Folgende moralrelevante Einschnitte lassen sich u.a. ausmachen: die Vereinigung der Vorkerne, weil erst damit ein individuelles Genom feststehe; die genetische Selbststeuerung des Embryos, weil erst damit das neue Genom wirklich aktiv werde; die Herausbildung des Primitivstreifens nach ca. 14 Tagen, weil erst dann die Mehrlingsbildung ausgeschlossen sei; die Herausbildung eines Gehirns, weil erst damit Empfindungsfähigkeit und allmählich einsetzendes Bewusstsein gegeben sei.[90] „Daraus hat die häufig als gradualistisch bezeichnete Position den Schluß gezogen, daß zwar dem Embryo von vollendeter Befruchtung an Schutzwürdigkeit zukommt, daß aber diese Schutzwürdigkeit im Maß der Entwicklung zunimmt und sich […] von einem besonderen Status (special status) zu einem uneingeschränkten Status der Schutzwürdigkeit entwickelt.“[91] Auf die einzelnen Abstufungen der gradualistischen Position wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen.
[...]
[1] Kollek, Regine (2002): Präimplantationsdiagnostik. Embryonenselektion, weibliche Autonomie und Recht, Tübingen/ Basel: Francke, S. 214.
[2] Düwel, Marcus; Steigleder, Klaus (2003): Bioethik. Eine Einführung, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 9.
[3] Vgl. Schöne-Seifert, Bettina (2005): Medizinethik. In: Nida-Rümelin, Julian (Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung. Ein Handbuch; Stuttgart: Kröner, S. 690-803.
[4] Vgl. Düwel, M.; Steigleder, K. (2003): Bioethik – Zu Geschichte, Bedeutung und Aufgaben. In: Düwel, M.; Steigleder, K. (Hg.): Bioethik. Eine Einführung, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 12-37.
[5] Vgl. Siep, Ludwig (1998): Bioethik. In: Pieper, A.; Thurnherr, U. (Hg.): Angewandte Ethik. Eine Einführung; München: Beck, S. 16-36.
[6] Ebd., S. 16.
[7] Vgl. Düwel, M.; Steigleder, K. (2003): Bioethik – Zu Geschichte, Bedeutung und Aufgaben. In: Düwel, M.; Steigleder, K. (Hg.): Bioethik. Eine Einführung, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 12-37.
[8] Vgl. Schöne-Seifert, Bettina (2005): Medizinethik. In: Nida-Rümelin, Julian (Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung. Ein Handbuch; Stuttgart: Kröner, S. 690-803.
[9] Vgl. Düwel, M.; Steigleder, K. (2003): Bioethik – Zu Geschichte, Bedeutung und Aufgaben. In: Düwel, M.; Steigleder, K. (Hg.): Bioethik. Eine Einführung, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 12-37.
[10] Vgl. Schöne-Seifert, Bettina (2005): Medizinethik. In: Nida-Rümelin, Julian (Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung. Ein Handbuch; Stuttgart: Kröner, S. 690-803.
[11] Ebd., S. 691.
[12] Vgl. Düwel, M.; Steigleder, K. (2003): Bioethik – Zu Geschichte, Bedeutung und Aufgaben. In: Düwel, M.; Steigleder, K. (Hg.): Bioethik. Eine Einführung, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 12-37.
[13] Vgl. Eibach, Ulrich (2002): Gentechnik und Embryonenforschung, Leben als Schöpfung aus Menschenhand? Wuppertal: Brockhaus.
[14] Vgl. Pöltner, Günther (2002): Grundkurs Medizin-Ethik; Wien: Facultas, S. 133-159.
[15] Zerres, Klaus (1993): Prädiktive Diagnostik und genetisches Screening in der Bevölkerung. In: Zerres, K.; Rüdel, R. (Hg.): Selbsthilfegruppen und Humangenetiker im Dialog. Erwartungen und Befürchtungen; Stuttgart: Enke, S. 100.
[16] Vgl. Irrgang, Bernhard (2005): Ethik der Gen- und der neuen Biotechnologie. In: Nida-Rümelin, Julian (Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung. Ein Handbuch; Stuttgart: Kröner.
[17] Vgl. Pöltner, Günther (2002): Grundkurs Medizin-Ethik; Wien: Facultas; Eibach, Ulrich (2002): Gentechnik und Embryonenforschung, Leben als Schöpfung aus Menschenhand? Wuppertal: Brockhaus.
[18] Gemäß dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung entscheidet der einzelne selbst darüber, ob und welche persönlichen Daten durch prädiktive Diagnostik ermittelt und (auch an ihn selbst) weitergegeben werden. Dieser Aspekt gewinnt bei der Pränataldiagnostik nicht-therapierbarer Erkrankungen eine zentrale Bedeutung, z.B. für Eltern, die gar nicht wissen wollen, ob bei ihrem ungeborenen Kind eine genetische Auffälligkeit vorliegt, da sie einen Schwangerschaftsabbruch z.B. aus ethischen Gründen ausschließen (Recht auf Wissen und Nichtwissen). Vgl. Irrgang, B. (2005): Ethik der Gen- und der neuen Biotechnologie. In: Nida-Rümelin, J. (Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung; Stuttgart: Kröner, S. 649-687.
[19] Vgl. Pöltner, Günther (2002): Grundkurs Medizin-Ethik; Wien: Facultas, S. 133-159.
[20] Vgl. ebd.
[21] Vgl. ebd.
[22] Vgl. Dörries, Andrea (1999): Ethische Probleme in der Pränataldiagnostik. In: Frewer, A.; Winau, R.; (Hg.): Grundkurs Ethik in der Medizin: in vier Bänden. Band 2. Ethische Fragen zu Beginn des menschlichen Lebens; Erlangen/ Jena: Palm u. Enke, S. 40-53.
[23] Vgl. Pöltner, Günther (2002): Grundkurs Medizin-Ethik; Wien: Facultas, S. 133-159.
[24] Vgl. Kollek, R. (2002): Präimplantationsdiagnostik. Embryonenselektion, weibliche Autonomie und Recht; Tübingen/ Basel: Francke; Gebhard, U.; Hößle, C.; Johannsen, F. (2005): Eingriff in das vorgeburtliche menschliche Leben. Naturwissenschaftliche und ethische Grundlegungen; Neukirchen-Vluyn.
[25] Bundesärztekammer (2000): Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik; URL: http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.7.45.3274.3277 (abgerufen am 8.1.2010).
[26] Vgl. Pöltner, Günther (2002): Grundkurs Medizin-Ethik; Wien: Facultas, S. 151-159.
[27] Vgl. Kap. 6.3.3.
[28] Vgl. Pöltner, Günther (2002): Grundkurs Medizin-Ethik; Wien: Facultas, S. 151-159.
[29] Steigleder, Klaus (1999): Grundlegung der normativen Ethik. Der Ansatz von Alan Gewirth, Freiburg/ München: Alber, S. 183.
[30] Vgl. Schöne-Seifert, Bettina (2005): Medizinethik. In: Nida-Rümelin, Julian (Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung. Ein Handbuch; Stuttgart: Kröner, S. 726f.
[31] Vgl. Leist, Anton (1990): Eine Frage des Lebens. Ethik der Abtreibung und künstlichen Befruchtung. Frankfurt am Main: Campus, S. 77f.
[32] Oduncu, F.S. (2003): Moralischer Status von Embryonen. In: Düwell, M.; Steigleder, K. (Hg.): Bioethik. Eine Einführung; Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 214.
[33] Vgl. ebd., S. 213-219.
[34] Schöne-Seifert, Bettina (2005): Medizinethik. In: Nida-Rümelin, Julian (Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung. Ein Handbuch; Stuttgart: Kröner, S. 726f.
[35] Vgl. Steigleder, Klaus (1999): Grundlegung der normativen Ethik. Der Ansatz von Alan Gewirth, Freiburg/ München: Alber.
[36] Vgl. Gebhard, U.; Hößle, C.; Johannsen, F. (2005): Eingriff in das vorgeburtliche menschliche Leben. Naturwissenschaftliche und ethische Grundlegungen, Neukirchen-Vluyn.
[37] Vgl. Gebhard, U.; Hößle, C.; Johannsen, F. (2005): Eingriff in das vorgeburtliche menschliche Leben. Naturwissenschaftliche und ethische Grundlegungen; Neukirchen-Vluyn, S. 141-174.
[38] Vgl. Körner, Uwe (1999): Wann beginnt das menschliche Leben und warum beginnt schutzwürdiges Menschsein? In: Frewer, A.; Winau, R. (Hg.): Ethische Fragen zu Beginn des menschlichen Lebens; Erlangen/ Jena: Palm und Enke, S. 127-132.
[39] Vgl. Gebhard, U.; Hößle, C.; Johannsen, F. (2005): Eingriff in das vorgeburtliche menschliche Leben. Naturwissenschaftliche und ethische Grundlegungen; Neukirchen-Vluyn, S. 141-174.
[40] Vgl. Breuer, Clemens (1995): Person von Anfang an? Der Mensch aus der Retorte und die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens; Paderborn/ München/ Wien/ Zürich: Schöningh, S. 45-60.
[41] Vgl. Körtner, Ulrich H.J. (2002): Forschung an embryonalen Stammzellen. Zur Diskussion und Gesetzeslage in Österreich; URL: http://www.bka.gv.at/2004/4/8/beitrag_koertner3.pdf (abgerufen am 5.11.2009).
[42] Vgl. Kap. 4.
[43] Breuer, Clemens (1995): Person von Anfang an? Der Mensch aus der Retorte und die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens; Paderborn/ München/ Wien/ Zürich: Schöningh, S. 48.
[44] Körner, Uwe (1999): Wann beginnt das menschliche Leben und warum beginnt schutzwürdiges Menschsein? In: Frewer, A.; Winau, R. (Hg.): Ethische Fragen zu Beginn des menschlichen Lebens; Erlangen/ Jena: Palm und Enke, S. 132.
[45] Vgl. Steigleder, Klaus (1999): Grundlegung der normativen Ethik. Der Ansatz von Alan Gewirth, Freiburg/ München: Alber, S. 190.
[46] Körtner, Ulrich H.J. (2002): Forschung an embryonalen Stammzellen. Zur Diskussion und Gesetzeslage in Österreich; URL: http://www.bka.gv.at/2004/4/8/beitrag_koertner3.pdf (abgerufen am 5.11.2009), S. 3f.
[47] Für die gesetzliche Zulässigkeit der Präimplantationsdiagnostik von grundlegender Bedeutsamkeit ist, dass sich in Großbritannien die Position durchgesetzt hat, die dem Embryo in den ersten 14 Tagen seiner Entwicklung die Personalität abspricht. Zudem ist im gesamten angelsächsischen Raum die Auffassung verbreitet, dass Embryonen im Furchungs- und Blastozystenstadium Präembryonen darstellen, die im Vergleich zu einem sich im weiblichen Körper befindlichen Fetus einen geringeren moralischen Status haben.
[48] Zit. nach Breuer, Clemens (1995): Person von Anfang an? Der Mensch aus der Retorte und die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens; Paderborn/ München/ Wien/ Zürich: Schöningh, S. 57f.
[49] Deutscher Bundestag (1990): §8, Abs.1, Embryonenschutzgesetz (EschG, Stand: Oktober 2001); URL: http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/eschg/gesamt.pdf (abgerufen am 26.8.2009).
[50] Vgl. Leist, Anton (1990): Eine Frage des Lebens. Ethik der Abtreibung und künstlichen Befruchtung; Frankfurt am Main/ New York: Campus, S. 24f.
[51] Vgl. Gebhard, U.; Hößle, C.; Johannsen, F. (2005): Eingriff in das vorgeburtliche menschliche Leben. Naturwissenschaftliche und ethische Grundlegungen; Neukirchen-Vluyn.
[52] Vgl. Körner, Uwe (1999): Wann beginnt das menschliche Leben und warum beginnt schutzwürdiges Menschsein? In: Frewer, A.; Winau, R. (Hg.): Ethische Fragen zu Beginn des menschlichen Lebens; Erlangen/ Jena: Palm und Enke, S. 132-135.
[53] Zit. nach Gebhard, U.; Hößle, C.; Johannsen, F. (2005): Eingriff in das vorgeburtliche menschliche Leben. Naturwissenschaftliche und ethische Grundlegungen; Neukirchen-Vluyn, S. 162.
[54] Sass, H.-M. (1990): Wann beginnt das Leben? In: Die Zeit vom 30.11.1990, S. 104. Zit. nach Breuer, Clemens (1995): Person von Anfang an? Der Mensch aus der Retorte und die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens; Paderborn/ München/ Wien/ Zürich: Schöningh, S. 147f.
[55] Vgl. Körner, Uwe (1999): Wann beginnt das menschliche Leben und warum beginnt schutzwürdiges Menschsein? In: Frewer, A.; Winau, R. (Hg.): Ethische Fragen zu Beginn des menschlichen Lebens; Erlangen/ Jena: Palm und Enke, S. 132-135.
[56] Vgl. Gebhard, U.; Hößle, C.; Johannsen, F. (2005): Eingriff in das vorgeburtliche menschliche Leben. Naturwissenschaftliche und ethische Grundlegungen; Neukirchen-Vluyn.
[57] Vgl. Breuer, Clemens (1995): Person von Anfang an? Der Mensch aus der Retorte und die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens; Paderborn/ München/ Wien/ Zürich: Schöningh, S. 147-151.
[58] Vgl. Körner, Uwe (1999): Wann beginnt das menschliche Leben und warum beginnt schutzwürdiges Menschsein? In: Frewer, A.; Winau, R. (Hg.): Ethische Fragen zu Beginn des menschlichen Lebens; Erlangen/ Jena: Palm und Enke, S. 132-135.
[59] Breuer, Clemens (1995): Person von Anfang an? Der Mensch aus der Retorte und die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens; Paderborn/ München/ Wien/ Zürich: Schöningh, S. 151.
[60] Der Embryo gehört nicht nur der gleichen Spezies wie der geborene Mensch an (Speziesargument), sondern es ist ein und dasselbe Lebewesen (Identitätsargument), das sich über die verschiedenen Phasen hinweg zum geborenen Menschen entwickelt (Kontinuumsargument), wobei die reale u. aktive Potenz des bereits existierenden Lebewesens (Potentialitätsargument) Identität und Kontinuität mit dem später geborenen Menschen begründet. Vgl. Honnefelder, L. (2002): Die Begründung des moralischen Status des menschlichen Embryos aus der Kontinuität der Entwicklung des ungeborenen zum geborenen Menschen. In: Damschen, G.; Schönecker, D. (Hg.): Der moralische Status menschlicher Embryonen. Pro und contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts-, und Potentialitätsargument; Berlin: de Gruyter, S. 61-82.
[61] Vgl. Merkel, Reinhard (2004): Verbot der Präimplantationsdiagnostik: Zur Frage der rechtlichen und ethischen Legitimation. In: Klein, E.; Menke, C. (Hg.): Menschenrechte und Bioethik; Berlin: BWV, S. 111-145.
[62] Vgl. Damschen, G.; Schönecker, D. (2002): Der moralische Status menschlicher Embryonen. Pro und contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts-, und Potentialitätsargument; Berlin: de Gruyter, S. 5f u. 169.
[63] Breuer, Clemens (1995): Person von Anfang an? Der Mensch aus der Retorte und die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens; Paderborn/ München/ Wien/ Zürich: Schöningh, S. 102.
[64] Vgl. Leist, Anton (1990): Eine Frage des Lebens. Ethik der Abtreibung und künstlichen Befruchtung; Frankfurt am Main/ New York: Campus, S. 92f.
[65] Vgl. Düwell, Marcus (2003): Der moralische Status von Embryonen und Feten. In: Düwell, M; Steigleder, K. (Hg.): Bioethik. Eine Einführung; Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 221-229.
[66] Vgl. Breuer, Clemens (1995): Person von Anfang an? Der Mensch aus der Retorte und die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens; Paderborn/ München/ Wien/ Zürich: Schöningh, S. 103.
[67] Vgl. Damschen, G.; Schönecker, D. (2002): Der moralische Status menschlicher Embryonen. Pro und contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts-, und Potentialitätsargument; Berlin: de Gruyter, S. 5f.
[68] Merkel, Reinhard (2002): Forschungsobjekt Embryo. Verfassungsrechtliche und ethische Grundlagen der Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen; München: dtv, S. 167.
[69] Vgl. Leist, Anton (1990): Eine Frage des Lebens. Ethik der Abtreibung und künstlichen Befruchtung; Frankfurt am Main/ New York: Campus, S. 84-91.
[70] Das 1984 in Großbritannien eingerichtete Warnock -Komitee hat sich für ein Potentialitätsverständnis ausgesprochen, nach dem der graduelle Prozess der embryonalen Entwicklung nicht ausreichend begründe, dass aus der Potentialität einzelner Stadien ein gesetzlicher Schutz von Embryonen oder andere Rechte abgeleitet werden können, die mit einer Person vergleichbar wären. Vgl. Breuer, Clemens (1995): Person von Anfang an? Der Mensch aus der Retorte und die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens; Paderborn/ München/ Wien/ Zürich: Schöningh, S. 102-110.
[71] Vgl. Steigleder, Klaus (1999): Grundlegung der normativen Ethik. Der Ansatz von Alan Gewirth; Freiburg/ München: Alber, S. 190.
[72] Vgl. Merkel, Reinhard (2002): Forschungsobjekt Embryo. Verfassungsrechtliche und ethische Grundlagen der Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen; München: dtv, S. 161-178.
[73] Leist, Anton (1990): Eine Frage des Lebens. Ethik der Abtreibung und künstlichen Befruchtung; Frankfurt am Main/ New York: Campus, S. 132.
[74] Vgl. Merkel, Reinhard (2002): Forschungsobjekt Embryo. Verfassungsrechtliche und ethische Grundlagen der Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen, München: dtv, S. 131-156.
[75] In Anlehnung an die Begriffe Rassismus und Sexismus hat Peter Singer im Rahmen seiner Tierethik den Begriff Speziesismus eingeführt, wobei er gegen das Speziesargument einwendet, dass es sich einfach auf die biologische Zugehörigkeit zu einer Klasse von Individuen beruft, ohne die Relevanz dieser Zugehörigkeit selbst zu begründen. Vgl. Leist, Anton (1990): Eine Frage des Lebens. Ethik der Abtreibung und künstlichen Befruchtung. Frankfurt am Main: Campus, S. 61-67.
[76] Vgl. Damschen, G.; Schönecker, D. (2002): Der moralische Status menschlicher Embryonen. Pro und Contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts-, und Potentialitätsargument; Berlin: de Gruyter, S. 2f.
[77] Merkel, Reinhard (2002): Forschungsobjekt Embryo. Verfassungsrechtliche und ethische Grundlagen der Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen, München: dtv, S. 132.
[78] Leist spricht von Irrelevanz der Spezieszugehörigkeit. Vgl. Leist, Anton (1990): Eine Frage des Lebens. Ethik der Abtreibung und künstlichen Befruchtung. Frankfurt am Main: Campus, S. 63.
[79] Vgl. Gebhard, U.; Hößle, C.; Johannsen, F. (2005): Eingriff in das vorgeburtliche menschliche Leben. Naturwissenschaftliche und ethische Grundlegungen; Neukirchen-Vluyn.
[80] Stoecker, Ralf (2002): Mein Embryo und ich. In: Damschen, G.; Schönecker, D. (2002): Der moralische Status menschlicher Embryonen. Pro und Contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts-, und Potentialitätsargument; Berlin: de Gruyter, S. 129.
[81] Vgl. Merkel, Reinhard (2002): Forschungsobjekt Embryo. Verfassungsrechtliche und ethische Grundlagen der Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen; München: dtv, S. 178-183.
[82] Vgl. ebd.
[83] Vgl. Leist, Anton (1990): Eine Frage des Lebens. Ethik der Abtreibung und künstlichen Befruchtung. Frankfurt am Main: Campus, S. 109-118.
[84] Engels, Eve-Marie (1998): Der moralische Status von Embryonen und Feten – Forschung, Diagnose, Schwangerschaftsabbruch. In: Düwell, M; Mieth, D. (Hg.): Ethik in der Humangenetik. Die neueren Entwicklungen der genetischen Frühdiagnostik aus ethischer Perspektive; Tübingen/ Basel: A. Francke, S. 285.
[85] Vgl. Merkel, Reinhard (2002): Forschungsobjekt Embryo. Verfassungsrechtliche und ethische Grundlagen der Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen, München: dtv, S. 178-183.
[86] Vgl. Damschen, G.; Schönecker, D. (2002): Der moralische Status menschlicher Embryonen. Pro und Contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts-, und Potentialitätsargument; Berlin: de Gruyter, S. 4f.
[87] Damschen, G.; Schönecker, D. (2002): Der moralische Status menschlicher Embryonen. Pro und Contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts-, und Potentialitätsargument; Berlin: de Gruyter, S. 3f.
[88] Vgl. ebd.
[89] Vgl. Merkel, Reinhard (2002): Forschungsobjekt Embryo. Verfassungsrechtliche und ethische Grundlagen der Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen; München: dtv, S. 157-160.
[90] Vgl. Damschen, G.; Schönecker, D. (2002): Der moralische Status menschlicher Embryonen. Pro und Contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts-, und Potentialitätsargument; Berlin: de Gruyter, S. 3f.
[91] Honnefelder, L. (2002): Die Begründung des moralischen Status des menschlichen Embryos aus der Kontinuität der Entwicklung des ungeborenen zum geborenen Menschen. In: Damschen, G.; Schönecker, D. (Hg.): Der moralische Status menschlicher Embryonen. Pro und Contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts-, und Potentialitätsargument; Berlin: de Gruyter, S. 73.
Details
- Titel
- Prädiktive Medizin
- Untertitel
- Zu ethischen Problemen der Pränataldiagnostik und der Präimplantationsdiagnostik
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 123
- Katalognummer
- V227966
- ISBN (eBook)
- 9783842802841
- Dateigröße
- 1033 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- diagnostik ethik prädiktive untersuchung präimplantation
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2010, Prädiktive Medizin, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/227966
- Angelegt am
- 26.8.2010

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.