Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos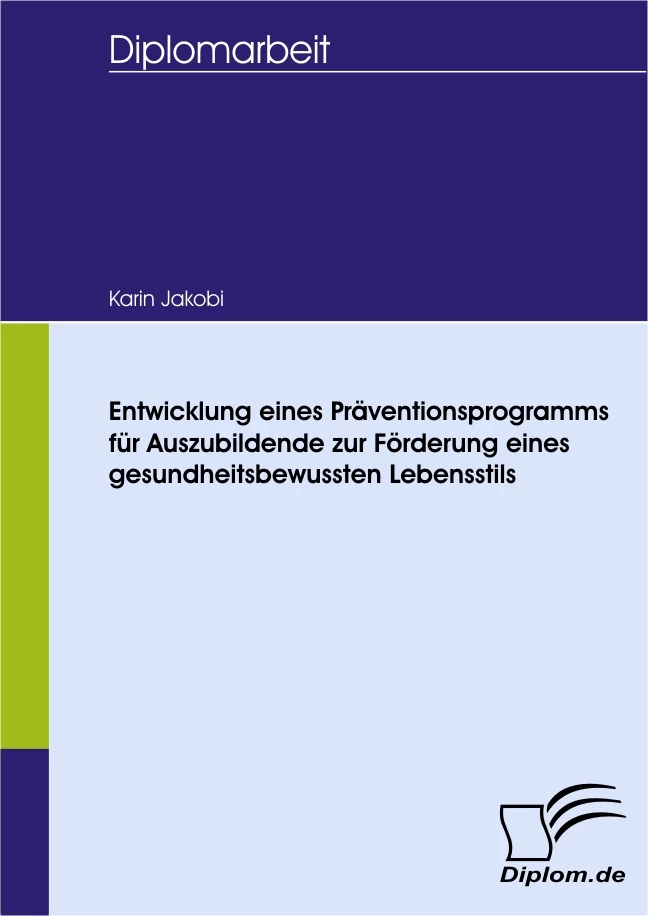
Entwicklung eines Präventionsprogramms für Auszubildende zur Förderung eines gesundheitsbewussten Lebensstils
Diplomarbeit, 2010, 111 Seiten
Autor

Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Note
1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Relevanz des Themas
1.2 Ziele der Diplomarbeit
1.3 Hypothesen
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Jugend und Gesundheit
2.1.1 Begriffsbestimmungen
2.1.1.1 Gesundheitsdefinition auf Basis wissenschaftlicher Modelle
2.1.1.2 Lebensstile und Gesundheitsverhalten
2.1.2 Besonderheiten der Jugendphase
2.1.2.1 Definition und altersspezifische Unterteilung
2.1.2.2 Entwicklungsaufgaben unter dem Aspekt der Gesundheit
2.1.3 Exkurs: Determinanten des Gesundheitsverhaltens
2.1.3.1 Personale Determinanten
2.1.3.2 Soziale Determinanten
2.1.3.3 Ökologische und lebensweltliche Determinanten
2.1.4 Beispiele gesundheitsrelevanter Verhaltungsweisen von Jugendlichen: aktuelle Situation in Deutschland
2.1.4.1 Körperlich-sportliche Aktivität und motorische Leistungsfähigkeit
2.1.4.2 Lebensmittelkonsum und Ernährungsverhalten
2.2 Ausbildung und Gesundheit
2.2.1 Terminologische Abgrenzungen
2.2.1.1 Prävention und Gesundheitsförderung
2.2.1.2 Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
2.2.2 Anforderungen der modernen Arbeitswelt
2.2.2.1 Allgemeine Belastungsstruktur und Folgen
2.2.2.2 Belastungen und Probleme von Auszubildenden
2.2.3 Forschungsstand zum Gesundheitsverhalten und Gesundheitsstatus von Auszubildenden
2.2.4 Evidenzbasierte Interventionen zur Förderung körperlicher
Aktivität und gesunder Ernährung im betrieblichen Setting
3 Entwicklung eines primärpräventiven Sport- und Ernährungs-programms für Auszubildende der Drägerwerk AG & Co.KGaA
3.1 Rahmenbedingungen und Ziele
3.2 Inhalte
3.3 Methoden
3.4 Stundenbilder
4 Möglichkeiten der Evaluation
5 Zusammenfassung und Ausblick
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Anhang
Danksagung
Eidesstattliche Erklärung
1 Einleitung
1.1 Relevanz des Themas
Spätestens seit der am 1. April 2007 in Kraft getretenen Neuverfassung des Sozialgesetzbuches (§§20 und 20a SGB V) und der jüngsten Neuregelung des Einkommensteuergesetzes (§ 3 Nr. 34 EStG) im Jahre 2009 erlebt die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) einen kontinuierlichen Aufschwung. Sie wird immer häufiger als ein fester Bestandteil in das Betriebliche Gesundheitsmanagement integriert, mit dem Ziel den vielfältigen Herausforderungen der veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen zu begegnen. Neben dem epidemiologischen Wandel vom akuten zum chronischen Krankheitsgeschehen und der damit einhergehenden gestiegenen Lebenserwartung, hat der Übergang von der Industrie- zur Dienst- und Informationsgesellschaft auch zu einem Mangel an Facharbeitern sowie Veränderungen in der Belastungsstruktur am Arbeitsplatz geführt. Letzteres ist ganz entscheidend von physischer Unterforderung und Fehlhaltung sowie hohen psychosozialen Belastungen geprägt (Wilke, Biallas & Froböse, 2008).
Durch Vermeidung bzw. Reduzierung von Belastungen und Risikofaktoren (z.B. Bewegungsmangel, Fehlernährung) kann es Arbeitgebern gelingen, einen Großteil der sogenannten chronischen Zivilisationskrankheiten (z.B. koronare Herzkrankheit, psychische Erkrankungen, Diabetes mellitus II) wirksam vorzubeugen und erhebliche Kosten einzusparen (Sockoll, Kramer & Bödeke, 2008; Aldana, 2001). Im Hinblick auf die weltweite Problematik der steigenden Prävalenz von Übergewicht und Adipositas leisten insbesondere Interventionen zur Förderung des Bewegungs- und Ernährungsverhaltens einen bedeutsamen Beitrag zur Gesunderhaltung von Arbeitnehmern (Goldgruber & Ahrens, 2009).
Für das Unternehmen Dräger stellen Auszubildende eine besondere Zielgruppe zur Vermittlung gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen dar, was sich nicht nur aus dem Grund des zunehmenden Wettbewerbs um junge Arbeitskräfte erklären lässt. Infolge der Bewältigung einer dichten Konstellation komplexer Entwicklungsaufgaben befinden sich Auszubildende in einer sensiblen Übergangsphase, in der die Entstehung und Stabilisierung von gesundheitsriskanten oder gesundheitsfördernden Verhaltensweisen erfolgt (Hurrelmann, 2006). Schließlich kann der Einstieg in das Berufsleben für Jugendliche bzw. junge Erwachsene mit zusätzlichen Belastungen und Problemen (z.B. Kontaktschwierigkeiten, weniger Freizeit) verbunden sein.
1.2 Ziele der Diplomarbeit
Die zentrale Zielsetzung der vorliegenden Arbeit liegt in der Entwicklung eines primärpräventiven Sport- und Ernährungsprogramms für Auszubildende des ersten Lehrjahres der Drägerwerk AG & Co. KGaA. Das Konzept soll auf alters- und berufsspezifischen sowie methodischen und gesundheitswissenschaftlichen Aspekten basieren. Als Ausgangslage werden im theoretischen Teil zum einen die Besonderheiten der Jugendphase aufgezeigt. Außerdem erfolgt eine ausführliche Darstellung aktueller wissenschaftlicher Aussagen zur körperlich-sportlichen Aktivität und motorischen Leistungsfähigkeit wie auch zum Lebensmittelkonsum und Ernährungs-verhalten von deutschen Jugendlichen im 21. Jahrhundert. Diese Aussagen werden schwerpunktmäßig hinsichtlich des Altersverlaufs für die Zielgruppe beleuchtet. Zum anderen werden zeitgemäße Belastungen und Probleme am Arbeitsplatz mit speziellem Bezug auf Auszubildende aufgeführt. Der aktuelle Forschungsstand zum Gesundheitsverhalten und Gesundheitszustand von Auszubildenden in Deutschland wird anhand einer Studie ebenfalls berücksichtigt. Darüber hinaus bildet die Zusammenstellung von evidenzbasierten betrieblichen Interventionen zur Förderung körperlicher Aktivität und gesunder Ernährung eine weitere bedeutsame Grundlage für das im praktischen Teil dieser Diplomarbeit entwickelte Präventionskonzept. Dabei orientiert sich die inhaltliche und methodische Gestaltung des Sport- und Ernährungsprogramms an fundierten gesundheitswissenschaftlichen Empfehlungen. Während der theoretischen Auseinandersetzung mit den genannten Themen bleiben wesentliche Einflussfaktoren wie das Geschlecht und der sozioökonomische Status weitestgehend unberücksichtigt. Des Weiteren strebt die Arbeit keine empirische Untersuchung an, d.h. eine Überprüfung der Wirksamkeit des Präventionsprogramms findet nicht statt. Es werden im letzten Kapitel lediglich Möglichkeiten der Evaluation vorgestellt.
1.3 Hypothesen
Aus den oben genannten Zielstellungen lassen sich folgende Hypothesen ableiten:
H1: Das Gesundheitsverhalten im Hinblick auf körperlich-sportliche Aktivität,
motorische Leistungsfähigkeit, Lebensmittelkonsum und Ernährungs-
verhalten ist bei Jugendlichen im 21. Jahrhundert als wenig gesundheits-
förderlich einzuschätzen.
H2: Anhand einer differenzierten Betrachtung der Jugendlichen lassen sich
inhaltliche Schwerpunkte und methodische Vorgehensweisen für ein
Sport- und Ernährungsprogramm ableiten.
H3: Es existieren bisher nur wenige Ansätze, um berufsspezifische Aspekte in
ein Sport- und Bewegungsprogramm zu integrieren.
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Jugend und Gesundheit
Im theoretischen Teil dieser Arbeit werden die Gründe für die Auswahl der Thematik und der Zielgruppe aufgezeigt.
Demzufolge befasst sich dieses Kapitel zunächst mit wesentlichen Aspekten der Gesundheit und des Lebensstils sowie mit entwicklungsrelevanten Merkmalen der Jugendphase. Anschließend erfolgt eine ausführliche Literaturanalyse zu den Einflussfaktoren des Gesundheitsverhaltens auf Basis interdisziplinär ausgerichteter Ansätze. Zudem wird anhand aktueller wissenschaftlicher Untersuchungen die körperlich-sportliche Aktivität und motorische Leistungsfähigkeit ebenso wie der Lebensmittelkonsum und die Essroutinen von Jugendlichen im 21. Jahrhundert beurteilt.
2.1.1 Begriffsbestimmungen
2.1.1.1 Gesundheitsdefinition auf Basis wissenschaftlicher Modelle
Das Gesundheitsverständnis hat sich in den letzten Jahrzehnten wesentlich verändert. Nachdem unter medizinischem Aspekt Gesundheit lange Zeit nur als Abwesenheit von Krankheit verstanden wurde, hat die WHO in ihrer Gründungs-charta von 1946 den Begriff erstmalig positiv bestimmt (Gerber, 2008). Sie definiert Gesundheit als einen „ … Zustand des völligen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen“ (WHO 1946 in: Hurrelmann, 2006, S. 117).
Zwar hat diese Formulierung entscheidend dazu beigetragen, Gesundheit seither interdisziplinär und mehrdimensional zu verstehen, dennoch hat sie bis heute für nachhaltige Diskussionen um eine konsensfähige wissenschaftliche Definition gesorgt (Hurrelmann, 2006).
Demgemäß setzt sich Hurrelmann (2006) in seinem Beitrag zur Entwicklung von Leitvorstellungen für ein integratives Konzept von Gesundheit und Krankheit mit vier Kritikpunkten auseinander:
- Gesundheit bezieht sich lediglich auf subjektive Bewertungen, wobei die Fremdwahrnehmung als bedeutsamer objektiver Parameter vollkommen vernachlässigt wird
- Die utopische Charakteristik des „völligen“ körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens erweist sich in der Realität als schwer vorstellbar sowie kaum realisierbar
- Aufgrund einer ungenauen Definition von „sozialer Gesundheit“ bleibt der neue multidimensionale Ansatz noch unpräzise
- Gesundheit und Krankheit werden konträr beleuchtet ohne das Verhältnis zueinander in Betracht zu ziehen.
Hurrelmann (2006) versucht die Kritikpunkte der WHO-Definition zu berücksichtigen, in dem er konzeptionell weniger einen gesundheitspolitisch orientierten Ansatz anstrebt als vielmehr Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen wissenschaft-lichen Disziplinen[1] und Theorien aufzeigt. Seine Leitvorstellungen basieren auf zwei verschiedenen Modellen, dem Salutogenese-Modell und dem Sozialisationsmodell, auf die nun exemplarisch eingegangen werden soll.
Salutogenese-Modell
Das Modell der Salutogenese vom amerikanisch-israelischen Soziologen Aaron Antonovsky (1979) orientiert sich am ganzheitlichen Verständnis von Gesundheit (Gerber, 2008). Laut Hurrelmann (2006) lässt sich der Begriff Salutogenese (griechisch salus „Unverletztheit, Heil, Glück“ und genese „Entstehung“) sinngemäß als „Gesundheitsdynamik“ übersetzen und bildet das Gegenstück zur Pathogenese („Krankheitsdynamik“).
Auf der Basis der zentralen Fragestellung „Warum bleiben Menschen trotz vieler gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund?“ bezieht sich Antonovsky`s Konzept zum einen auf den erfolgreichen Umgang mit krankheitsverursachenden Faktoren (Risikofaktoren, insbesondere Stressoren) sowie den Erhalt und die Verbesserung von Gesundheitsressourcen (Widerstandsressourcen) im physischen, psychischen und sozialen Bereich. Die wichtigste gesundheitsförderliche Ressource stellt seines Erachtens das Kohärenzgefühl (sense of coherence, SOC) dar. Als maßgebliche Einflussgröße auf den Gesundheitszustand, charakterisiert der Kohärenzsinn die grundlegende Lebenseinstellung eines Menschen, Widerstandsressourcen abrufen und aktivieren zu können. Der SOC setzt hierfür ein starkes Vertrauen in das Verständnis , Bewältigbarkeit und Sinnhaftigkeit von Anforderungen voraus. Im Einzelnen bedeutet das, Belastungen, welche Investitionen und Engagement fordern, nachvollziehbar interpretieren, mit Hilfe eigener Ressourcen bewältigen und als Herausforderungen für den Erhalt der eigenen Gesundheit ansehen zu können. Zum anderen wird im Modell der Salutogenese auf eine strikte Trennung von Gesundheit und Krankheit verzichtet. Stattdessen entsteht ein Gesundheits- und Krankheits-kontinuum (Health Ease-/ Disease Continuum), auf welchem sich der Mensch in Abhängigkeit seiner Widerstandsressourcen bewegt (Hurrelmann, 2006; Becker, 2006).
Sozialisationsmodell
Auch im Sozialisationsmodell befindet sich der Mensch stets in einem dynamischen Prozess zwischen Gesundheit und Krankheit. Allerdings gibt es in diesem Modell einen wesentlichen Unterschied zum salutogenetischen Verständnis. Das Sozialisationsmodell, entwickelt von Hurrelmann (1989), basiert überwiegend auf sozialstrukturelle Bedingungen unter dem Aspekt lebensspezifischer Entwicklungs-aufgaben. Das Konzept der Entwicklungsaufgaben beschreibt verschiedene „…charakteristische Konstellationen von Anforderungen und Ressourcen aus den vier Systemen Körper, Psyche, soziale und physische Umwelt“ (Hurrelmann, 2006, S. 130) in bestimmten Lebensphasen (Kindheit, Jugendalter, Erwachsenenalter, hohes Alter). Eine Schlüsselfunktion nimmt in diesem Modell das Konstrukt der „produktiven Realitätsverarbeitung“ ein. Es charakterisiert die Bewältigung von physischen und psychischen Belastungen („innere Realität“) sowie von Anforderungen der sozialen und physischen Umwelt („äußere Realität“). An dieser Stelle werden die sozialen und personalen Ressourcen besonders hervorgehoben, da sie letztlich für die Lösung der Entwicklungsaufgaben auschlaggebend sind. Während sich soziale Ressourcen unter anderem aus dem sozioökonomischen Status (z.B. Bildungsgrad, Einkommen) ergeben, beruhen personale Ressourcen auf kognitiven und einstellungsrelevanten Faktoren (z.B. positiven Selbstbild, Leistungsmotivation). Schließlich bildet die „produktive Realitätsverarbeitung“ eine bestimmende Einflussgröße für die Gesundheits- oder Krankheitsdynamik (Hurrelmann, 2006).
Für die Leitvorstellungen Hurrelmanns (2006) ergeben sich unter Berücksichtigung der zwei vorgestellten Modelle verschiedene Grundsätze[2], mit deren Hilfe konsens-fähige und interdisziplinär anwendbare Definitionen von Gesundheit und Krankheit weiterhin in Forschungsarbeiten verfasst werden können. Eine umfassende Definition des Gesundheitsbegriffs wird beispielweise folgendermaßen formuliert: „Gesundheit ist das Stadium des Gleichgewichts von Risikofaktoren und Schutz-faktoren, dass eintritt, wenn einem Menschen eine Bewältigung sowohl der inneren (physischen und psychischen) als auch äußeren (sozialen und materiellen) Anforderungen gelingt. Gesundheit ist ein Stadium, das einem Menschen Wohl-befinden und Lebensfreude vermittelt“ (Hurrelmann, 2006, S. 146).
Die Definition der WHO, das Salutogenese-Modell sowie das moderne integrative Konzept von Gesundheit und Krankheit (Hurrelmann 2006) verdeutlichen, dass Gesundheit als ein vielfältiger und komplexer Begriff anzusehen ist, für den verschiedene Definitionen und unterschiedliche subjektive Vorstellungen existieren, die von personalen sowie individuellen sozialen, ökonomischen und ökologischen Faktoren beeinflusst werden.
2.1.1.2 Lebensstile und Gesundheitsverhalten
Auch der Begriff des Lebensstils – ein entscheidendes Kriterium für die Gesundheit und das Wohlbefinden – ist sehr komplex und vielseitig zu betrachten. „ Ein Lebensstil ist [...] der regelmäßig wiederkehrende Gesamtzusammenhang der Verhaltensweisen, Interaktionen, Meinungen, Wissensbestände und bewertenden Einstellungen eines Menschen“ (Hradil, 2005, S. 46).
Laut der Definition von Hradil (2005) steht der individuelle Lebensstil im engen Zusammenhang mit persönlichen Einstellungen sowie menschlichen Verhaltens-weisen. Alle diese Einflussfaktoren können sich entweder fördernd (Gesundheits-ressourcen) oder schädigend (Risikofaktoren) auf den individuellen Gesundheitszu-stand auswirken. Außerdem beinhaltet der persönliche Lebensstil kulturelle, ökonomische und soziale Aspekte, die in wechselseitiger Beziehung zu Einstellungen und Verhalten stehen (s. Abb. 1) (Neumann, Bellinger & Frasch, 2008; Hackauf, 2002).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 : Komplexe Wirkungsmechanismen der Lebensstilstruktur
Einen gesundheitsförderlichen Lebensstil ausbilden zu können, erweist sich infolge dieser komplexen Wirkungsmechanismen als äußerst kompliziert. Neben den Lebenseinstellungen und den Lebensbedingungen, spielen insbesondere die verhaltensorientierten Einflussfaktoren eine übergeordnete Rolle (Neumann et al., 2008). Eine vereinfachte Übersicht der wichtigsten Parameter eines gesundheits-bewussten Lebensstils verschafft Abbildung 2.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2 : Faktoren eines gesundheitsbewussten Lebensstils
Die Effektivität gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen ist längst nachgewiesen. Im Kontext von körperlicher Aktivität und gesunder Ernährung existieren viele internationale und nationale Studien, welche die positiven Auswirkungen auf die physische, psychische und seelische Gesundheit belegen (Neumann et al., 2008). Insbesondere im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen und der Gesamtsterblichkeit lassen sich sowohl primär- als auch sekundärpräventiv deutliche Erfolge erzielen (Wirth, 2004; Nething, Stroth, Wabitsch, Galm, Rapp, Brandstetter et al., 2006; Löllgen, Böckenhoff & Knapp, 2009; Oguma, Sesso, Paffenberg & Lee, 2002; Knoops, de Groot, Kromhout. Perrin, Moreiras-Varela, Menotti & van Staveren, 2004).
Auch eine wechselseitige, positive Beeinflussung zwischen verschiedenen mensch-lichen Verhaltensweisen ist inzwischen bekannt. Seelig (2007) hat in einem Review, in welchem 46 Studien über einen Zeitraum von 15 Jahren untersucht wurden, die Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität, Ernährung, Alkohol- und Tabak-konsum zusammengefasst. Dabei konnte unter anderem festgestellt werden, dass sich körperlich aktive Personen eher gesund ernähren und weniger rauchen als körperlich Inaktive.
Andererseits sind bereits erworbene menschliche Verhaltensweisen nur schwer veränderbar, zumal sie verschiedene Lebensbereiche umfassen. Eine Modifizierung solcher „Gewohnheiten“ setzt entweder eine Veränderung des Umfelds oder ein prägendes Ereignis voraus, z.B. eine Heirat, neue Arbeitsstelle oder der Beginn einer chronischen Erkrankung (Neumann et al., 2008). Aus diesem Grund ist es bedeutsam, einen gesundheitlich orientierten Lebensstil frühzeitig, wenn möglich im Kindes- und Jugendalter, zu entwickeln (Boreham, Twisk, Neville, Savage, Murray & Gallagher, 2002; Nething et al., 2006). Speziell im Jugendalter werden „individuelle Verhaltensweisen etabliert und habitualisiert, die dann aufgrund der stabilen Verankerung in der Persönlichkeit im Erwachsenalter fortgeführt werden“ (Raithel, 2005, S. 15).
2.1.2 Besonderheiten der Jugendphase
2.1.2.1 Definition und altersspezifische Unterteilung
Die demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen der Moderne sind durch eine zahlenmäßige Veränderung der Altersstruktur sowie eine Umgestaltung von Lebensphasen geprägt (Hurrelmann, 2007). In der heutigen technologisch fortge-schrittenen Wohlstandsgesellschaft ist vor allem auch die Jugendphase betroffen. Neben einem eindeutigen Rückgang der jugendlichen Bevölkerung infolge rückläufiger Geburtenraten, hat sich die Jugendphase kontinuierlich verlängert und wird inzwischen nicht mehr als „kurze Übergangsphase“ von Kindheit zum Erwachsenenalter, sondern als umfassend „eigenständige Phase“ charakterisiert (Hurrelmann & Albert, 2006). Hurrelmann (2007) begründet diese Ausdehnung der Jugendphase mit der Vorverlagerung der sexuellen Reife und der Verzögerung der Schul- und Ausbildungszeiten.
Während der Beginn der Jugend weitestgehend mit dem Eintritt der Geschlechtsreife (ca. 12. Lebensjahr) definiert ist, kann das Ende dieser Phase gegenwärtig nicht mehr eindeutig festgelegt werden (ca. 21. bis 27. Lebensjahr). Wurden Jugendliche früher noch nach Beginn einer Arbeitsstelle oder nach Gründung einer eigenen Familie als Erwachsene angesehen, so sind es mittlerweile mehrere zeitlich aufeinanderfolgende Komponenten, die das Ende der Jugendphase determinieren. In Abhängigkeit sozialer, ökonomischer und kultureller Faktoren sind das unter anderem Kriterien wie rechtliche Mündigkeit, familiäre Ablösung, ökonomische Unabhängigkeit und Gründung eines eigenen Haushalts (Hurrelmann, 2007).
Trotz aller Schwierigkeiten einer altersgemäßen Unterteilung, ist eine Differenzierung nach Altersgruppen innerhalb der Jugendphase für die soziologische und entwicklungspsychologische Jugendforschung sinnvoll (Ferchoff, 2007). Hurrelmann (2007) zufolge wird daher zwischen drei Jugendphasen bzw. Adoleszenz unter-schieden:
1. Frühe Jugendphase (12 bis 17 Jahre)
2. Mittlere Jugendphase (18 bis 21 Jahre)
3. Späte Jugendphase (22 bis 27 Jahre)
Der Autor beschreibt in seiner Einteilung die jüngere Generation der 12- bis 17-Jährigen als eigentlich pubertäre Phase, die 18- bis 21-Jährigen als nachpubertäre Phase und die 22- bis 27-Jährigen als Übergangsphase zum Erwachsenwerden. Für die späte Jugendphase haben sich zudem die Begriffe Postadoleszenz oder junge Erwachsene durchgesetzt (Ferchoff, 2007).
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden alle drei Jugendphasen berücksichtigt, da sich diese auf die Zielgruppe der Auszubildenden zwischen 16 und 25 Jahren bezieht.
2.1.2.2 Entwicklungsaufgaben unter dem Aspekt der Gesundheit
Eine wirtschaftliche und soziale Autonomie kann von Jugendlichen nur durch eine angemessene psychische Bewältigung der Entwicklungsaufgaben erlangt werden (Hurrelmann, 2007). Wie bereits angedeutet, werden Entwicklungsaufgaben unterschiedlichen Lebensphasen zugeordnet und dienen der individuellen Auseinandersetzung mit physischen, psychischen, sozialen und ökologischen Anforderungen.
Auf intensiver Suche nach der eigenen Identität werden Heranwachsende mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Zunächst erfahren Jugendliche einen auffälligen geschlechtsspezifischen Gestaltwandel. Sie müssen lernen ihren Körper zu akzeptieren, bewusst wahrzunehmen und effektiv einzusetzen (Körperkonzept). Körperliche Veränderungen gehen mit psychosozialen Entwicklungsprozessen einher. So wird von Jugendlichen erwartet, grundlegende soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen beider Geschlechter (sogenannten Peer-groups) und zu einem Partner aufzubauen (Hurrelmann, 2007). Anderseits rückt die berufliche Ausbildung immer näher, welche nur durch den Erwerb entsprechender Fähigkeiten, Kenntnisse und Qualifikationen erfolgreich abgeschlossen werden kann (Ferchoff, 2007). Im Freizeit-, Medien- und Konsumbereich müssen wiederum Kompetenzen zum selbstständigen Handeln angeeignet werden, um einen individuellen Lebensstil entwickeln zu können (Hurrelmann, 2007). Die allmähliche Ablösung von den Eltern und anderen Erwachsenen stellt eine weitere wichtige Aufgabe dar. Schließlich sollte in der Jugendphase der Grundstein für ethisch-moralische sowie religiöse und politische Werte- und Normvorstellungen gelegt werden (Ferchoff, 2007).
Die Auseinandersetzung mit der Vielzahl von Anforderungen erfordert eine Herausbildung charakteristischer Handlungskompetenzen (Ressourcen), welche für die Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung enorm wichtig sind (Hurrelmann, 2007). Allerdings kann die Herausbildung und Stabilisierung einer individuellen Identität – auch als Selbstbild bekannt – für Heranwachsende im 21. Jahrhundert problematisch sein (Hurrelmann, 2007; Hurrelmann & Albert, 2006). Obwohl sie altersgemäß in der Lage sind, charakteristische Handlungskompetenzen zu entwickeln, wird der Grad ihrer Autonomie zur Handlungssteuerung durch sozioökonomische Gegebenheiten (z.B. verlängerte Ausbildungszeiten, erhöhte Arbeitslosigkeit) eingeschränkt. Die jugendliche Persönlichkeitsentwicklung befindet sich daher in einer Diskrepanz zwischen subjektiven Bedürfnissen, Motiven und Interessen sowie gesellschaftlichen Erwartungshaltungen. Als Folge des Individualisierungsprozess kommt zudem die „ … Vielfalt der Wahl- und Entfaltungsmöglichkeiten“ (Ferchhoff, 2007, S. 106) für die Lebensgestaltung des Einzelnen erschwerend hinzu. Auf dem „langen“ Weg zur Persönlichkeitsentwicklung testen Jugendliche deshalb nicht selten ihre Grenzen aus, was die Entstehung riskanter Verhaltensweisen nicht ausschließen lässt (Jerusalem, 2005).
Für Raithel (2005) und Ferchhoff (2007) stellt das Risikoverhalten dieser Altersgruppe eine Maßnahme zur Bewältigung der spezifischen Entwicklungsaufgaben dar. Jugendliche selbst sehen in ihrem riskanten Verhalten jedoch keine potentielle gesundheitliche Gefahr. Sie halten sich für unverwundbar, da gesundheitliche Folgen in dieser Lebensphase nicht ersichtlich oder spürbar sind. Sie leben den Moment und denken dabei selten an die Zukunft einschließlich langfristiger Gesundheitsbe-einträchtigungen.
Bei der Bewältigung diverser Probleme und Belastungen in der sogenannten „Sturm- und Drang- Zeit“, kann von Jugendlichen hingegen ebenso ein gesundheits-bewusstes Verhalten entwickelt werden. Dafür sind Kompetenzen wie Selbstmanagement, Problembewältigung und anpassungsfähiges Verhalten unabdingbar (Hurrelmann & Albert, 2006). Ein sportlich orientierter Lebensstil ist an dieser Stelle von Vorteil. Aus sportwissenschaftlicher Perspektive kann Sport im Jugendalter günstige Voraussetzungen für die Lösung von Entwicklungsaufgaben schaffen. Zum einen begünstigt regelmäßiges Sporttreiben die Entwicklung des Körperkonzepts und zum anderen die soziale Kompetenz, da sportliche Aktivität zum größten Teil in Peer-groups stattfindet (Gabler, Nitsch & Singer, 2001; Schmidt, Hartmann-Tews & Brettschneider, 2003).
2.1.3 Exkurs: Determinanten des Gesundheitsverhaltens
In den vorangegangen Kapiteln wurde auf die komplexen Zusammenhänge zwischen Einflussfaktoren sowie Gesundheitsverhalten und Gesundheitsstatus mehrfach hin-gewiesen. Im Folgenden wird nun auf wesentliche personale und soziale Faktoren des Gesundheitsverhaltens eingegangen.
Zur Erklärung der Faktoren und Wirkungsmechanismen des Gesundheitsverhaltens bedient sich die Forschung unterschiedlicher Theorien und Modelle (Scholz & Schwarzer, 2005). Auf der Grundlage eines interdisziplinär ausgerichteten Ansatzes (Hurrelmann, 2006) lassen sich sowohl personale und soziale als auch ökologische und lebensweltliche Ressourcen ableiten, welche für die Entwicklung von Inter-ventionen zur Verhaltensänderung bedeutsam sind (Scholz, Schüz & Ziegelmann, 2007). Aufgrund der Vielzahl und Komplexität von Gesundheitsmodellen wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit auf eine ausführliche Darstellung einzelner Theorien verzichtet. Vielmehr werden die wesentlichen Determinanten[3] des Gesundheits-verhaltens dargestellt.
2.1.3.1 Personale Determinanten
In Anlehnung an Antonovsky`s Modell der Salutogenese (s. Kapitel 2.1.1.1) entstanden in den 80er Jahren eine ganze Reihe weiterer gesundheitspsychologischer Ansätze (Wunderlich, 2008). Die Gesundheitspsychologie legt im Unterschied zu reinen biologischen Erklärungsansätzen besonderen Wert auf psychische und soziale Einflussfaktoren sowie deren Beziehung zueinander (Schwarzer, 2004). Scholz und Schwarzer (2005) zufolge wird grundsätzlich zwischen zwei Arten von Erklärungstheorien unterschieden: kontinuierliche Prädikationsmodelle und dynamische Stadienmodelle.
Die kontinuierlichen Modelle, auch als motivationale Modelle bekannt, gehen von der Annahme aus, dass Menschen in der Motivationsphase zur Verhaltensabsicht (Ziel, Intention) von bestimmten kognitiven und affektiven Faktoren geleitet werden, die wiederum von sozialen Bedingungen (Geschlecht, Alter, sozioökonomischer Status) und dem Wissen über Gesundheitspotentiale und -risiken abhängig sind. Der jeweilige Ausprägungsgrad dieser Kognitionen und Emotionen sagt vorher, an welchem Punkt sich Individuen auf dem Kontinuum einer Verhaltenswahrschein-lichkeit befinden. Demnach handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess der Verhaltensänderung, wobei ein erhöhtes Zielverhalten angestrebt wird (Scholz & Schwarzer, 2005; Lippke & Renneberg, 2006). Zu den Vertretern der motivationalen Modelle gehören nach Scholz und Schwarzer (2005) sowohl die Furchtappelltheorien wie das Modell gesundheitlicher Überzeugungen (Health Belief Model; HBM nach Becker, 1974) und die Theorie der Schutzmotivation (Protection Motivation Theory; PMT nach Rogers, 1983) als auch Modelle, bei denen die Kompetenzwahrnehmung im Mittelpunkt steht. Dazu zählen unter anderem die Sozial-kognitive Theorie (Social-Cognitive Theory; SCT nach Bandura, 1997) und die Theorie des geplanten Verhaltens (Theory of Planned Behavior; TPB nach Ajzen, 1985).[4] Eine umfangreiche Literaturanalyse dieser Theorien hat zum einen ergeben, dass sie alle gemeinsam gesundheitsfördernde Faktoren zur Belastungsbewältigung identifizieren (Wunder-lich, 2008). Die wichtigsten personalen Gesundheitsressourcen bzw. Schutzfaktoren lassen sich nach Hornung (1997) und Schwarzer (2004) wie folgt zusammenfassen:
- „Risikowahrnehmung“ ergibt sich aus der subjektiven Wahrnehmung des Schweregrades eines Gesundheitsrisikos (z.B. Gefährlichkeit eines Herz-infarktes) und der individuellen Vulnerabilität (z.B. persönliche Gefährdung einen Herzinfarkt zu bekommen).
- „Selbstwirksamkeitserwartun g“ (SWE; Kompetenzerwartung) ist das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, ein bestimmtes gesundheitliches Verhalten trotz Barrieren ausführen zu können (z.B. ich bin überzeugt mindestens zweimal pro Woche joggen zu gehen, auch wenn ich einen knappen Zeitplan habe).
- „Ergebniserwartung“ (Handlungswirksamkeit) bezieht sich auf die wahrge-nommene Wirksamkeit eines Verhaltens oder einer Maßnahme (z.B. wenn ich aufhöre zu Rauchen, dann lebe ich länger).
- „Internale Kontrollüberzeugung“ wird definiert als die individuelle Überzeugung, den Gesundheitsstatus durch das eigene Verhalten selbst zu beeinflussen. (z.B. ich muss regelmäßig zur Krebsvorsorge gehen, um nicht an Krebs zu erkranken).
Zum anderen weisen die genannten Modelle zahlreiche inhaltliche Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten auf. So ist z.B. das Konstrukt der Selbstwirksamkeits-erwartung (SWE) in allen Modellen mit Ausnahme des Modells gesundheitlicher Überzeugungen enthalten. In der Theorie des geplanten Verhaltens wird anstelle der SWE ein ähnlicher Einflussfaktor, die Verhaltenskontrolle, verwendet (Lippke & Renneberg, 2006).
Im Gegensatz zu kontinuierlichen Modellen sind dynamische Modelle in qualitativ unterschiedliche Entwicklungsstadien gegliedert, welche während einer gesundheit-lichen Verhaltensänderung durchlaufen werden (Schwarzer, 2004). Entscheidend für die Einordnung in Stadien sind die psychologischen Voraussetzungen des Einzelnen, d.h. Personen, die noch nicht bereit sind ihr Verhalten zu ändern, gehören einem anderen Stadium an, als jene, die bereits eine Verhaltensabsicht haben oder gar jene, die ihr Verhalten gerade umsetzen oder aufrecht erhalten wollen (Fuchs, 2006). Laut Scholz & Schwarzer (2005) zählen zu den bekanntesten Stadien-modellen das Transtheoretische Modell (TTM nach Prochaska & DiClemente, 1983), das Sozial-kognitive Prozessmodell gesundheitlichen Handels (Health Action Process Approach; HAPA nach Schwarzer 1992) sowie das Berliner Sportstadien-Modell (BSM nach Fuchs, 2003). Sie unterscheiden sich von kontinuierlichen Modellen, indem sie neben der präintentionalen Motivationsphase, die postintentionale Volitionsphase verstärkt fokussieren. Die volitionale Phase beinhaltet die Handlungsinitiierung und Handlungsaufrechterhaltung, welche ein hohes Maß an Selbstregulation und Selbstkontrolle des eigenen Handels erfordern. Die Relevanz dieser nachfolgenden Phase wird dadurch ersichtlich, dass in mehreren Studien, in denen psychologischen Determinanten verwendet wurden, zwar eine nachweislich erhöhte Verhaltensabsicht nachgewiesen werden konnte, die Varianz des Verhaltens dennoch auffällig gering ausfiel (Sniehotta, Winter, Dombrowski & Johnsten, 2007). Wenn sich Personen demnach zum Ziel setzten, zwei bis drei Mal die Woche sportlich aktiv zu sein, spricht das allein noch lange nicht für eine Aufnahme und regelmäßigen Durchführung dieser Verhaltensabsicht. Was hier fehlt, ist die Phase nach der Intentionsbildung, die volitionale Phase, welche ebenso wie die motivationale Phase an personale und soziale Determinanten gebunden ist. Um die sogenannte Intentions-Verhaltens-Lücke zu schließen, wurden Handlungs- und Bewältigungspläne eingeführt. Handlungspläne beinhalten eine „Wenn-dann-Relation“ und spezifizieren wann, wo und wie eine Person ihr Verhalten ausübt. Sie können hilfreich sein, handlungsrelevante Reize („wenn ich am Montag von der Arbeit komme, ...“) zu identifizieren, die dazu beitragen, ein Verhalten („… dann gehe ich 30 Minuten joggen“.) schnell und problemlos auszuführen. Dadurch kommt es zu einer Übertragung der Verhaltenskontrolle an die Umwelt sowie zu einer an-nähernden Habitualisierung der Verhaltensauslösung. Bewältigungspläne dienen wiederum dem Ausgleich von typischen Situationen, in denen Hindernisse oder Barrieren (z.B. Zeitmangel, Müdigkeit, schlechtes Wetter) antizipiert werden. Sniehotta, Scholz und Schwarzer (2006) konnten eine erhöhte Effektivität zur langfristigen Verhaltensänderung durch eine Kombination von Handlungs- und Bewältigungsplänen belegen. Einen noch stärkeren dauerhaften Effekt der Verhaltensumstellung – von bis zu zwei Jahren nach der Verhaltensinitiierung – wurde mit Hilfe einer Selbstbeobachtungstechnik (Wochenhefte) in einer Intervention von Sniehotta, Scholz, Schwarzer, Behr, Fuhrmann, Kiwus et al. (2005) festgestellt (Sniehotta, Winter, Dombrowski, Johnsten, 2007).
Unter den Persönlichkeitsmerkmalen wird dem Kohärenzsinn (s. Kapitel 2.1.1.1) und der Selbstwirksamkeitserwartung eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Als Schlüsselkomponente der Selbstregulation menschlicher Verhaltensweisen bildet die SWE die einzige Variable, welche in beiden Phasen – sowohl in der motivationalen als auch in der volitionalen Phase – positiven Einfluss auf den Verhaltensprozess ausübt (Schwarzer, 2005). Der Einfluss kann entweder auf direktem oder indirektem Weg über andere Variablen der sozial-kognitiven Theorie von Bandura (1997) erfolgen (Lippke & Renneberg, 2006). Es existiert eine große Anzahl von Studien, die nachweisen können, dass das Konstrukt der SWE ein bedeutender Prädiktor für gesundheitsrelevante Verhaltensweisen darstellt (Schwarzer, 2004). Pietrowsky (2006) konnten in diesem Kontext beispielsweise im Bereich des Ernährungs-verhaltens positive Zusammenhänge zwischen der Kompetenzerwartung und einer Gewichtsreduktion belegt werden. Gleichzeitig kann ein hohes Maß an SWE der Ansicht Schwarzer (2004) zufolge in allen Altersstufen zur Förderung körperlicher Aktivität oder Sportteilnahme beitragen.
2.1.3.2 Soziale Determinanten
Die Gründe für das Initiieren und Aufrechterhalten eines gesundheitsfördernden Verhaltens liegen nicht nur in der Person selbst, sondern auch in Voraussetzungen der sozialen und physischen Umwelt (s. Sozialisationsmodell Kapitel 2.1.1.1). Unter dem Aspekt der Gesundheitssoziologie ist das Gesundheitsverhalten daher auch von sozialen Faktoren abhängig. Im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensbedingungen befasst sie sich mit dem Einfluss von sozialen Lebensbedingungen, sozialen Normen und Erwartungen (Troschke, 2006). „Die politischen und wirtschaftlichen Beding-ungen eines Landes, kulturelle Spannungen, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe, die finanziellen Spielräume, die Wohnbedingungen, der Bildungsgrad und die privaten Lebensformen – um nur einige Beispiele zu nennen – wirken als einschränkende oder ermöglichende Bedingungen für die Entfaltung von gesundheitlichen Verhaltensweisen.“( Hurrelmann, 2006, S. 25) In diesem Zusammenhang sind soziale Unterstützung und sozioökonomischer Status entscheidende soziale Einflussfaktoren des Gesundheitsverhaltens. Der Begriff soziale Unterstützung umfasst sämtliche Unterstützungsleistungen des sozialen Umfelds (Familie, Freunde, Arbeit, Institutionen), welche für die Stärkung psychosozialer Ressourcen wie z.B. Vertrauen, Akzeptanz, finanzielle Hilfen und instrumentelles Wissen relevant sind (Hornung, 1997). Hingegen entscheiden finanzielle Ressourcen, Bildungsgrad und Grad der gesellschaftlichen Anerkennung über den sozioökonomischer Status. In aktuellen Arbeiten wird der Zusammenhang zwischen sozialer Schicht und gesundheitlichem Verhalten sowie Gesundheitsstatus immer wieder aufgegriffen. Dabei wird deutlich, dass sozial Benachteiligte in allen Lebensphasen eher gesundheitsschädigende Verhaltensweisen ausführen und demgemäß ein erhöhtes Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko aufweisen als privilegierte Menschen (Hurrelmann, 2006).
2.1.3.3 Ökologische und lebensweltliche Determinanten
Neben personalen Faktoren sowie sozialen, kulturellen und ökonomischen Rahmenbedingungen beeinflussen zudem ökologische und lebensweltliche Bedingungen das Gesundheitsverhalten. So haben gesundheitsorientierte Gesetze ebenso wie gesundheitspolitische Maßnahmen der Erziehung, Aufklärung und Beratung zum Ziel, gesundheitsbewusstes Verhalten durch Einstellungsänderung und Verhaltens-änderung zu fördern (Troschke, 2007). Im Laufe der letzten Jahre wurden in der Gesundheitspolitik mehrere unterschiedliche Strategien zur Verhaltensänderung entwickelt. Diese Strategien reichen von fortlaufenden Berichten über Gesundheits-risiken in den Medien oder gesundheitsbezogene Kampagnen (z.B. „Gib Aids keine Chance“ oder „Bewegung und Gesundheit“) über eine Erhöhung der Tabaksteuer bis hin zum aktuellen Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden und Restaurants. Aus ökologischer Perspektive spielen laut Hurrelmann (2006) außerdem Luft-, Wasser- und Bodenqualität, Verkehrssicherheit und Hygienebedingungen eine wesentliche Rolle für das Gesundheitsverhalten. Des Weiteren kommen Infrastruktur und Angebote im Waren- und Dienstleistungssektor hinzu (Troschke, 2007). Insofern liefert ein ausreichendes Angebot an Sporthallen und Sportplätzen, Vereinen, Park-anlagen und Fahrradwegen vielfältige Möglichkeiten das Bewegungsverhalten positiv zu beeinflussen (Mensink, 2003). Eine Förderung des Gesundheitsverhaltens sollte dabei stets in verschiedenen Settings wie z.B. Arbeitsplatz, Schule und Wohnort stattfinden, da im Gegensatz zum Individualansatz mehr Zielgruppen wie z.B. sozial Benachteiligte, Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen erreicht werden können (WHO, 1986).
Abbildung 3 veranschaulicht die unterschiedlichen Determinanten des Gesundheits-verhaltens. Aufgrund der Vielfalt wissenschaftlicher Erklärungstheorien und der ein-hergehenden Komplexität von Einflussfaktoren hat die grafische Darstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit vorzuweisen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3 : Determinanten des Gesundheitsverhaltens [5]
2.1.4 Beispiele gesundheitsrelevanter Verhaltungsweisen von Jugendlichen: aktuelle Situation in Deutschland
Das Gesundheitsverhalten im Jugendalter weist im Rahmen jugendtypischer Entwicklungsprozesse einige Besonderheiten auf (Petermann & Winkel, 2005). Neben personalen Faktoren wie dem Kosten-Nutzen-Verhältnis (Pinquart & Silbereisen, 2002) und der verminderten Vulnerabilität gegenüber Krankheiten, spielt in der Adoleszenz das soziale Umfeld (Familie, Schule/ Arbeit, Freunde) eine wesentliche Rolle für die Aneignung bestimmter gesundheitlicher Verhaltensweisen (Petermann & Winkel, 2005). Beispielsweise konnte in einer aktuellen australischen Studie von Pearson, Timperio, Salmo, Crawford und Biddle (2009) ein signifikanter positiver Einfluss der Eltern auf das Bewegungs- und Ernährungsverhalten von 10- bis 12-Jährigen nachgewiesen werden. Mit zunehmendem Alter rückt die vorbildliche Funktion der Eltern schließlich in den Hintergrund während der Kontakt zu Gleich-altrigen wächst (Hurrelmann & Albert, 2006). Ein guter Freund im Sportverein könnte dann ein Grund für die Aufnahme einer sportlichen Aktivität sein. Anderseits kann der Wunsch nach Integration in Peer-groups sowie die reflexive Distanz zu einer gesellschaftlich normierten „Erwachsenenwelt“ bei Jugendlichen, aber auch zu riskanten Verhaltensweisen führen (Raithel, 2005). In der Tat konnte z.B. gezeigt werden, dass Jugendliche mit einem erhöhten legalen Substanzkonsum einen größeren Freundeskreis und ein verstärktes Zugehörigkeitsgefühl besitzen als Heranwachsende mit einem geringen Konsum (Pinquart & Silbereisen, 2002). Neben Tabak-, Alkohol- und Drogenmissbrauch gehören aber auch ungesunde Ernährung und mangelhafte Bewegung zu Risikofaktoren in der Jugendzeit. Diese beiden gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit spezifiziert.
2.1.4.1 Körperlich-sportliche Aktivität und motorische Leistungsfähigkeit
Regelmäßige Bewegung und Sport sind von großer Bedeutung für die physische und psychosoziale Entwicklung von Jugendlichen (Robert Koch-Institut & Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2008). So besteht vor allem im Jugendalter ein positiver Zusammenhang zwischen ausreichend körperlich-sportlicher Aktivität und allgemeiner Fitness sowie motorischer Leistungsfähigkeit (Opper, Worth & Bös, 2005). Zugleich fördert ein aktiver Lebensstil die Herausbildung der Persönlichkeit, das Erlernen sozialer Kompetenzen und das psychosoziale Wohlbefinden (Lampert, Mensink, Romahn & Woll, 2007). Demgegenüber trägt der Auffassung Sygusch (2005) zufolge regelmäßige Bewegung bereits in jungen Jahren zur Verminderung von Risikofaktoren (z.B. Übergewicht) und der Entstehung von Folgeerkrankungen (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen) bei. Weiterhin wird vermutet, dass körperliche Aktivität und Sport in der Adoleszenz den Aktivitätsstatus im Erwachsenenalter positiv beeinflussen. Es liegen diesbezüglich geringe bis mittlere Korrelationen, insbesondere bei intensiven Sportarten, vor (Telama, Yang, Viikari, Välimäki, Wanne & Raitakari, 2005; Tammelin, Näyhä, Hills & Järvelin, 2003). Malina (2001) verweist dennoch auf eine relative Instabilität des körperlichen Aktivitätsverhaltens im menschlichen Lebenslauf. Dies gilt im Wesentlichen für Übergangsphasen wie der Pubertät und dem Eintritt in das Erwachsenenalter.
Auf internationaler Ebene besteht in vielen Studien und Übersichtsarbeiten Konsens über einen zu geringen Anteil körperlich aktiver Menschen (Wenninger, Gröben & Bös, 2007). In Deutschland sind 30% der über 18-Jähigen körperlich kaum aktiv, 45% treiben gar keinen Sport und lediglich 13% werden den gesundheitsförderlichen Empfehlungen – eine halben Stunde körperliche Aktivität an mindestens drei Tagen pro Woche – gerecht (Mensink, 2003). Diese Einschätzungen sind jedoch sehr stark davon abhängig, wie körperlicher Aktivität definiert und gemessen wird (Rütten & Abu-Omar 2003). Trotz der Tatsache, dass Heranwachsende eindeutig die körperlich Aktivsten in unserer Gesellschaft sind (Deutscher Sportbund, 2001; Sygusch, 2005), lässt die gegenwärtige Datenlage zum Bewegungsverhalten im Jugendalter bereits in dieser Altersgruppe Rückschlüsse auf eine verminderte körperlich-sportliche Aktivität ziehen. Die aktuellen Empfehlungen für Jugendliche von täglich mindestens einer Stunde körperlicher Aktivität bei moderater bis starker Intensität werden daher kaum noch erreicht (Cavill, Biddle & Sallis, 2001). Die erste deutsche umfangreiche Datenerhebung zum Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang körperlich-sportlicher Aktivität bietet das Kinder- und Jugendsurvey (KIGGS) vom Robert-Koch-Institut. Anhand eines Fragebogens wurde sowohl das sportliche als auch das körperliche Aktivitätsverhalten von 11- bis 17-Jährigen untersucht. Die Ergebnisse zeigen ohne Angabe der Dauer, dass 54% der Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren mindestens dreimal pro Woche körperlich aktiv sind und dabei ins Schwitzen oder außer Atem kommen. Jedoch sind es nur 23%, welche das täglich empfohlene Aktivitätspensum erreichen. Bei 16% der Befragten wird sogar ein inaktiver Lebensstil ersichtlich. Außerdem ist ein deutlicher Rückgang körperlich-sportlicher Aktivität im Laufe der Adoleszenz zu erkennen (s. Abb.4), was auch international vielfach belegt worden ist (Pearson, Atkin, Biddle, Gorely & Edwardson, 2009). Im Altersvergleich zwischen 11 und 17 Jahren reduziert sich die Anzahl der fast täglich aktiven Mädchen und Jungen im Durschnitt um 50% (s. Abb. 4). So sind lediglich 15% aller Jugendlichen der 17-Jährigen regelmäßig körperlich aktiv, wohingegen bei 25% ein inaktives Verhalten festgestellt werden konnte. Die stärkste Abnahme körperlich Aktiver repräsentiert dabei die Altersspanne von 14 bis 17 Jahren (Lampert et al., 2007).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4 : Häufigkeit körperlich-sportlicher Aktivität bei 11- bis 17-jährigen Jungen und Mädchen
Ein derart signifikanter Prävalenzeinbruch sportlicher Aktivität im Jugendalter konnte auch in weiteren deutschen Studien bestätigt werden. In der WIAD (Wissenschaft-liches Institut der Ärzte in Deutschland)-Studie (2001) und der Folgestudie WIAD-AOK-DSB-Studie II (2003) zeigte sich der stärkste Einbruch bei Jungen und Mädchen zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr (Deutscher Sportbund, 2001; Deutscher Sportbund, 2003). Knapp über die Hälfte dieser Altersgruppe liegt unter den Mindestanforderungen der Empfehlungen zur körperlich-sportlichen Aktivität und weist folglich geradezu ein sportabstinentes Verhalten auf. Bei beiden benannten Untersuchungen liegt der Fokus auf Jugendlichen bis zu 18 Jahren. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht jedoch das Bewegungsverhalten von Jugendlichen bis zu 25 Jahren. Hierzu liefert sowohl die 15. Shell-Jugendstudie (Hurrelmann & Albert, 2006) als auch die aktuelle „Fit-fürs-Leben“-Studie (Leyk, Rüther, Wunderlich, Heiß, Küchmeister & Piekarski et al., 2008) wichtige Ergebnisse. Während die 15. Shell-Studie das Bewegungsverhalten von Heranwachsenden im Alter von 12 bis 25 Jahren untersucht, besteht das Probandenkollektiv der „Fit-fürs-Leben“-Studie aus 16- bis 25-jährigen Jungen und Mädchen. Beide Untersuchungen zur sportlichen Aktivität können eine weitere kontinuierliche Abnahme des Sporttreibens in der mittleren und späten Adoleszenz nachweisen. Dabei ist die höchste Quote sportabstinenter junger Erwachsener im Alter von 25 Jahren im Durchschnitt relativ homogen und beträgt etwa ein Drittel. Neben den bereits ausführlich dargestellten personalen, sozialen und umweltgegebenen Einflussfaktoren wie Selbstwirksamkeitserwartung, Peer-Druck sowie Zugänglichkeit von Sportstätten, begründet der Deutsche Sportbund (2003) den Rückgang sportlicher Beteiligung in der Jugendzeit mit dem Einstieg ins Berufsleben und den damit verbundenen Belastungen sowie einer Neuorientierung der Interessen im Freizeitbereich.
Analog zum körperlichen Aktivitätsverhalten in der Freizeit lässt sich die sinkende Prävalenz im Laufe der Jugend zusätzlich anhand der Mitgliedschaften in Sport-vereinen feststellen. Obwohl für die Sportvereine in den letzten Jahren ein kontinuierlicher Zuwachs an Mitgliedern von ca. 23 Millionen (1991) auf ca. 27 Millionen (2007) verzeichnet wurde, scheinen Fluktuationen speziell für Jugendliche charakteristisch zu sein. Aus einer Übersicht des Deutschen Olympischen Sportbundes für das Jahr 2007 ist eine wesentliche Reduktion der Anzahl von Vereinsmitgliedern ab dem 15. Lebensjahr zu erkennen (Deutscher Olympischer Sportbund, 2007). Auch die WIAD-AOK-DSB-Studie II bestärkt diesen Sachverhalt. In Bezug auf die Gesamtbe-völkerung bilden Jugendliche nach Kindern trotzdem einen Großteil der Vereins-mitglieder. Sygusch (2005) verweist an dieser Stelle auf eine durchschnittliche Vereinszugehörigkeit von 8 Jahren bis zum Ende des Jugendalters. Wie viele der jugendlichen Mitglieder im Sportverein aber tatsächlich sportlich aktiv sind, ist bisher noch nicht ausführlich untersucht worden (Mensink, 2003).
Die bereits im Jugendalter existierenden beträchtlichen körperlichen und seelischen Gesundheitsbeeinträchtigungen sind unter anderem die Folge einer inaktiven Jugend des 21. Jahrhunderts (Sygusch, 2005; Robert Koch-Institut & Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2008). In der vorliegenden Ausarbeitung wird der Schwerpunkt auf den physischen Bereich gelegt. Hierbei steht die motorische Leistungsfähigkeit im Vordergrund. Sie setzt sich aus den Dimensionen Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination zusammen. Als physische Gesundheits-ressource hat die motorische Fitness eine bedeutsame vorbeugende Funktion gegenüber Risikofaktoren, spezifische Erkrankungen sowie Unfälle (Sygusch, 2005). Auf internationaler und nationaler Ebene gibt es im umfangreichen Maße Studien zur Erfassung der motorischen Leistungsfähigkeit bei Kindern. Untersuchungen bei Jugendlichen wurden dagegen seltener vorgenommen (Bös, 2003; Opper, Worth & Bös, 2005). Obwohl die meisten Studien aufgrund von methodischen Mängeln (z.B. keine standardisierten Testverfahren, überwiegend Querschnittsstudien) für eine Beschreibung genereller Entwicklungen der körperlichen Fitness im Jugendalter ungeeignet sind, ist eine Verschlechterung der motorischen Leistungsfähigkeit über längere Zeiträume von ca. 25 Jahren um durchschnittlich 10% anzunehmen (Bös, 2003). Der Rückgang der motorischen Fähigkeiten vom Kindes- zum Jugendalter liegt Bös (2003) zufolge einerseits dem säkularen Trend[6] und anderseits den veränderten individuellen Lebensbedingungen zugrunde. Deutschlandweit existieren nur wenige aktuelle Längsschnittstudien zur motorischen Leistungsentwicklung von Jugendlichen zwischen dem 16. und 25. Lebensjahr. Zwar liefern die WIAD-Studie (2001) und WIAD-AOK-DSB-Studie II (2003) erste mögliche vergleichbare Fitness-daten von 12- und 18- jährigen Jungen und Mädchen, allerdings können die Ergebnisse infolge des kurzen Untersuchungszeitraums nur mit Vorsicht interpretiert werden. Der Trend zu einer Abnahme der körperlichen Fitness lässt sich trotzdem bestätigen. Innerhalb von knapp 2 Jahren konnte somit überwiegend im koordinativen Bereich (Ballprellen und Zielwerfen) und in der anaeroben Ausdauer (Stufensteigen) ein Leistungsrückgang beobachtet werden. Im Altersvergleich hat sich die motorische Leistungsfähigkeit insgesamt zu Ungunsten der jüngeren Probanden (11 bis 14 Jahre) signifikant verschlechtert. Im Vergleich zu 1995 ist der Leistungsrückgang in dieser Altersgruppe ebenfalls eindeutig nachgewiesen worden, denn lediglich 77% der Jungen und Mädchen erreichen die durchschnittlichen Ergebnisse der Gleichaltrigen aus dem Jahr 1995 (Deutscher Sportbund, 2001; Deutscher Sportbund, 2003). Aus aktueller Perspektive liefert das Motorik-Modul der KIGGS-Studie eine repräsentative Datenbasis für eine Längsschnittuntersuchung (Starker, Lampert, Worth, Oberger, Kahl & Bös, 2007). Mit Hilfe dieses methodisch gut durchdachten Zusatzmoduls besteht nunmehr die Möglichkeit vorhandene Forschungslücken zu schließen. Im Rahmen des Motorik-Moduls liegen derzeit bundesweit Daten zur motorischen Fitness von ca. 6.700 Kindern und Jugendlichen vor. Dabei wurden die Dimensionen Kraft, Beweglichkeit und Koordination bei Kindern zwischen dem 4. und 10. Lebensjahr untersucht. Die Ausdauerleistungs-fähigkeit wurde hingegen in der Altersgruppe der 11- bis 17- Jährigen mittels des „Fahrradergometer-Tests“ erfasst. Im Hinblick auf Jugendliche konnte erwartungs-gemäß für Ältere (17. Lebensjahr) eine signifikant bessere aerobe Ausdauer als für Jüngere festgestellt werden (11. Lebensjahr). Demgegenüber steht die Unter-suchung von Leyk, Rohde, Gorges, Ridder, Wunderlich, Dinklage, et al. (2006). In dieser Studie wurde innerhalb von vier Jahren (2000 bis 2004) die körperliche Fitness von über 58.000 deutschen Jugendlichen (48.637 männlich, 7914 weiblich) zwischen dem 17. und 26. Lebensjahr ermittelt. Als Eignungsprüfung für die Bundeswehr führten die jungen Erwachsenen einen sportmotorischen Test – den Physical-Fitness-Test (PFT) – durch. Dabei wurden die physischen Leistungs-grundlagen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination in fünf Disziplinen (4x9m Pendellauf, Sit-ups, Standweitsprung, Liegestütz, Cooper-Test) überprüft. Die Anforderungen des Tests sind so konstruiert worden, dass sie bei einem moderaten körperlichen Fitnesszustand erfüllt werden können. Trotzdem bestehen insgesamt 38% der Bewerber den Fitnesstest nicht. So konnten beispielsweise im „Cooper-Test“, in welchem die Testpersonen in 12 Minuten so weit wie möglich laufen sollten, lediglich 1.901 männliche und 1.476 weibliche Jugendliche die geforderten zwei Punkte erreichen. Vergleichbar mit einem 100m-Lauf entspricht das eine Zeit von 37,9 Sek. für die Jungen und 48,8 Sek. für die Frauen. Außerdem hat sich bei den männlichen Jugendlichen die Durchfallquote seit 2001 signifikant erhöht.
[...]
[1] Zu den wissenschaftlichen Disziplinen gehören Gesundheitspsychologie, Gesundheitssoziologie,
Gesundheitsökonomie, Gesundheitspädagogik und Gesundheitswissenschaften.
[2] Eine detaillierte Erläuterung der Grundsätze kann bei [Hurrelmann (2006)] auf den Seiten 139-145
nachgelesen werden.
[3] In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Determinanten, Einflussfaktoren und Faktoren synonym verwendet.
[4] Die einzelnen Modelle sind in Schwarzer (2004) detailliert erläutert.
[5] Das Selbstkonzept bzw. Selbstbild beschreibt die subjektive Bewertung der eigenen Person. Es wird zwischen emotionalen, sozialen und körperlichen Selbstkonzept unterscheiden. (Hurrelmann, 2006)
[6] Nach Knußmann (1996) wird unter säkularen Trend die durchschnittliche Entwicklungs- beschleunigung von Menschen einer bestimmten Epoche gegenüber denen einer anderen Epoche verstanden.
Details
- Titel
- Entwicklung eines Präventionsprogramms für Auszubildende zur Förderung eines gesundheitsbewussten Lebensstils
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 111
- Katalognummer
- V227799
- ISBN (eBook)
- 9783836647120
- Dateigröße
- 1105 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- auszubildende sport lebensstil ernährung prävention
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2010, Entwicklung eines Präventionsprogramms für Auszubildende zur Förderung eines gesundheitsbewussten Lebensstils, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/227799

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.


