Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos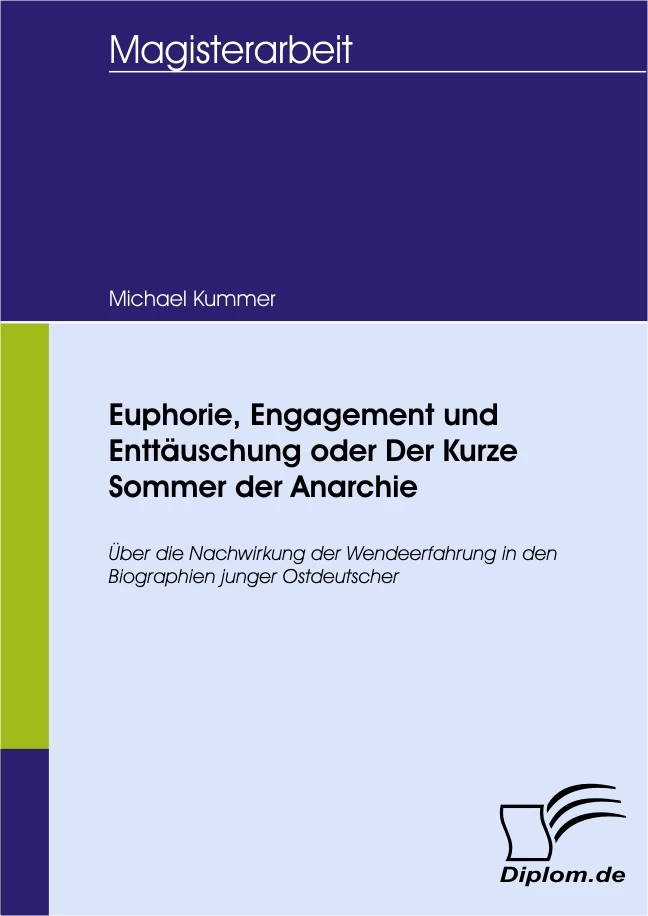
Euphorie, Engagement und Enttäuschung oder Der Kurze Sommer der Anarchie
Magisterarbeit, 2004, 91 Seiten
Autor

Kategorie
Magisterarbeit
Institution / Hochschule
Friedrich-Schiller-Universität Jena (Philosophische Fakultät, Historisches Institut)
Note
2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Prolegomena
2. Erinnerung und Historie
3. Methodisches
4. Hauptsächliches
4.1. Welche Erinnerungen an das Erleben der Wendezeit existieren?
4.1.1.Staatsnahe
4.1.2. Staatsferne
4.1.3. Mitläufer
4.1.4. Erste Erkenntnisse
4.2. Welche Handlungsmotivationen werden aus dieser Erinnerung an die Wende abgeleitet?
4.2.1. Prägungen und Bilanzen bei den Distanzierten und den Unbedarften
4.2.2. Prägungen und Bilanzen bei den Engagierten
4.2.2.1. Das Polizistenmotiv
4.2.2.2. Das Veränderbarkeitsmotiv
4.2.2.3. Das Entfremdungsmotiv
4.3. Sichtweisen auf Demokratie und Bundesrepublik
4.3.1. Die Unbedarften
4.3.2. Die Veränderbarkeitsgläubigen
4.3.3. Die Entfremdeten
4.4. Wie prägte die DDR und was macht den Ostdeutschen aus?
4.5. Reales und potentielles gesellschaftliches Engagement
4.5.1. Die Distanzierten
4.5.2. Die Engagierten
5. Vergleichendes
5.1. Unbrauchbare Indikatoren
5.2. Die Relevanz der primären Sozialisationsinstanz Elternhaus
5.3. Eigene und psychologische Bedeutungszuschreibungen
5.4. Über die Identifikation zum neuen Staat
5.5. Der doppelte Loyalitätskonflikt
5.6. Das Wirken in der Gesellschaft
6. Standpunkte und Ausblick
7. Anhang
7.1. Fragespiegel
7.2. Interviews
7.3. Quellen und Literatur
7.4. Internet
1. Prolegomena
Die vorliegende Arbeit zur Erlangung des Magistergrades wird nicht nur ein wissenschaftlicher, sondern, wiewohl ungewöhnlich, auch ein unmittelbar meine Selbsteinschätzung betreffender Erkenntnisprozess. Dass sich beides dabei nicht gegenseitig ausschließt, will ich versuchen. Die Hintergründe werden im Folgenden ersichtlich.
Die dem Prozess anhaftende Charakteristik eines Verlaufs wird von mir insoweit berücksichtigt, dass ich beim Verfassen dieser einleitenden Zeilen auch tatsächlich am Beginn der Analyse stehe. Das Schreiben der Arbeit wird also die nach Außen gerichtete Begleitung der in mir entstehenden und vorhandenen Gedanken sein, um mich einerseits zu vergewissern oder zu berichtigen und andererseits dem Leser das Nachvollziehen meiner Perspektive auf das Geschehene und zu Erwartende zu ermöglichen. Im Verlauf der Arbeit kann ich damit rechnen, dass noch zu formulierende Vermutungen und Hypothesen sich als gar nicht oder nur als abgeschwächt haltbar erweisen, andere dagegen sehr wohl.
In vielen seit 1990 entstandenen Jugendstudien wurden abweichende gesellschaftliche wie politische Einstellungen ostdeutscher Befragter gegenüber ihren westdeutschen Altersgenossen beobachtet. Die Begründung, die hierfür meist angeführt wurde, war die für die Ostdeutschen grundlegend verschiedene Erfahrung eines Lebens in der Diktatur. Zu Beginn der 90er Jahre ging man noch davon aus, dass dieses Phänomen sich im Laufe der nächsten Jahre verflüchtigen würde, doch in nicht wenigen Positionen trat das Gegenteil ein und die Meinungsverschiedenheiten differenzierten sich im Laufe der Zeit weiter aus.[1] Wenig oder gar kein analytisches Interesse fanden dagegen die Nachwirkungen der Erlebnisse während der Umbruchphase 1989/90 auf die gesellschaftspolitischen Positionen der Befragten und damit auf die Grundlage ihres Handelns im öffentlichen Raum. Dieser Frage nachzugehen wird Aufgabe dieser Magisterarbeit.
Fundament und damit Ausgangspunkt meiner Vorüberlegungen und der sich daran anschließenden Fragestellungen sind meine eigenen Erfahrungen und Eindrücke in der DDR während der friedlichen Revolution von 1989 (oder zumindest meine Erinnerungen daran) und deren von mir vermuteter prägender Wirkung. Diese Arbeit wird mich somit in der Suche nach meinen eigenen Prägungen und nach den Ursachen für verschiedene gesellschaftspolitische Einstellungen unterstützen und dennoch hoffe ich, dem Anspruch der Objektivität innerhalb einer historisch-wissenschaftlichen Arbeit gerecht zu werden. Was ich darunter verstehe, führe ich näher im Kapitel Erinnerung und Historie aus. Um den Stimulus meines Forschens nachvollziehen zu können, will ich zunächst meine Erfahrungen während des Umbruchs in der DDR im Jahr 1989 kurz schildern.
Für mich persönlich lassen sich die Tage und Wochen der sogenannten Wende[2] am ehesten als ein Politisierungsprozess bisher nicht wieder erlebten Ausmaßes benennen. In der von mir zum damaligen Zeitpunkt besuchten Schule in Erfurt, ich war 15-jährig, fand herkömmlicher Unterricht aufgrund der sich in diesen Tagen und Wochen ständig ändernden politischen wie gesellschaftlichen Lage nur noch am Rande statt. Anstelle des geplanten Unterrichtsinhalts wurde überwiegend über die neuesten politischen Vorgänge und die rasanten Veränderungen in der DDR geredet und diskutiert und sich gegenseitig informiert. An manchen jener Tage gingen wir dazu sogar in den Nachmittagsstunden aus eigenem Antrieb in die Schule, eine für einen pubertierenden Schüler sehr ungewöhnliche Handlung. Wir engagierten uns freiwillig, etwas, was es in dieser Form und in diesem Ausmaß vor der Wende und bei den meisten auch danach nie wieder gab.
Wir diskutierten mit den Lehrern und waren mit unseren Vorschlägen und unserer Kritik, die auf einmal frei geäußert werden durfte, nicht eben zimperlich. Umso faszinierender war es für uns, wenn sich ein Lehrer offen vor der Klasse zur Notwendigkeit des Wandels und zu den gemachten Fehlern bekannte. Wir sammelten Ideen, entwarfen Konzepte und kreierten Wandzeitungen zu aktuellen politischen Themen, besonders zu den aus Schülersicht notwendigen Veränderungen in der DDR. Wir taten das alles für einen Staat, welchen wir als „unsere“ DDR, als „unser“ Land ansahen und den wir verbessern und verändern, nicht jedoch abschaffen wollten. Die DDR war für uns plötzlich ein Land, über dessen Zukunft und dessen Ausgestaltung wir nun mitredeten, scheinbar mitentschieden und in dem es vermeintlich keine Barrieren mehr gab, kritisch und konstruktiv tätig zu werden.[3] Wir fühlten uns von allen bisher lähmenden Fesseln befreit. Und trotz fehlender Problematisierung im eigenen Elternhaus und damit fehlender familiärer Unterstützung ging ich mit einigen meiner Klassenkameraden auf den Erfurter Domplatz, um für eine gerechtere, offenere und bessere sozialistische Gesellschaft zu demonstrieren.
Es war eine Zeit des stürmischen Wandels. Ich war in einem bis dahin unbekannten und bis heute nicht wieder erreichten Maß politisch motiviert und euphorisiert. Trotz aller düsteren Nachrichten über die wirtschaftliche Lage des Landes fühlte ich mich leicht, frei und unbeschwert. Viele der Menschen um mich herum blühten in dieser rauschhaften Zeit auf und offenbarten ihr Potential an Engagement, Kreativität und Selbständigkeit. Ich sah Menschen, welche die Veränderung der bestehenden Verhältnisse wollten und die Veränderbarkeit dessen spürten. In diesen Tagen und Wochen fühlten ich und so viele um mich herum die im positiven Sinn mitreißende und inspirierende Kraft der Anarchie.
Dass solcherart emotionale Erfahrungen an mir als einem damals jungen Menschen nicht spurlos vorüber zogen, ist auf den ersten Blick mehr als einleuchtend. Und ich habe natürlich ein tiefes Interesse, den Nachwirkungen und Prägungen der beschriebenen Ereignisse auf die Spur zu kommen. Dies jedoch an mir selbst einzuschätzen, scheint mir im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit hingegen unangebracht, weshalb ich nun den Blick von mir vorerst weglenken möchte. Um die Problematik und die darin enthaltenen Fragestellungen weiter zuzuspitzen, möchte ich einen kurzen einleitenden Blick über die geäußerten Erfahrungen anderer Ostdeutscher meiner Altersgruppe wagen.
Als Vorgeschichte dieser Erinnerungen lässt sich für die zweite Hälfte der 1990er Jahre ein regelrechter Boom an selbstvergewissernden und damit selbstbestätigenden literarischen Äußerungen junger Westdeutscher feststellen. Exemplarisch möchte ich hier Benjamin von Stuckrad-Barre[4] und Florian Illies[5] nennen. Etwas überspitzt resümierte darüber die Frankfurter Allgemeine Zeitung folgendermaßen: „Eine disparate Generation vereinzelter Glückssucher ohne große, gemeinsam erlebte geschichtliche Ereignisse fand im Zeichen der Literatur zu sich und zueinander. ... Die Sehnsucht, Teil einer Jugendbewegung zu sein, wurde wenigstens beim einsamen Lesen zu Hause erfüllt.“[6]
Beeinflusst durch einen Text von Karl Mannheim[7] erscheint es mir zunächst einmal wenig sinnvoll, die Begriffe disparat und Generation in einem Zusammenhang zu benutzen, doch darüber hinaus kann ebenjener Hinweis auf das fehlende Bindeglied des kollektiven historischen Ereignisses ein Schlüssel zum Verständnis der darauf folgenden Entwicklung in der jungen deutschen Literatur sein. Denn nun fanden auch junge Ostdeutsche den Weg und den Mut, ihr Leben in der DDR, ihre Wendeerfahrungen und ihr Neubundesbürgerleben in Selbstbeschreibungen mitzuteilen.[8] Vorrangig sind es Frauen, beispielhaft möchte ich hier Jana Simon[9], Jana Hensel[10], Julia Schoch[11] und Abini Zöllner[12] nennen. Fast immer kommt es in diesen überwiegend autobiographischen Werken zu mehr oder weniger direkten Schilderungen der bewegten Wendezeit und ihrer Nachwirkungen auf das Leben der VerfasserInnen oder auf das ihrer literarischen Protagonisten. Es ist das beherrschende und allem Anschein nach auch das einende Thema, womit im Mannheimschen Sinne eine der entscheidenden Vorraussetzungen für einen Generationszusammenhang (bis hin zur Generationseinheit) gegeben ist.
Sehr gegensätzliche Reaktionen zweier Autoren auf dieselbe euphorische Wendeerfahrung, ähnlich der meinigen, finden sich in einer im Jahr 2000 erschienenen Aufsatzsammlung[13]. Während der eine, Frank Rothe, sich durch das Erlebnis eines zusammenbrechenden Gesellschaftssystems dazu verleiten lässt, keiner zukünftigen Ordnung mehr zu trauen und den Rückzug ins Private forciert[14], meint der andere, Carsten Schneider, daraus einen Antrieb zur demokratischen und pragmatischen Mitwirkung an der Gesellschaft zu verspüren[15]. Für den einen ist es also eine Erfahrung von etwas Verschwindendem, für den anderen von etwas Entstehendem, und dennoch von beiden positiv eingeschätzt und für beide grundlegend prägend. Damit ist der Spannungsbogen möglicher Reaktionen und Verarbeitungen dieser historischen Erfahrung aufgezeichnet.
Im Osten Deutschlands fanden solche literarischen, aber auch die filmischen Schilderungen durchweg eine viel stärkere Rezeption als im Westen. Der vor kurzem im Kino gelaufene Film Good bye, Lenin! stellt diese kurze, aber umso glückseligere Phase zwischen den Systemen auf bewegende Weise dar und findet genau damit nun auch ein großes Publikum in den alten Bundesländern.[16] Während der Erfolg im Osten Deutschlands aller Wahrscheinlichkeit nach durch Akte der Selbstbestätigung und Identifikation ihres Erfahrungsvorsprungs die Menschen in Scharen in die Kinos treiben oder die Bücher zur Hand nehmen ließ und lässt, spricht vieles dafür, dass sich im Westen die Sehnsucht nach solch einem historischen Ereignis mit all seiner Prägekraft langsam Bahn bricht.[17] Diese Einschätzung ist im Übrigen ganz und gar unabhängig davon, in welchem Maße dabei Fiktionen seitens der westlichen Bundesbürger über die Wendezeit vorhanden sind, wichtig erscheint mir allein die Existenz des Verlangens.
Aus den bisherigen einleitenden Worten ergeben sich nun die zwei Hauptfragen meiner Magisterarbeit, die ich zunächst allgemein formulieren und danach durch methodische Vorüberlegungen präzisieren möchte. Zum einen frage ich nach den während des Umbruchs von 1989 gemachten Erfahrungen und Erlebnissen und zum anderen danach, wie mit diesem historischen Ereignis im Leben des Einzelnen umgegangen wird, also wie sich dieses auf die späteren Lebensgeschichten und Einstellungen des jeweilig Befragten auswirkt.
Um diese Fragen zu beantworten und die noch zu schildernde These auf ihre Plausibilität zu überprüfen, ziehe ich hauptsächlich von mir geführte narrativ-biographische Interviews als Quellen heran. Die Begründung dafür und die von mir angewandte Methode erläutere ich im Kapitel „Grenzen und Möglichkeiten des Interviews“ näher.
Bereits verschriftlichte, zumeist autobiographische Quellen und eine Auswahl der jene Fragestellungen thematisch schneidenden Forschungsliteratur aus den Gebieten der Zeitgeschichte, der Soziologie, der Politikwissenschaft und der Psychologie ziehe ich ebenfalls heran. Um den Rahmen einer Magisterarbeit nicht zu sprengen, ist es meines Erachtens nach ausreichend und notwendig, fünfzehn qualitative Interviews erstellt zu haben. Durch die Interpretationen dieser strebe ich die Formulierung und die Unterfütterung einer typologischen Hypothese an. Ob ich das erreiche, hängt von den Aussagen der Interviewten ab und ist somit zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.
Zunächst will ich jedoch die Auswahl des befragten Personenkreises näher erläutern.
In den lebensgeschichtlichen Interviews des an der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Sommersemester 2002 stattgefundenen Hauptseminars „Erfahrungstransfer zwischen Generationen im Systemumbruch“ stellte sich eine Scheidung um das Geburtsjahr 1976/77 recht deutlich heraus. Mit einiger einzigen Ausnahme berichteten alle bis 1977 geborenen Befragten von einer bewusst miterlebten Zeit der 89‘er Umbrüche in der DDR. Dabei reichte das Erleben des Wandels von aktiver Teilnahme bis hin zu abwartender Haltung. Die im Jahr 1977 oder später Geborenen konnten dagegen die Bedeutung dieser Zeit nur retrospektiv benennen. Für sie war die Zuwendung und Interaktion zu und mit der weiteren Umwelt noch nicht eingeleitet. Entwicklungspsychologisch wird betreffs der Sozialisationsinstanzen und -phasen grundlegend angenommen, dass die Zeit zwischen dem Beginn der Pubertät und dem schwer definierbaren Ende des Jugendalters bei den meisten Menschen die entscheidende Phase der Ausprägung eigener Werte und moralischer Einstellungen ist.[18] In dieser Zeit findet die Lösung vom Elternhaus als meinungsbildender Instanz statt und außerfamiliäre Faktoren wie z.B. die Schule, der Betrieb, die peer-group und die allgemeine Öffentlichkeit mit ihren Medien und Institutionen treten bestimmend hervor. In jenem Abschnitt wachsender Unabhängigkeit und Selbstdefinition beginnt der pubertierende Mensch seine Identität als Erwachsener herauszubilden.[19] Aus den eben genannten Gründen habe ich mich für Interviewpartner entschieden, die hauptsächlich in der ersten Hälfte der 1970er Jahre geboren wurden. Auch in der örtlichen Auswahl der Befragten erschien es mir methodisch sinnvoll, Einschränkungen zu treffen. Die Wahrscheinlichkeit der Erfahrung von öffentlichen Protesten größeren Ausmaßes während der Umbruchzeit in der DDR und damit der Möglichkeit der Teilnahme an diesen ist umso größer, je mehr es so etwas wie eine städtische Kultur gab. Daher und weil dies mein Studienort ist, habe ich ausschließlich junge Ostdeutsche, welche die Wendezeit in Jena erlebten, befragt.
Auf der Suche nach der jeweiligen Wendeerfahrung und ihrem vermuteten prägenden Einfluss habe ich Ostdeutsche gegensätzlicher Herkunft zu Wort kommen lassen. Denn erst auftretende Differenzen ermöglichen kontrastierende Aussagen und damit eine Überprüfung meiner Vermutungen. Somit habe ich versucht, jeweils ein Drittel der beabsichtigten Interviews mit Menschen aus ungleichen Herkunftsmilieus[20] durchzuführen. Ausschlaggebend war dabei die Frage nach den Wendeerlebnissen und da diese eng mit den Einstellungen des unmittelbaren familiären Umfelds zum Staat DDR zusammenhängen, erschienen mir folgende Kontrollgruppen sinnvoll:
1. Die Staatsfernen
Idealtypischerweise konnte ich hier erwarten, dass bei diesen Befragten, welche vor allem aus kirchlichen und kirchennahen Kreisen kamen, eine allgemeine innere Distanz zum Staat DDR und vor allem zu seinen politischen Institutionen bestanden hat. Deshalb konnte ich auch davon ausgehen, dass sich die meisten dieser Menschen in verschiedenster Form während der Umbruchzeit engagierten und auf eine Veränderung der bestehenden Verhältnisse hinwirkten. Vermutlich war das Ziel dabei die Ordnung der Bundesrepublik, also das westliche Gesellschaftsmodell mit seinem liberalen und doch das Christentum fördernden Staatssystem. Und dieses wurde erreicht. Das Aktivsein während der Wende, in welcher Form auch immer, hatte sich somit gelohnt. Ich konnte damit vermuten, dass eben auch durch diese historische Grunderfahrung eine positive Einstellung zum heutigen Staat, zu seinen Institutionen und zum eigenen Engagement zu beobachten sein wird.
2. Die Staatsnahen
Die durch diese Elternhäuser geprägten jungen Menschen werden idealtypisch betrachtet die Veränderungen abgelehnt haben und diesen abwartend, wenn nicht gar ängstlich gegenübergestanden haben. An ein Engagement für Veränderung war weniger zu denken, und wenn, dann eher, um die alten Zustände zu konservieren und weiteren „Schaden“ zu begrenzen. Wenn diese Menschen während des Umbruchs also eher passiv, verunsichert und orientierungslos waren, dann kann das bereits beschriebene Hochgefühl von Freiheit und Politeuphorie nicht oder nur stark abgeschwächt empfunden worden sein. Der Verlust bisheriger familiärer Privilegien wird eine positive Einstellung zum bundesrepublikanischen Staat mit seinen Institutionen und zum eigenen Engagement nicht wahrscheinlich machen.
3. Die Mitläufer
Die weiteren Interviews habe ich mit Menschen durchgeführt, in der sich das elterliche Umfeld durch eine passive oder nicht klar erkennbare Haltung zum Staat DDR von den beiden eben benannten Herkunftsmilieus abhebt. Hier sind ähnliche Erfahrungen wie die meinigen zu erwarten.
Wie jedoch kann diese wissenschaftliche Arbeit objektiven, also unvoreingenommenen und unparteiischen Ansprüchen genügen, wenn ich als der Untersuchende durch meine eigenen Erlebnisse derart vorgeprägt bin? Um das zu konterkarieren, habe ich jene zunächst sehr grobe Herkunftsentgegensetzung aufgestellt. Meine aus meiner Eigenerfahrung gewonnene These soll durch diese Auswahl der Interviewten möglichst herausfordernden Testbedingungen ausgesetzt werden. Mann kann das mit einer Art Schablone vergleichen, denn oft ist es nur durch diese möglich, die Konturen des Darunterliegenden zu erkennen. Dass die soziale Wirklichkeit jedoch wesentlich komplexer ist, steht dabei außer Frage.
Ich glaube, dass dieses induktive Vorgehen, also die Betonung und Beachtung der Eigenerfahrung, eine gesteigerte Sensibilität für den Untersuchungsgegenstand sichern kann. In diesem Sinne kann dieses bewusst gewählte Vorgehen eben nicht eine Schwäche, sondern eine Stärke dieser Arbeit werden.
Aus all dem bisher Gesagten ist es nun besser möglich, die Fragen dieser Magisterarbeit genauer zu formulieren:
Zum einen begebe ich mich also auf die zeitzeugengestützte Suche nach den Wendeerfahrungen zwischen 1969 und 1977 geborener Ostdeutscher, welche die Zeit des 89er Umbruchs in der Stadt Jena erlebten und welche aus gegensätzlichen Herkunftsmilieus entstammen. Darauf aufbauend versuche ich zum anderen, den Auswirkungen dieser Erfahrungen auf Lebensläufe, Zukunftsplanungen und Verortungen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft interpretatorisch näher zu kommen.
Meine dieser Arbeit zugrundeliegende Hypothese lautet nun: Die Quantität und die Qualität politischer wie gesellschaftlicher Teilhabe wirken sich auf die gesellschaftspolitischen Einstellungen und damit auf die daraus folgenden Handlungen grundlegend aus. Vor allen Dingen dann, wenn jene unmittelbar erlebte Partizipation während der pubertären Phase geschieht. Ich erwarte, dass sich solche Erfahrungen fundamental in den Lebensläufen, Einstellungen und Zukunftsplanungen nachwirkend spiegeln.
2. Erinnerung und Historie
Zeitzeugenberichte sind unzuverlässig und subjektiv, sie sind von der Stimmung des Berichtenden und von der Interaktion mit dem Zuhörer abhängig. Vieles wird in den Berichten vom Geschehenen weggelassen und ebenso einiges dazugedichtet. Mit diesen und ähnlichen mehr oder weniger fundierten Vorwürfen will ich mich nun im folgenden Kapitel, in dem es um die Möglichkeiten und die Grenzen der mündlich erfragten Geschichte gehen soll, auseinandersetzen. Ich stütze mich dabei vor allem auf den Zimbardo[21], der den heutigen allgemeinen Kenntnisstand in der Psychologie wiedergibt. Etwaige neueste Erkenntnisse in Detailfragen muss ich an dieser Stelle aus Platz- und Kompetenzgründen außer Acht lassen. Im Übrigen ist ein seltsames Phänomen zu beobachten. Publikationen oder wenigstens Ausführungen von Historikern, die sich mit dieser für ihre Wissenschaft so elementaren Problematik auseinandersetzen, sind entgegen meiner ursprünglichen Erwartung nur selten zu finden. Wenn ich mich durch Befragungen von Zeitzeugen auf das Gedächtnis der Interviewten stütze und ich mit den getroffenen Aussagen wissenschaftlich nachvollziehbar umgehen will, müssen mir in erster Linie die Grundlagen und die Möglichkeiten des menschlichen Gedächtnisses bekannt sein.
Unsere Sinne haben die Eigenschaft, alle sich in ihrem Messspektrum befindlichen Signale zu erfassen. Diese Unmenge an sinnlichen Informationen über Farben, Töne, Gerüche usw. ist für eine Verarbeitung durch unser Gehirn aufgrund seiner begrenzten Kapazität jedoch zu groß. Um mit diesem Überangebot an Beobachtungen umzugehen, werden die ankommenden Signale unbewusst gefiltert. Wir sind somit lediglich selektiv aufmerksam, aus dem gefilterten Material wird ein zusammenhängendes Bild der Welt hergestellt und wir glauben, dass dies alles ist, was uns umgibt. Die durch den Filterungsprozess entstandenen Lücken werden also durch konstruktive Leistungen des Gehirns kompensiert. Wenn dem so ist, dann stellt sich die Frage, welche Aussagen darüber getroffen werden können, wie diese Konstruktionen aussehen. Wenn ich im Folgenden von Konstruktionen spreche, meine ich damit hauptsächlich das Vereinfachen von Zusammenhängen, das Hervorheben und Überbetonen von Details und die Veränderung von Einzelheiten für eine bessere Stimmigkeit zur erzählenden Person.
Maßgeblich wird unsere Wahrnehmung durch unsere Erwartungshaltung beeinflusst, aber auch „psychische Aspekte, wie Konzentration, Motivation, Emotion und Erfahrung, wirken sich auf die qualitative und quantitative Dimension aus, ganz zu schweigen von dem endokrinen und biochemischen inneren Milieu, das seinerseits mit dem Genannten in reger Interaktion sich befindet“[22]. Extreme emotionale Zustände können die Wahrnehmung bzw. die Inhalte stark verändern. Die Organisationsprozesse und Kontexteinflüsse machen sich bei der Wahrnehmung der „Wirklichkeit“ sehr stark bemerkbar und sind entscheidende Faktoren bei der Informationsaufnahme. Aspekte der Entwicklung und Reife sind zusätzlich zu betonen. Frühere Erfahrungen, z.B. Gewohnheiten, kulturelle Erfahrungen, wirken sich recht unterschiedlich aus, vor allem klassische optische Täuschungen sind erfahrungsabhängig.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Wahrnehmung demnach in hohem Maß selektiv, als auch aktiv-kreativ und ebenso interaktionell ist. Wahrnehmung ist ein hypothesengesteuerter Interpretationsprozess, der immer das Ziel hat, stimmige und in sich geschlossene und in allen Aspekten kohärente Interpretationen zu liefern und für alles Ursachen und nachvollziehbare Begründungen zu suchen. Wahrnehmung bildet demnach nicht ab.
Die bei der Wahrnehmung bereits gefilterten und damit handhabbaren Informationen werden im Gehirn mittels sogenannter Engramme abgespeichert. Ein Engramm ist eine im Zentralnervensystem hinterlassene Spur eines Reiz- oder Erlebniseindrucks, die dessen Reproduktion zu einem späteren Zeitpunkt möglich macht.[23] Das bedeutet, dass nicht die Worte, sondern die Inhalte und Bedeutungen, also das Erleben einer Situation, kontextabhängig an verschiedenen Stellen im Gehirn abgespeichert werden und unter genau diesen Kontexten dann auch wieder abrufbar sind.[24] Das Hervorholen der abgespeicherten Information, also das Erinnern, ist demnach eine Rekonstruktion von bruchstückhaften und voneinander getrennten Gedächtnisspuren. Das lässt sich aus häufig vorkommenden Fehlern nachweisen, z.B. bei der Erinnerung an eine Aussage, aber der gesamte Kontext ist dabei vergessen oder bei Einsichten, die als die eigenen geäußert werden, aber es gibt keine Erinnerung mehr an den Lernprozess. Bei diesen beiden Beispielen gelingt es dem Erinnernden demnach nicht, einen zusammenhängenden Kontext zu erinnern.
Gelingt es dem Berichtenden, sich an etwas zu erinnern, erlebt er parallel dazu die Erzählsituation. „Jede Erinnerungssituation hat nämlich eine ‚konfigurative Dimension‘, in der die kommunikativen Akte – Geschichte, Ergänzungen, Kommentare, Fragen – nach Maßgabe von Erzählkonventionen, Plausibilitäts- und Kausalitätserwartungen usw. geordnet werden, dass eine für alle Beteiligten sinnhafte Geschichte entsteht."[25] Diese Konfiguration fließt nun wiederum in den Kontext der eigentlichen Erzählung mit ein, d.h. mit jeder Erinnerung erneuern sich die Engramme. Woran man sich immer wieder erinnern will, muss immer wieder durchdacht und durchfühlt werden, die alte Erinnerung wird dabei neu kontextualisiert und damit verändert.[26] Erinnern geht also einher mit einer Aktualisierung der Perspektive, mit einem Neu-Einschreiben.[27]
„Erinnerung ist also für die gleichen Deformationsprozesse anfällig wie die Primärwahrnehmung selbst.“[28] Sie ist eine Fortsetzung des konstruktiven Prozesses der Wahrnehmung. Veränderungen der ursprünglich erlebten Situationen können also bei der Enkodierung, als auch bei der Dekodierung und wahrscheinlich auch beim Speichern selbst auftreten. Es kann keine Zuverlässigkeit von menschenvermittelten historischen Quellen geben, zumindest nicht wenn man darunter etwas Objektives, etwas tatsächlich Vorhandenes sehen will.
Was unter Augenzeugenberichten zu verstehen ist, ist damit eine Frage der Festlegung.[29] Jeder Teilnehmer einer Erinnerungssituation, also Erzähler wie Zuhörer, blickt von einer anderen sozialen und temporalen Stelle auf die vergangene Zeit von sich und dem anderen und entwickelt somit zwangsläufig eine eigene Sicht ebendieser Vergangenheit. „Wie und an was man sich erinnert, wird dadurch bestimmt, wer man ist und was man bereits weiß.“[30] Die Gegenwart des Zuhörers ist für die Erzählung dabei immer auch konstitutiv, denn es gibt immer eine Art Existenzunterstellung des Zuhörers. Dieser muss, um dem Gesagten folgen zu können, von der Authentizität der berichteten Worte ausgehen und kann erst durch nachdenken die Erzählung anzweifeln.[31]
Lücken und Leerräume in der Erzählung sind für die aktive Aneignung durch den Zuhörer kein Übel, sondern eine Notwendigkeit. Zwar wird durch die Auffüllung die Geschichte verändert, sie wandelt sich aber erst dadurch zu einer dem Zuhörer nacherzählbaren Geschichte. Aufgefüllt wird vor allem mit Versatzstücken aus Filmen, Romanen und Erzählungen Anderer und somit werden diese Füllungen zu einem festen Bestandteil des sozialen Bildgedächtnisses. In einem permanenten Prozess der Umschreibung werden die unterschiedlichsten narrativen und medial vorgegebenen Teilstücke zusammen montiert und in Beziehung zu den unterschiedlichsten historischen und subjektiven Punkten gesetzt.
Zur Geschichte zählen somit nicht nur die Vorfälle und Ereignisse selbst, sondern auch die immer wieder stattfindende Konstruktion des Vergangenen. Geschichte ist demnach ein Prozess, „in dem es keine sinnvolle Trennung zwischen Akteuren und Beobachtern gibt, weil die Beobachtung den Prozeß beeinflußt, selbst Teil des Prozesses wird. Und so scheint mir, daß es weder die Außenperspektive noch den idealen Beobachter geben kann, die beide erforderlich wären, um so etwas wie die eigentliche, die wahre, die tatsächliche Geschichte zu rekonstruieren. Wenn dem so sein sollte, dann können wir im Prinzip nicht wissen, welcher der möglichen Rekonstruktionsversuche der vermuteten ‚wahren‘ Geschichte am nächsten kommt. Und so wird jeweils in die Geschichte als Tatsache eingehen, was die Mehrheit derer, die sich gegenseitig Kompetenz zuschreiben, für das Zutreffende halten. Unbeantwortbar bleibt dabei, wie nahe diese Feststellungen der idealen Beschreibung kommen, weil es diese aus unserer Perspektive nicht geben kann.“[32].
All das Wissen um die unauflösbaren Filterungsprozesse während der Wahrnehmung und Erinnerung und um die konfigurierende Erzählsituation verleitet förmlich dazu, alle Erinnerung als gegenwartsabhängige Konstruktion anzusehen. Was mich davon jedoch abhält, sind die Kenntnisse von seit langem etablierten und funktionierenden Erinnerungspraktiken inmitten unserer Gesellschaft, z.B. Zeugenaussagen oder therapeutische Ansätze. Die soziale Wirklichkeit sieht anders aus, als der wissenschaftstheoretische Ansatz des Radikalen Konstruktivismus’[33] es vermitteln will, denn im tagtäglichen Umgang „wird eine Wahrheit, aufgrund derer gehandelt werden kann, durch Mehrfachüberlieferung und innere Evidenz konstituiert.“[34]
Natürlich ist es nicht möglich, bei noch allen folgenden Beobachtungen und Wertungen ständig die eben geschilderten neurobiologischen Erkenntnisse und meine perspektivische Deutung zu verbalisieren. Wozu ich aber in der Lage bin, ist, mich um die Reflektion meines eigenen Einflusses und der jeweiligen Gesprächssituation und um die methodische Nachvollziehbarkeit zu bemühen. Weil es keine vom Beobachter unabhängige Geschichtsschreibung gibt, kann ich auch nur meine Sichtweise, meine Interpretation auf das Vergangene darstellen und für genau diese Interpretation versuchen, so viel wie möglich Zustimmung zu erhalten. Weil historische Wahrheit immer subjektiv ist, obliegt es mir, daraus eine intersubjektive Sicht zu gestalten und das, indem ich meine Deutungen so nachvollziehbar wie möglich darlege.
Wie bereits geschildert richtet sich mein Erkenntnisinteresse jedoch nicht auf den Wahrheitsgehalt oder gar der Authentizität der biographischen Erzählung im Sinne einer beweisbaren Faktenlage. Ich bin daran interessiert zu erfahren, welche subjektiven Deutungsmuster die am Wendeprozess beteiligten Jugendlichen in sich tragen und ob und wie diese in der Gegenwart wirkungsmächtig, also handlungsleitend geworden sind.
Das Aufdecken von Erleben und daraus resultierendem Verhalten in der Gegenwart und damit möglichen zukünftigen Änderungsoptionen verweist in eine der Daseinsbegründungen von Geschichte. Die Erkenntnisse über die Vergangenheit nutzbar für die Zukunft machen, nicht Geschichte um der Geschichte willen.
In diesem Sinne sind die Ergebnisse von Harald Welzer, Sabine Moller und Karoline Tschuggnall in ihrer Untersuchung über den Prozess der Tradierung von Vergangenheit[35], nämlich dass „die emotionale Dimension der Vermittlung und der bildhaften Vorstellung viel entscheidender als das kognitive repräsentierte Wissen“ sei, zwar interessant, aber für meine Erkenntnissinteresse nicht weiter relevant. Nicht die mögliche oder unmögliche Authentizität des Lebensberichts motiviert weitere Handlungen des Biographen (außerhalb von schweren Verdrängungen), sondern sein subjektives Empfinden, seine perspektivische Sicht konstituiert seine persönliche Sichtweise und damit sein Eingreifen in der Gegenwart.[36]
Auf meiner Suche nach den Deutungen der Biographen, was mit ihnen aus ihrer Perspektive heraus geschah und was sie daraus gemacht haben, also auf der Suche nach der Bedeutung von Geschichte in der Geschichte, habe ich mich eines qualitativen Verfahrens, welches im Teilprojekt A5 des SFB 580 unter der Leitung von Lutz Niethammer favorisiert wird und in deren Kontext diese Arbeit entstanden ist, bedient. „Weil die theoriegeleiteten Standardisierungen der Nachfrage nicht mehr näher an die Wirklichkeit heranzuführen schienen, haben wir uns – um den Preis der reduktiven Beweisbarkeit – offenen Nachfragen bei Akteuren und Erfahrungsträgern geöffnet.“[37] In diesem Forschungsprojekt ist man der Ansicht, und dem schließe ich mich an, dass man mit Hilfe von biographischen Großerzählungen noch am ehesten etwas über zurückliegende Erfahrungen und handlungsleitende Motivationen erfahren kann. Die von uns angewandte Methode der Interviewerhebung und damit des analytischen Zugangs werde ich im Folgenden nun erläutern.
3. Methodisches
Die Auswahl meiner Interviewpartner folgte per Schneeballsystem. Über MitstudentInnen erfuhr ich mögliche InformantInnen und von diesen bekam ich wiederum weitere mögliche InteressentInnen mitgeteilt, usw. Dem Zufall geschuldet ergab es sich, dass unter den Befragten in einem ausgewogenen Maß ebenjene Vertreter der von mir beabsichtigten Kontrollgruppen zu finden waren.
Insgesamt erhob ich von April bis Dezember des Jahres 2003 sechzehn lebensgeschichtliche Interviews. Nach längerer Überlegung habe ich mich dazu entschieden, eines der bereits geführten und protokollierten Interviews nicht für den weiteren Analyseprozess zu verwenden. Es war das einzige Mal, dass ich das Gefühl hatte, der Interviewte möchte im Grunde genommen nicht über sich, sein Leben und seine Einstellungen erzählen, oder zumindest nicht in der Tiefe, wie es die Qualität der Fragen stimulierten. Es geht hier auch nicht um Widersprüchlichkeiten in den einzelnen Aussagen, denn die finden sich bei detaillierter Betrachtung bei nahezu allen Biographen. Ich kann das nicht anders als mit meinem Gefühl erklären, denn natürlich bin ich nicht daran interessiert, die nicht erzählten Dinge dem Interviewer nachzuweisen und mich somit in eine sinnlose Nachforscherei zu stürzen. Kurz: ich habe fünfzehn Interviews für die weitere Analyse verwendet. Doch nun zum 3-Phasen Modell für die Erhebung der Interviews.[38]
Inspiriert durch die von Fritz Schütze[39] gemachten Anleitungen für die Erstellung eines narrativen Interviews sieht die erste Phase vor, dass die Interviewten ihre Lebensgeschichte offen und frei erzählen, dabei ihre Schwerpunkte selbst setzen und durch den Interviewer Bestätigung für das Erzählte erhalten. Es geht also darum, sich mit dem Lebensverlauf des Befragten bekannt zu machen und durch das Signalisieren eines grundlegenden Verständnisses Nähe und Vertrauen zu schaffen. In aller Regel erhält man dadurch die Lebensgeschichte eines Menschen, so wie er sich selbst sehen möchte und wie er hofft, möglichst großer Akzeptanz seitens des Befragenden zu erhalten.[40]
Das bedeutet jedoch nicht, dass das in der ersten Phase Erzählte weniger interessant ist oder gar bewusst erlogen sein muss, im Gegenteil. Interessant ist es deshalb, weil es einen ersten Zugang zum Gedächtnisraum des jeweilig Interviewten öffnet und gegen die Annahme einer bewussten Lüge sprechen wiederum zwei Dinge.
Zum einen sagt auch eine bewusste Lüge etwas über den Befragten, insbesondere über seinen Umgang mit Vergangenheit und seine gewünschte Positionierung in der Gegenwart aus. Wenn die Lebenslüge des Befragten nicht pathologischen Umständen geschuldet ist, wird der Befragte aller Wahrscheinlichkeit nach im Verlauf des weiteren Interviews sein „Lügengebäude“ nur mit allergrößter Mühe und einem hohen Maß an detaillierter Vorbereitung aufrecht erhalten können( siehe hierzu die weiteren Phasen des Modells).
Und zum anderen wurden alle Interviews durch die Befragten freiwillig gegeben. Einige der möglichen Informanten entschieden sich aus den unterschiedlichsten Gründen dafür, kein Interview zu geben. Somit habe ich es bei meinen Interviews also mit Menschen zu tun gehabt, die auf freiwilliger Basis und lediglich mit der Aussicht auf einen geduldigen Zuhörer dazu bereit waren, mehrstündige Selbstauskünfte zu erteilen. Wer sich für seine Lebensgeschichte schämt oder wer etwas zu verbergen hat und damit bewusst lügen müsste oder wer einfach nur keine Lust hat, sich anderen mitzuteilen, der lässt sich nicht stundenlang freiwillig befragen. Und wenn es diejenigen tun, die sich eben nicht schämen und die nichts oder zumindest nur wenig zu verbergen haben und die Lust haben, über sich zu erzählen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dem Interviewer eine bewusste Lebenslüge zu erzählen. Das Prinzip der Freiwilligkeit bei den Interviews ist also der wichtigste und der einzige Hinweis darauf, die tatsächlichen Empfindungen und Erlebnisse des Anderen annähernd mitgeteilt zu bekommen.
Die zweite Phase des Modells dient nun dazu, die im bisher erfassten selbstbestimmten Monolog des Biographen vorhandenen Leerstellen im Sinngehalt zu füllen. Dabei geht es einerseits um die Klärung bisheriger Widersprüchlichkeiten und offener Punkte und andererseits darum, die vom Erzähler bisher favorisierte Erinnerungsspur gezielt zu wechseln und damit die öffentlich bewährten Interpretationsmuster der Geschichte des Biographen zumindest partiell zu überwinden. Das Nichterzählte, das Verschwiegene interessiert an dieser Stelle, denn es ist wahrscheinlich, dass die Hebung dessen weitere soziale Einbettungen zu Tage fördert.
[...]
[1] Vgl. hierzu exemplarisch Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.): Jugend’92. Lebenslagen, Orientierungen und Entwicklungen im vereinigten Deutschland, 3 Bde., Opladen 1992, u. vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.): Jugend’97. Zukunftsperspektiven, gesellschaftliches Engagement, politische Orientierungen, Opladen 1997, u. vgl. Deutsche Shell (Hrsg.): Jugend 2000, Opladen 2000, u. vgl. Deutsche Shell (Hrsg.): Jugend 2002. Zwischen pragmatischem Idealismus und robustem Materialismus, Frankfurt a.M. 2002. In einer Untersuchung mit Schuljugendlichen aus dem Jahr 1992 wurden kaum Hinweise auf gesellschaftliche Akzeptanzprobleme festgestellt, vgl. Stock, Manfred: Schüler erfahren die Wende. Schuljugendliche im gesellschaftlichen Transformationsprozess. Weinheim 1992. Dagegen wurde in einer 1994 vorgelegten Studie, bei der 70 narrative Interviews von 20-30jährigen Ostdeutschen ausgewertet wurden, eine weitverbreitete Krisenstimmung festgestellt, vgl. Wensierski von, Hans-Jürgen: Mit uns zieht die alte Zeit. Biographie und Lebenswelt junger DDR-Bürger im gesellschaftlichen Umbruch, Opladen 1994.
[2] Im Folgenden werde ich diesen historisch unpräzisen Begriff unkritisch verwenden, auch weil er durch alle von mir Interviewten zur Bezeichnung dieses Zeitraums verwendet wurde.
[3] „1989 fand der Aufstand der Träumer und Romantiker statt. Mehr Utopie als in den turbulenten Wendemonaten kann man sich kaum vorstellen.“, aus: Wolle, Stefan: Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989, Berlin 1998, S. 335.
[4] Vgl. Stuckrad-Barre, Benjamin von: Soloalbum. Roman, Köln 1998.
[5] Vgl. Illies, Florian: Generation Golf. Eine Inspektion, Frankfurt a.M. 2001. Als weibliches Gegenstück zum Entwurf von Illies, aber die eigene Generation als ebenso unpolitisch und an Äußerlichkeiten orientiert beschreibt, vgl. Kullmann, Katja: Generation Ally, Frankfurt a.M. 2002.
[6] Volker Weidermann: Glückskinder der späten Geburt. Jana Hensels biographischer Essay „Zonenkinder“ erzählt von der Generation Golf des Ostens, in: FAZ, 8.9.2002, Nr. 36, S. 22.
[7] Vgl. Mannheim, Karl: Das Problem der Generationen, in: Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk, eingel. u. hrsg. v. Kurt H. Wolff, Berlin 1964, S. 509-565.
[8] Seit Mitte der 1990er spricht man von der sogenannten Popliteratur, die oft mit vielfachen Erinnerungsversuchen über die Sozialisation der Autoren durchsetzt ist. Vgl. hierzu Jung, Thomas (Hrsg.): Alles nur Pop? Anmerkungen zur populären und Pop-Literatur seit 1990, Frankfurt a.M. u.a. 2002 (= Osloer Beiträge zur Germanistik, Bd. 32). Zu den ostdeutschen Spezifika der jungen Literaturszene vgl. Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.): DDR-Literatur der neunziger Jahre, München 2000 (= Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur, Sonderband), u vgl. Koch, Roland (Hrsg.): Der wilde Osten. Neueste deutsche Literatur, 2.Aufl., Frankfurt a.M. 2003. Zur literaturkritischen Sicht aus westdeutscher Perspektive vgl. Radisch, Iris: Klassenkampf Ost. André Kubiczek und die Neuauflage der engagierten DDR-Literatur als Farce, in: DIE ZEIT, Nr. 13/2003, Sonderbeilage Literatur und Musik, S.3. Aber auch außerhalb der Literatur bricht sich dieses Bedürfnis nach Mitteilung der eigenen Geschichte Bahn. Vgl. Mühlberg, Felix / Schmidt, Annegret (Hrsg.): Zonentalk. DDR-Alltagsgeschichten aus dem Internet, Wien / Köln / Weimar 2001, u. dazu vgl. http://www.zonentalk.de, u. vgl. http://www.wiedervereinigung.de.
[9] Vgl. Simon, Jana: Denn wir sind anders. Die Geschichte des Felix S., Berlin 2002.
[10] Vgl. Hensel, Jana: Zonenkinder, Reinbek 2002. Besonders dieses Buch erregte neben dem großen Verkaufserfolg vor allem durch eine polarisierte Leserschaft großes Aufsehen. Exemplarisch für den Umgang der Printmedien mit diesem Werk vgl. Geer, Sandra: DDR-Safari. Jana Hensel schwärmt vom braven Osten, in: DIE ZEIT, Nr. 51/2002, S. 36, u. vgl. KREUZER Medien GmbH (Hrsg.): Wer sind die Zonenkinder? Titelthema, in: KREUZER Spezial Buchmesse 2003, Leipzig März 2003, S. 6-10, u. vgl. Thieme, Manuela: Adieu Pittiplatsch, in: DAS MAGAZIN, September 2002, S. 14-18, u. vgl. Weidermann (wie Anm. 6).
[11] Vgl. Schoch, Julia: Der Körper des Salamanders. Erzählungen, München 2001. In fast allen der zehn Kurzgeschichten finden ihre Helden und Heldinnen in ihrem Suchen nach dem Glück und dem Sinn immer wieder zu ihrer eigenen Vergangenheit im Osten.
[12] Vgl. Zöllner, Abini: Schokoladenkind. Meine Familie und andere Wunder, Reinbek b. Hamburg 2003.
[13] Vgl. Simon, Jana / Rothe, Frank / Andrasch, Wiethe (Hrsg.): Das Buch der Unterschiede. Warum die Einheit keine ist, Berlin 2000.
[14] „In diesen Tagen verlor ich meinen Glauben an jedes System und schwor mir, nie wieder in meinem Leben ein System ernst zu nehmen, nie wieder die Autoritäten eines Systems zu akzeptieren und nie wieder ‚ja‘ zu sagen, wenn ich es nicht auch wirklich meine. ... Nie wieder würde ich etwas für ein System tun. Das wußte ich. Ich würde nur noch an mich selbst glauben und an mein ganz persönliches privates Leben.“, aus: Rothe, Frank: Der Dinosaurier im Bernstein. Ich, das Überbleibsel aus einer implodierten Galaxis, in: Ebenda, S. 60f.
[15] „Diese beiden Erlebnisse [erster offener verbaler Widerstand in der Schule gegen schönfärberische Auslegung der Flüchtlingsbewegung über Ungarn und Teilnahme an den Donnerstagsdemonstrationen auf dem Erfurter Domplatz, M.K .] haben mein politisches Bild und das der meisten Menschen der ehemaligen DDR geprägt. Demokratie ist für mich erkämpft worden.“, aus: Schneider, Carsten: Morgenrot. Wann ein Juso aus dem Zimmer fliegt, in: Ebenda, S. 166f.
[16] Der Film Good bye, Lenin! war in den letzten Monaten der mit Abstand erfolgreichste deutsche Film, laut Angaben von mediacontrol wurden nach neun Wochen Spielzeit des Films ca. fünf Millionen Besucher gezählt, vgl. www.kino.de.
[17] „ Es ist auch nicht allein die Komik, die nie auf Kosten der Figuren geht, schon eher das kleine anarchische Intermezzo zwischen den Systemen samt der symbolischen Vereinigung von Rom, wo die Mannschaft der Bundesrepublik für ganz Deutschland im Sommer 1990 Fußballweltmeister wurde.“, aus: Körte, Peter: Der Erfolg von „Good bye, Lenin!“. Auferstehung aus Ruinen, in: FAZ, 20.2.2003, Nr. 43, S. 37.
[18] Vgl. Zimbardo, Philip G.: Psychologie, 6. neu bearbeitete u. erweiterte Aufl., Berlin / Heidelberg / New York 1995, hier v.a.: S.80-97.
[19] Zum detaillierten Umgang mit der Frage der politischen Sozialisation vgl. Claußen, Bernhard / Geißler, Rainer (Hrsg.): Die Politisierung des Menschen. Instanzen der politischen Sozialisation. Ein Handbuch, Opladen 1996.
[20] Mir ist bewusst, dass in soziologischen Zusammenhängen die Milieus der DDR wesentlich differenzierter behandelt werden. Dies kann hier jedoch nicht berücksichtigt werden und ist für den Fortgang der Analyse auch nicht notwendig.
[21] Vgl. Zimbardo (wie Anm. 18).
[22] Hobi, Viktor: Kurze Einführung in die Grundlagen der Gedächtnispsychologie, in: Vergangenheit in mündlicher Überlieferung, hrsg. v. Jürgen von Ungern-Sternberg / Hansjörg Reinan, Stuttgart 1988 (= Colloquium Rauricum, Bd. 1), S. 12.
[23] Die Struktur der Engramme ist nur bedingt geeignet, um einmal Abgespeichertes in Sätze rationaler Sprache umzusetzen. Da diese immer aber immer in einem Kontext eingebunden sind, sind Prosodie, Gestik, Mimik, äußere Umstände der Erzählung wichtige Indikatoren zur Analyse des Erinnerten, vorausgesetzt man fragt nach Authentizität.
[24] Nach derzeitigem Wissensstand der Hirnforschung geht einmal Gespeichertes im nichtpathologischen Fall nicht verloren und die eben angesprochene Assoziativspeicherung in den Engrammen sorgt für eine mögliche und immer wiederkehrende Erinnerung bei entsprechenden Stimulationen. Diese Annahme bildet den grundlegenden Ansatz innerhalb der Psychoanalyse.
[25] Welzer, Harald / Moller, Sabine / Tschuggnall, Karoline: „Opa war kein Nazi“. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Frankfurt a.M. 2002, S. 202.
[26] Singer, Wolf: Wahrnehmen, Erinnern, Vergessen. Über Nutzen und Vorteil der Hirnforschung für die Geschichtswissenschaft. Eröffnungsvortrag des 43. Deutschen Historikertags, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.9.2000, Nr. 226, S. 10.
[27] Die ständigen Neueinschreibungen, vor allem bei ähnlichen Inhalten, tragen strukturell jedoch den Nachteil in sich, dass das Engramm im ursprünglichen Kontext überhaupt nicht mehr aktivierbar ist.
[28] Singer (wie Anm. 26), S.10.
[29] Es gibt keine authentischen Zeitzeugenaussagen, da solche immer standortgebunden und perspektivisch sind, vgl. hierzu auch Breckner, Roswitha: Von den Zeitzeugen zu den Biographen. Methoden der Erhebung und Auswertung lebensgeschichtlicher Interviews, in: Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte. Zur Theorie und Praxis von Alltagsgeschichte, hrsg. v. d. Berliner Geschichtswerkstatt, Red. Heike Diekwich u.a., Münster 1994, S. 202f.
[30] Zimbardo (wie Anm. 18), S. 335f.
[31] Welzer / Moller / Tschuggnall (wie Anm. 25), S. 196f.
[32] Singer (wie Anm. 26), S. 10.
[33] Zu den Positionen dieser Vertreter im allgemeinen vgl. Siegfried J. Schmidt (Hrsg.): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt a.M. 1987, u. Bd. 2: Kognition und Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1992, und im speziellen zur Darlegung des Diskurses zwischen einem Kritischen Realismus, der meint, dass die Sinnesorgane die Welt durch ihre evolutionäre Bewährung so abbilden, wie sie ist, und dem Radikalen Konstruktivismus, der sagt, das Gehirn ist ausschließlich ein selbstreferentielles und selbst-explikatives System, aber eben nicht isoliert von der Umwelt, vgl. Roth, Gerhard: Erkenntnis und Realität. Das reale Gehirn und seine Wirklichkeit, in: Ebenda, Frankfurt a.M. 1987, S. 229-255.
[34] Niethammer, Lutz: Was unterscheidet Oral History von anderen interview-gestützten sozialwissenschaftlichen Erhebungs- und Interpretationsverfahren?, in: Mitteilungen des SFB 580, Nr. 6/2003, S. 34f.
[35] Welzer / Moller / Tschuggnall (wie Anm. 25). Zum Versuch, dies in eine Theorie zu fassen, vgl. Welzer, Harald: Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung, München 2002, u. zur Stellung des autobiographischen Gedächtnisses gegenüber anderen Gedächtnisformen vgl. Welzer, Harald: Was ist das autobiographische Gedächtnis, und wie entsteht es?, in: BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufanalysen, 15.Jahrgang, Heft 2/2002, S. 169-186.
[36] Mit dem Charakter der Erinnerung als Konstrukt beschäftigte sich jüngst auch die Wochenzeitung DIE ZEIT, vgl. Sentker, Andreas: Montierte Geschichte. Erinnerung ist ein Konstrukt, in: DIE ZEIT, Nr. 52 v. 17.12.2003, S. 51, u. vgl. das ZEIT-Forum der Wissenschaft „Gedächtnis und Erinnerung“, 30/2003, in: www.zeit.de/wissen/foren/erinnerung v. 10.1.04.
[37] Niethammer (wie Anm. 34), S. 34.
[38] Vgl. Niethammer, Lutz: Fragen – Antworten – Fragen. Methodische Erfahrungen und Erwägungen zur Oral History. In: Niethammer, Lutz / Alexander von Plato (Hrsg.): „Wir kriegen jetzt andere Zeiten“. Auf der Suche nach der Erfahrung des Volkes in nachfaschistischen Ländern (=Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930-1960, Bd. 3). Berlin/Bonn 1985, S. 392-445.
[39] Zu den fruchtbaren Zwängen der Detaillierung und der Nachvollziehbarkeit für den Befragten innerhalb einer Erzählung vgl. Schütze, Fritz: Die Technik des narrativen Interviews in Interaktionsfeldstudien. Dargestellt an einem Projekt zur Erforschung von kommunalen Machtstrukturen, Bielefeld 1977. Kritikwürdig ist dagegen seine Ansicht, dass durch den sich in einer Erzählsituation befindenden Biographen eher die damaligen Momente und Handlungen deutlich werden und weniger die jetzigen. Dies widerspricht den von mir eingangs gemachten Beobachtungen über die konstruktiven Elemente während der Erinnerung, vgl. dazu auch Rosenthal, Gabriele: „... wenn alles in Scherben fällt...“. Von Leben und Sinnwelt der Kriegsgeneration, Opladen 1987 (= Biographie und Gesellschaft, hrsg. v. Werner Fuchs, Martin Kohli, Fritz Schütze, Bd. 6), S. 115ff.
[40] Zum Phänomen der Gesellschaftlichkeit von Biographien als einem sozialen Konstrukt vgl. Wierling, Dorothee: Geboren im Jahr Eins. Der Jahrgang 1949 in der DDR. Versuch einer Kollektivbiographie, Berlin 2002 (= Forschungen zur DDR-Gesellschaft), S. 7-23.
Details
- Titel
- Euphorie, Engagement und Enttäuschung oder Der Kurze Sommer der Anarchie
- Untertitel
- Über die Nachwirkung der Wendeerfahrung in den Biographien junger Ostdeutscher
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2004
- Seiten
- 91
- Katalognummer
- V227399
- ISBN (eBook)
- 9783836638876
- Dateigröße
- 531 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- wende oral history nachwendebiographien jugendliche
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2004, Euphorie, Engagement und Enttäuschung oder Der Kurze Sommer der Anarchie, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/227399

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.


