Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos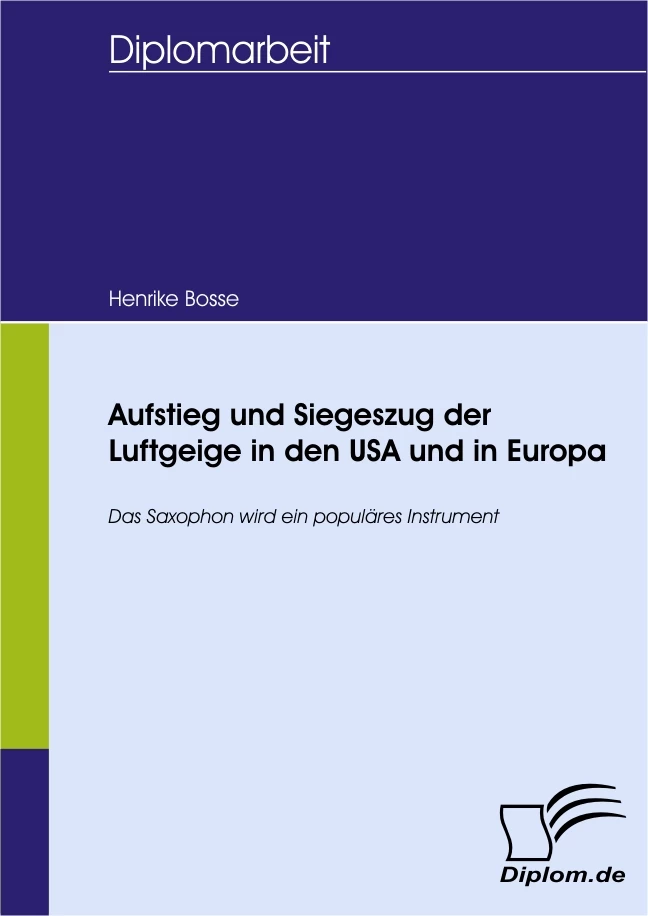
Aufstieg und Siegeszug der Luftgeige in den USA und in Europa
Diplomarbeit, 2003, 69 Seiten
Autor

Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Hochschule für Musik und Theater Hannover (Musikwissenschaft)
Note
1,0
Leseprobe
Inhalt
0. Einleitung
1. Das Saxophon: eine europäische Erfindung...!
1.1. Gründe und Voraussetzungen für das neues Instrument
1.1.1. Ursprüngliche Probleme
1.1.2. Versuche der Problemlösung - Vorläufer des Saxophons ?
1.2. Entwicklung des Saxophons - ein neues Instrument entsteht
1.3. Biographische Erläuterungen zu Adolphe Sax
1.4. Adolphe Sax als Verfechter seiner wichtigsten Erfindung
1.5. Kampf gegen Kritiker, Neider und Konkurrenten
1.6. Das Saxophon in der Militärmusik
1.6.1. Einführung in die französischen Militärkapellen
1.6.2. Ausbreitung innerhalb der Militärmusik
1.6.3. „Sondersituation“ in Deutschland
2. Der Jazz: Die Chance für das Saxophon
2.1. Wie kam das Saxophon in die USA?
2.2. Geschichte des Saxophons – Geschichte des Jazz
2.2.1. New Orleans
2.3. Der Aufstieg des Saxophons nimmt seinen Lauf
2.3.1. Chicago: Der Weg zum eigenständigen Instrument
2.3.2. Swing und Tanzmusik: Basis für weltweite Popularität
2.4. Wegweisender Einfluss von Saxophonisten auf den Jazz
2.4.1. Charlie Parker
2.4.2. Lester Young
2.4.3. Ornette Coleman
3. Ausbreitung (auch) in Europa und der ganzen Welt
3.1. Zur Situation Anfang des 20. Jhs.
3.1.1. Allgemeine Skizzierung
3.1.2. Europäische Pioniere des Saxophons
3.2. Das Jazz-Saxophon kommt nach Europa
3.2.1. Gastspiele amerikanischer Saxophonisten in Europa
3.2.2. Zur Rolle der Medien
3.2.3. Das „Schicksal“ des Saxophons im Nationalsozialismus
3.3. Mehr Aufmerksamkeit durch Komponisten der E-Musik
4. Schlusswort
Anhang: Literatur- und Quellenverzeichnis
0. Einleitung
Die Idee zur vorliegenden Arbeit entstand aus einem seit längerer Zeit bestehenden persönlichen Interesse für Saxophonmusik und dem daraus gewonnenen Eindruck, dass das Saxophon sich im heutigen Musikleben zwar einer großen Beliebtheit erfreut, doch eigentlich immer noch für ein ursprüngliches und ausschließliches Jazz-Instrument gehalten wird; dadurch ist es in der musikhistorischen Wahrnehmung oft erst seit den 1920er Jahren präsent.
Nicht selten wird übersehen, dass das Saxophon bereits wesentlich früher, nämlich Mitte des 19. Jhs., entwickelt wurde und nicht etwa aus den USA, sondern aus Frankreich stammt! Somit ist das Instrument inzwischen zwar im Jazz-Rock-Pop-Unterrichtsangebot (fast) jeder Musikschule zu finden, und auch die Ausbildung professioneller Saxophonisten erhält einen zunehmenden Stellenwert, doch ist die Entwicklung des Saxophons in der sogenannten E-Musik noch längst nicht so weit vorangeschritten wie im Jazz: Nach wie vor gibt es – was sicherlich auch mit einem Mangel an entsprechender Original-Literatur zusammenhängt – keine Festanstellungen für Saxophonisten in professionellen Orchestern; die Bekanntheit von zeitgenössischen Werken und Interpreten schreitet zwar voran, hält sich aber noch in deutlichen Grenzen. Auch die Anzahl von musikwissenschaftlichen Publikationen ist zumindest im deutschsprachigen Raum bisher noch recht „überschaubar“; so hat es beispielsweise seit der Patentierung des Saxophons 1846 über 130 Jahre gedauert, bis 1979 eine erste umfassende Monographie für das Instrument von K. Vetzke, C. Raumberger und D. Hilkenbach veröffentlicht wurde (siehe Literaturverzeichnis).
Deshalb werden im Folgenden zunächst die Ursachen für die Entwicklung des Saxophons, die bis ins 18. Jh. zurückreichen, untersucht, um auf deren Grundlage die Absichten zu erläutern, die der Instrumentenbauer Adolphe Sax mit seiner Erfindung verbunden hat: Er wollte vor allem eine Lösung für die unbefriedigende Situation entwickeln, die Anfang des 19. Jhs in der Freiluftmusik durch die ungeeigneten Klangeigenschaften von Streich- und Holzblasinstrumenten entstanden war. Daraus erklärt sich auch die Bezeichnung „Luftgeige“ für das Saxophon: Es wurde in seiner Anfangszeit in der Freiluftmusik u.a. anstatt der Violinen eingesetzt. Gleichzeitig hatte Sax aber auch das Ziel, ein Instrument zu konstruieren, das klanglich sowohl zwischen Blech- und Holzblasinstrumenten als auch zwischen Blas- und Streichinstrumenten eine vermittelnde Rolle einnehmen konnte. Darüber hinaus zeichnet sich das Saxophon auch dadurch aus, dass sein Klang sowohl durchdringend als auch reduzierbar sein kann, wodurch es für das Musizieren im Freien und in geschlossenen Räumen gleichermaßen verwendet werden kann.
Im weiteren Verlauf der folgenden Ausführungen werden die Einführung des Saxophons in die Militärmusik (als Teilbereich der Freiluftmusik) in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. und die damit beginnende Verbreitung des Instruments nachgezeichnet. Damit lässt sich allerdings noch nicht ausreichend jener Weg erklären, den das damals in Europa unbekannte Saxophon zurückgelegt haben muss, um durch die Entwicklung des Jazz in den USA zum populären Instrument aufsteigen zu können. Daher werden am Beginn des zweiten Teils zu dieser Frage verschiedene Überlegungen angestellt, durch welche Prozesse das Saxophon Ende des 19. und Anfang des 20. Jhs. in die USA gelangt sein könnte.
Für die Erläuterungen zum „Aufstieg und Siegeszug“ des Saxophons in den USA bietet es sich an, eine Verbindung zur etwa zeitgleich beginnenden Geschichte des afroamerikanischen Jazz herzustellen, um so die nachhaltigen Einflüsse, die diese beiden Phänomene aufeinander ausübten, verdeutlichen zu können. Diese werden auf der Grundlage eines grobstrukturierten chronologischen Ablaufs der Jazzgeschichte dargestellt: Zunächst ermöglichte der Jazz eine zunehmende Bekanntheit des Saxophons, bevor dieses als nun populäres Instrument seinerseits das Entstehen zukünftiger Jazz-Stile wesentlich beeinflusste. Deshalb sind die einzelnen Textabschnitte vom New Orleans Jazz bis zum Swing nach den jeweilgen „Epochen“ benannt, während für Bebop, Cool Jazz und Free Jazz das Schaffen einzelner Saxophonisten, welches richtungsweisend für diese Stilrichtungen war, dargestellt wird. Aufgrund der engen Verbundenheit des Saxophons mit dem Jazz ist es dabei jedoch nicht sinnvoll, sich ausschließlich auf die speziell das Saxophon betreffenden Aspekte zu beschränken; vielmehr war es notwendig, auch den Gesamtzusammenhang innerhalb der Jazz-Entwicklung zu betrachten.
Schließlich wird im letzten Abschnitt noch einmal die Situation in Europa betrachtet. In seiner eigentlichen „Heimat“ kam das Saxophon trotz des engagierten Einsatzes einzelner „Pioniere“ erst zu einer größeren Bekanntheit, nachdem sich der Jazz unter anderem durch Gastspiele afroamerikanischer Saxophonisten und die technische Entwicklung von Medien wie Schallplatte, Radio und Film auch hier verbreitet hatte. Seit ca. 1920 führte diese Entwicklung des Jazz in Europa dazu, dass auch die Komponisten der E-Musik sich stärker für das Saxophon interessierten und das „exotische Jazz-Instrument“ als Inspiration und Bereicherung für ihre Werke annahmen.
1. Das Saxophon: eine europäische Erfindung...!
1.1. Gründe und Voraussetzungen für das neue Instrument
1.1.1. Ursprüngliche Probleme
Jede neue Erfindung entsteht aus einem Problem heraus, dass mit bereits vorhandenen Mitteln nicht bewältigt werden kann und daher eine Innovation erforderlich macht.
Dies gilt auch für den Instrumentenbauer Adolphe Sax und die Entstehung seines Saxophons.
Um die Ursachen für die Entstehung darzustellen, muss man in die Zeit der Französischen Revolution zurückblicken, denn hier begann eine Entwicklung der Blasmusik, die sich vor allem als Folge der gesellschaftlichen Umwälzungen jener Zeit vollzog. Durch ein erstarktes Nationalbewusstsein wünschte sich das Publikum zunehmend entsprechende Gattungen wie Hymnen, Oden, Märsche und patriotische Lieder. In diesem Zusammenhang wurden auch Hof und Kirche als traditionelle Aufführungsorte verdrängt und durch große Plätze, Stadien oder andere Orte, die große Menschenmassen fassen konnten, ersetzt. Diese Konzerte als Massenveranstaltungen dienten nicht mehr allein dem Vergnügen; sie (und damit auch die Blasmusik) erhielten eine massenpsychologische Funktion und wurden zum politischen Instrument.[1]
Auf die Besetzungen der Ensembles hatte das weit reichende Auswirkungen. Das bisher übliche Bläseroktett[2] erwies sich für die Freiluftmusik schnell als ungeeignet. Eine Verbesserung erhoffte man sich zunächst von Mehrfachbesetzungen jeder einzelnen Stimme, wodurch die Lautstärke insgesamt gesteigert werden sollte. Doch diese „Vervielfältigungen“ brachten eher neue Schwierigkeiten mit sich, als dass sie die bestehenden beseitigen konnten.
Dazu gehörten z. B. Intonationsprobleme; sie waren zwar vorher auch schon vorhanden, doch wurden sie jetzt deutlich gravierender. Das lag einerseits daran, dass die Größe der Ensembles stark angewachsen war, und andererseits daran, dass die Instrumente von vielen verschiedenen Instrumentenbauern gebaut worden waren und damit in der Masse nur schwer zu einer klanglichen und intonatorischen Einheit zusammenfanden. Ein anderes Problem war das der Klangbalance zwischen den Instrumentengruppen: Holz- und Blechbläser gerieten zahlenmäßig ins Ungleichgewicht. Nicht selten entstanden Gruppen aus z.B. 14 Klarinetten, mit denen man den durchdringenden Klang der Blechbläser auszugleichen versuchte. Verhältnismäßig leise Instrumente wie Oboe und Fagott waren in der Freiluftmusik gänzlich unbrauchbar. Zu den Blasinstrumenten kamen eine Reihe von Schlaginstrumenten und – als einzige Streichinstrumente – auch Kontrabässe. Von letzteren wurden bis zu zwölf Instrumente eingesetzt und so wuchsen die Ensembles schnell auf über 50 Musiker an.
Vor allem die Situation des Bassregisters war unbefriedigend. Ein klanglich durchdringendes Blasinstrument, das vom Tonumfang her tief genug und trotzdem noch gut zu spielen gewesen wäre, gab es nicht. Der Serpent, das im 18. Jh. gebräuchliche Bassblasinstrument, hatte einen zu kleinen Tonumfang und war in Modellen, die den notwendigen Tonumfang gehabt hätten, nicht spielbar. Das Fagott wiederum wirkte (vor allem in der Freiluftmusik) klanglich so schwach, dass es allenfalls als Begleitung eingesetzt werden konnte. Die ersatzweise verwendeten Kontrabässe blieben auch in größerer Zahl den Blechbläsern unterlegen und trugen zum klanglichen Ungleichgewicht bei. Grundsätzlich waren Streicher für die Freiluftmusik ohnehin ungeeignet.
Um diesen Notstand zu beheben, wurde nun ein Bassblasinstrument gesucht, das den Tonumfang der Holzbläser hatte und dessen Klang das Durchdringende der Blechbläser mit dem Charakter der Streicher verbinden konnte.[3]
1.1.2. Versuche der Problemlösung - Vorläufer des Saxophons ?
Zahlreiche Instrumentenbauer versuchten in Folge dieser Situation seit Anfang des 19. Jhs. mögliche Lösungen zu erarbeiten. Es entstanden etliche Vorschläge, die sowohl aus Verbesserungen vorhandener Instrumente wie auch aus Neuerfindungen resultierten. Die folgende Auflistung zeigt davon nur einige Beispiele und ist keinesfalls vollständig.
Bereits seit ca. 1870 wurde in England das Basshorn gebaut. Es bestand üblicherweise aus Holz oder Metall und hatte ein langes S-Rohr sowie ein Kesselmundstück. 1804 entwickelte Frichot ein Basshorn. Grundlage dafür waren ein Fagottkorpus mit Fingerlöchern und Klappen, den er mit einem metallischen Schalltrichter kombinierte.
Kurz darauf entwarf 1807 der französische Uhrmacher Desfontelles eine Bassklarinette. Aus dem zum Spieler hin gebogenen Schnabel und dem nach oben zeigenden Schallstück ergab sich im Nachhinein eine erstaunliche äußerliche Ähnlichkeit mit dem Saxophon. Von dieser Bassklarinette wurde jedoch nur ein einziges Exemplar gebaut, und wahrscheinlich wäre es schon bald in Vergessenheit geraten, wenn es nicht in den späteren Patentprozessen zum Saxophon vorgeführt worden wäre; damit sollte bewiesen werden, dass das Prinzip des Saxophons längst existierte.
Um 1820 wurde in Großbritannien das Teneroon[4] entwickelt. Als Grundlage diente ebenfalls ein Fagottkorpus, der allerdings aus Holz gefertigt war und statt eines Doppelrohrblattes mit einem Einfachrohrblatt verbunden wurde. Die verhältnismäßig engen Proportionen des Korpus kamen dadurch zustande, dass das Instrument ursprünglich in der Altlage gebaut werden sollte. Dieser Umstand wirkte sich jedoch nachteilig auf seine Klangeigenschaften aus. Auf wen diese Erfindung zurückgeht, ist nicht ganz eindeutig. In diesem Zusammenhang werden sowohl der schottische Orchesterleiter William Meikle wie auch der Londoner Ingenieur Lazarus[5] genannt.
Die Ophicleïde, die eines der Versuchsobjekte bei der Entwicklung des Saxophons gewesen sein könnte, stellte eine Weiterentwicklung des Serpents durch den Franzosen Jean Asté, genannt Halary, dar. Sie wurde Anfang des 19. Jhs. nach dem Prinzip des Klappenhorns gebaut.
Schließlich stammen zwei Instrumente von W.F. Wieprecht[6] aus Berlin. Er erfand zum einen die „Wieprechtsche Tuba“, die als Weiterentwicklung des Bombardon[7] angesehen werden kann. Zum anderen beschäftigte auch er sich mit der Bassklarinette und entwickelte daraus 1839 das Batyphon, das ebenfalls dem Saxophon äußerlich sehr ähnlich sah.[8]
1.2. Entwicklung des Saxophons - ein neues Instrument entsteht
Zu denjenigen, die sich mit der oben bereits dargestellten Problematik beschäftigten, gehörte auch der belgisch-französische Instrumentenbauer Adolphe Sax. In einer seiner ersten schriftlichen Äußerungen zu diesem Thema, dem Patentantrag für das Saxophon, beschrieb er 1846 die Situation:
„Man weiß, dass die Blasinstrumente im Allgemeinen entweder zu rau oder zu stumpf in ihrem Klang sind, besonders in der Tiefe. (...) Nur Blechblasinstrumente haben einen befriedigenden Effekt in der Freiluftmusik (...) Jeder weiß, daß die Wirkung von Streichinstrumenten bei Freiluftmusik gleich Null ist wegen der Schwäche ihres Klanges. (...) Befremdet von diesen Unzulänglichkeiten habe ich das Mittel zur Abhilfe darin gesucht, ein Instrument zu erschaffen, das im Charakter seiner Stimme den Streichinstrumenten nahekommt, aber mehr Kraft und Intensität besitzt als diese.“[9]
Über die Entwicklungs- und Experimentierphase des Saxophons zwischen ca. 1838 und 1840 ist nur recht wenig bekannt, da Sax keinerlei schriftliche Aufzeichnungen in dieser Zeit angefertigt hat. Aus diesem Grund lässt sich auch für die Fertigstellung des Saxophons kaum ein genauer Zeitpunkt festlegen.
Sax hatte sich, wie viele andere Instrumentenbauer auch, bereits seit seiner Jugend mit Verbesserungen der Bassklarinette beschäftigt. Doch um dort den angestrebten Tonumfang und Klangcharakter zu erzielen, hätte die Luftröhre so lang gebaut werden müssen, dass für den Spieler einige Tonlöcher mit den Fingern nicht mehr erreichbar gewesen wären. Daher ist es wahrscheinlicher, dass Sax für die Entwicklung des Saxophons keine Klarinette, sondern eher eine Ophicleïde als Modell benutzt hat. Diese wurde auch in der Werkstatt seines Vaters hergestellt, sodass Sax einen unmittelbaren Zugang dazu hatte; außerdem gehörte die Ophicleïde trotz ihrer unbefriedigenden Klangeigenschaften[10] zu den am weitesten verbreiteten Bassinstrumenten, da es noch keine besser entwickelten Modelle gab.[11]
Sax entwarf einen neuen Klappenmechanismus, der um einige Tonlöcher erweitert war und die Klappen mit Leder bedeckte, um eine gleich Tonqualität in allen Registern zu gewährleisten. Eine zweite Neuerung war der nach oben zeigende metallische Schalltrichter, wodurch der Tonumfang nach unten um zwei Ganztöne ausgedehnt werden konnte. Dazu kombinierte er ein neu entwickeltes Mundstück[12] mit einem Korpus aus Metall. Die Verwendung eines einfachen Rohrblatts trug dazu bei, dass der Klang teilweise an die Klarinette erinnerte: Der im Vergleich zur Klarinette – vor allem in der Tiefe – deutlich kräftigere Ton kam dagegen durch eine starke konische Erweiterung des Korpus zustande.
Die erste entwickelte Baugröße des Saxophons entstand naheliegenderweise im Bassregister. Abgesehen davon hatte Sax aber von Anfang den Anspruch gehabt, langfristig nicht nur das „Bassproblem“ zu lösen, sondern eine komplette neuartige Instrumentenfamilie zu konstruieren und zwar die Familie der Metallblasinstrumente mit einem Holzblasmundstück.[13] Zum Vergleich kann man hier das Streichquartett heranziehen, dessen Instrumente alle zu einer Familie gehören, die aber in den einzelnen Registern jeweils ihre typischen Klangeigenschaften haben.
1.3. Biographische Erläuterungen zu Adolphe Sax
An dieser Stelle scheint es sinnvoll, einige biographische Erläuterungen über den Erfinder des Saxophons einzufügen, denn hinter ihm verbirgt sich nicht nur der geniale Instrumentenbauer, als der er heute, wenn überhaupt, bekannt ist, sondern darüber hinaus eine sehr vielseitige (und auch bisweilen schwierige) Persönlichkeit, die aufgrund seiner zahlreichen Talente und Fähigkeiten fast als „Allround-Genie“ bezeichnet werden kann. Sein Leben kommt einer Aneinanderreihung ungewöhnlicher und extremer Ereignisse gleich, die seinen Überlebenswillen immer wieder herausforderte.
Adolphe Sax[14] wurde am 6. November 1814 in Dinant (Belgien) als ältester Sohn des Kunsttischlers und Instrumentenbauers Charles Joseph Sax und seiner Frau Marie Joseph geboren. 1815 zog die Familie nach Brüssel um, wo der Vater eine Instrumentenbauwerkstatt eröffnete. Bereits in seinen Jugendjahren arbeitete Adolphe in der Werkstatt mit und wuchs so in die Materie hinein.
Als 14-jähriger wurde er Schüler an der „Ecole Royale de Musique“ in Brüssel und studierte dort Gesang, Flöte, Klarinette und Harmonielehre. Er widmete sich zunächst (bis ca. 1840) hauptsächlich möglichen Verbesserungen und Weiterentwicklungen von Klarinetten, für die er später auch seine ersten Patente beantragte.[15] In dieser ausführlichen Beschäftigung mit der Klarinette liegen wahrscheinlich auch die Ursprünge für die Erfindung des Saxophons.
Bereits 1835 übernahm er die Leitung der väterlichen Werkstatt, die er bis zur Übersiedelung nach Paris führen sollte.
Nach Paris wanderte Sax erstmals 1839, nachdem er von einer Bassklarinette des französischen Virtuosen J.F. Dacosta gelesen hatte, um diesem seine eigene vorzustellen. Den „Wettstreit“, der sich daraus im Rahmen der dortigen Industrieausstellung entwickelte, konnte Sax für sich entscheiden.
Nachdem seine Arbeiten in der Presse begeistert aufgenommen wurden, entschied sich Sax im Oktober 1842 zum Umzug nach Paris und wagte den „Sprung ins kalte Wasser“, indem er dort am 6. Juli 1843 seine eigene Instrumentenbauwerkstatt und die Firma „Adolphe Sax & Cie“ gründete. Durch sein handwerkliches Geschick, seine Intelligenz und sein Organisationstalent hatte der Betrieb schon nach kurzer Zeit eine Größe von über 150 Mitarbeitern, wodurch die Produktivität des Betriebes erhöht und die Produktpalette erweitert werden konnte.
Sax galt als ausgesprochen besessen und ehrgeizig und muss sich mit unerschütterlichem Engagement und Durchhaltevermögen für seine Arbeit eingesetzt haben, denn anders ist kaum zu erklären, dass er sich auch durch jahrzehntelange Gerichtsprozesse und Schikanen seiner Konkurrenten nicht beirren ließ. Insgesamt ging er dreimal Konkurs und baute zumindest zweimal seine Werkstatt von neuem wieder auf.
Neben seiner Arbeit als Instrumentenbauer[16] war er auch als Saxophonlehrer[17], Musikverleger und Organisator von Musikkapellen und eigenen Konzerten tätig, um die Bekanntheit seiner Erfindungen, besonders des Saxophons, zu fördern. Außerdem wurde er musikalischer Leiter an der Pariser Oper und besaß eine für damalige Zeiten einzigartige Instrumentensammlung. Durch seinen sehr stark ausgeprägten Erfindergeist beschäftigte er sich auch mit außermusikalischen Problemen, z.B. bei mechanischen Eisenbahnsignalen, Apparaten für Lungengymnastik und Apparaten zur medizinischen Anwendung von Teer.
Die im folgenden Kapitel dargestellten vielfältigen Querelen und Auseinandersetzungen mit seinen Gegnern sind auch an ihm nicht spurlos vorbeigegangen und stellten eine nicht unerhebliche gesundheitliche Belastung dar.
Der letzte seiner insgesamt drei Konkurse bedeutete im Jahr 1877 das Ende des Instrumentenbauers Sax. Seinen Lebensabend verbrachte er in äußerst bescheidenen Verhältnissen, er bekam lediglich eine kleine „Rente“, die ihm von H. Roujon, dem Pariser Operndirektor, zugesprochen wurde.
Am 7. Februar starb er schließlich und wurde auf dem Cimetière de Montmartre in Paris beigesetzt, wo er bis heute begraben liegt.[18]
1.4. Adolphe Sax als Verfechter seiner wichtigsten Erfindung
Nach Abschluss der Entwicklungsphase Anfang der 1840er Jahre verließ das Saxophon für die anstehenden Präsentationen erstmals die Werkstatt. Ihm und seinem Erfinder stand nun die sogenannte Durchsetzungsphase bevor, in der es galt, das neue Instrument bekannt zu machen, Förderer zu gewinnen und Kritiker zu überzeugen.
Auch diese Phase muss eine jede Erfindung hinter sich bringen; sie ist besonders schwierig und entscheidet darüber, ob eine Erfindung sich etablieren kann oder unbeachtet bleibt.[19] Sie ist „die Zeit des Kampfes mit Dummheit und Neid, Trägheit und Bosheit, heimlichem Widerstand und offenem Kampf der Interessen, die entsetzliche Zeit des Kampfes mit Menschen, ein Martyrium, auch wenn man Erfolg hat.“[20] Denn wenn eine Erfindung wirklich innovativ ist, bricht sie meist die vorhandenen Strukturen und Traditionen auf und ruft erst einmal Widerstand hervor.
Wohl in Vorausahnung dieser Probleme engagierte er sich von Anfang an außergewöhnlich stark und mit großem Ideenreichtum dafür, dass Musiker und Komponisten auf das Saxophon aufmerksam wurden und den Gewinn dieser Erfindung erkannten.
Mit der Vorführung des Saxophons bei potentiellen Interessenten begann er unmittelbar, nachdem die Entwicklung beendet war. Der genaue Zeitpunkt der Fertigstellung konnte zwar bis heute nicht eindeutig ermittelt werden, doch bereits auf der Brüsseler Industrieausstellung von 1841 wollte er offenbar ein „saxophone basse en cuivre“ ausstellen, hat dieses Vorhaben dann aber wieder verworfen.[21] Anfang Juni 1842 wanderte er nach Paris, wo er bei Hector Berlioz mit seinen Erfindungen auf große Begeisterung stieß. Berlioz war auch schon damals bekannt als ein Meister der Klangfarben und der Instrumentationskunst und erkannte von Anfang an die Qualitäten des Saxophons vor allem für das Sinfonieorchester. Er wurde von allen Zeitgenossen, die Sax unterstützten, der entschiedenste Förderer und Fürsprecher. Schon wenige Tage, nachdem sich Sax Anfang Juni 1842 bei Berlioz vorgestellt hatte, berichtete dieser darüber in Artikeln des „Journal des Débats“ und der „Neuen Zeitschrift für Musik“, wodurch der Begriff „Saxophon“ erstmals öffentlich erwähnt wurde. Berlioz beschrieb jeweils zunächst das Saxophon aus instrumentenkundlicher Sicht und warb anschließend ausführlich für die neu entstandenen klanglichen Möglichkeiten:
„Sein Klang ist (...) kraftvoll, mild (weich), schwingend, mit einer enormen Stärke und gleichzeitig geeignet, reduziert zu werden. (...) Auch stellt der Klangcharakter etwas absolut Neuartiges dar und erinnert in keiner Weise an die Klänge unserer derzeitigen Orchester. Sein Hauptvorzug ist die abwechslungsreiche Schönheit seiner verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten. Einmal tief und ruhig, dann leidenschaftlich, träumerisch und melancholisch, zuweilen zart wie der Hauch eines Echos, wie das unbestimmte, klagende Heulen des Windes in den Zweigen ...“[22]
Nach diesen überschwänglichen Äußerungen von Berlioz bekam Sax kurz darauf auch die Möglichkeit, sich am Pariser Conservertoire vorzustellen. Dort wurden sowohl seine Instrumente wie auch seine virtuose Spielweise u.a. von den Komponisten Auber, Kastner und Mayerbeer sowie von dem Musiktheoretiker Fétis begeistert aufgenommen.
Schließlich war aber doch Berlioz der erste Komponist, der das Saxophon in einer Komposition verwendete; er bearbeitete das von ihm geschriebene Chorstück „Chant Sacré“, und so entstand das Sextett „Hymne Sacré“, in dem er das Basssaxophon zum Einsatz brachte.[23] Dieses Werk wurde am 3. Februar 1844 in Paris uraufgeführt, wobei das Saxophon vom Erfinder selbst gespielt wurde. Das war allein schon deshalb nötig, weil das neue Instrument in der Öffentlichkeit noch fast unbekannt war und es daher kaum ein anderer hätte „bedienen“ können. Diese Sextett-Fassung des Stückes ist heute verschollen; es existiert aber eine Transkription für zwölf Saxophone von Jean-Marie Londeix.
Ebenfalls Anfang 1844 lernte auch Gioacchino Rossini das Saxophon kennen: Er besuchte Sax in seiner Werkstatt, wo er sich eigentlich die verbesserte Bassklarinette anhören wollte, und lernte bei dieser Gelegenheit auch das neu entwickelte Instrument kennen. Nach den Eindrücken dieses Besuches wurden durch Rossinis Engagement Sax-Instrumente am Konservatorium in Bologna eingeführt.
Im Juni 1844 stellte Sax das Saxophon erstmals auf der Pariser Industrieausstellung vor und wurde dort mit einer Silbermedaille ausgezeichnet, die er jedoch ablehnte, da ihm zuvor eine Goldmedaille in Aussicht gestellt worden war. Der Jury unterlief bei ihrer Bewertung ein fataler Irrtum, denn sie erkannte nicht, dass es sich bei dem vorgestellten Instrument um ein Saxophon handelte, sondern hielt es für eine verbesserte Klarinette. Sax hatte absichtlich keine Erläuterung abgegeben, bevor er vor der Kommission das Instrument spielte, um eine unvoreingenommene Einschätzung zu ermöglichen, die ausschließlich durch Beurteilung des Klangbildes zustande kommen sollte. Im den folgenden Jahren wurde Sax mit Preisen und Ehrungen für sein Schaffen geradezu „überhäuft“: So erhielt er u.a. auf der Londoner Weltausstellung 1851 mit der „Council Medal“ die höchstmögliche Auszeichnung und wurde 1867 auf der Weltausstellung in Paris mit dem einzigen „Grand Prix“ und einem 1. Preis für seine Ensembleaufführung geehrt. Auch aus den Industrieausstellungen dieser Zeit ging er stets als Goldmedaillengewinner hervor. Zudem wurde er Ritter der Ehrenlegion und Mitglied der Londoner Akademie der Wissenschaften.[24]
Am 7. Februar 1847 eröffnete Sax einen Konzertsaal direkt neben seiner Werkstatt, um dort Vorführungen und Konzerte seiner Instrumente durchzuführen. Da er sich mit den Gesetzen der Akustik sehr gut auskannte, hatte er diesen Saal nach seinen eigenen Entwürfen bauen lassen.[25] Zu diesem Konzertsaal gehörte auch eine von Sax eigens gegründete Konzertgesellschaft, die „Société de la Grande Harmonie - Organisation Instrumentale de A. Sax“.
Seit 1850 gab er Kompositionen in Auftrag, die er ab 1858 in seinem gegründeten Musikverlag auch zum Teil verlegte. Denn von selbst setzte kaum ein Komponist das Saxophon in seinen Werken ein, auch wenn immer wieder lobende Äußerungen vor allem über die klanglichen Möglichkeiten zu hören waren; doch diese Zögerlichkeit der Komponisten darf nicht ausschließlich als Anfeindung gegen Sax gesehen werden. Möglicherweise lässt sie sich auch damit erklären, dass sich noch kaum jemand mit dem neuen Instrument auskannte und es angemessen einzusetzen wusste.[26]
Am Ende jedoch standen das Engagement von Sax und dessen Ergebnisse in einem unbefriedigenden Verhältnis: Das Saxophon blieb zu seinen Lebzeiten weitgehend unbekannt. Zur langfristigen Durchsetzung des Instruments kam es erst nach seinem Tod.
1.5. Kampf gegen Kritiker, Neider und Konkurrenten
„Sollte man glauben, daß dieser junge erfinderische Künstler alle Mühe hat, sich durchzusetzen und in Paris zu halten? Man verfolgt ihn mit Methoden, die des Mittelalters würdig sind. (...)Wäre man kühn genug - man würde ihn ermorden. So groß ist der Haß, der immer gegen die Erfinder unter den Rivalen entsteht, die nichts erfinden.“[27]
In der Tat: Berlioz gehörte zu einer kleinen Minderheit von Komponisten und Künstlern, die den Wert des Saxophons (nicht zuletzt auch wegen der neuen Möglichkeiten für die Instrumentation) von Anfang an erkannten. Die Mehrheit, die vor allem aus anderen Instrumentenbauern in Paris bestand, ließ nichts unversucht, Sax nach Kräften das Leben schwer zu machen und ihn zu ruinieren.
Die Streitigkeiten begannen, noch bevor Sax 1846 ein erstes Patent für das Saxophon zuerkannt wurde. Die eigentliche Erfindung des Instruments lag damals bereits mehrere Jahre zurück, wobei ein eindeutiger Zeitpunkt bis heute nicht ermittelt werden konnte, da das Patent von 1846 die erste erhaltene schriftliche Aufzeichnung zum Saxophon ist. Als Sax dieses Patent schließlich beantragte, versuchten seine Gegner, die Patenterteilung zu verhindern, indem sie Vorführungen, wie z.B. jene auf der Industrieausstellung 1844 und bei Sachverständigen der Militärmusik, als rechtswidrig darstellten.[28]
Einen Schaden konnten sie damit allerdings noch nicht anrichten, im Gegenteil: Sax reagierte recht „schlagfertig“, indem er seine Konkurrenten aufforderte, innerhalb eines Jahres selbst Saxophone zu bauen und so die bereits existierende Bekanntheit des Instruments zu beweisen. Es war allerdings fast unmöglich, diese Forderung zu erfüllen, denn es waren bis dahin keinerlei Bauanleitungen und fertige Exemplare veröffentlicht worden; trotzdem versuchten seine Widersacher fieberhaft, das neue Instrument zu kopieren. Sie suchten sogar im Ausland nach Saxophonen, allerdings ohne konkretes Ergebnis. Es wurde lediglich das von W.F. Wieprecht[29] entwickelte Batyphon gefunden, das allerdings, abgesehen von der äußerlichen Ähnlichkeit, keine Gemeinsamkeit mit dem Saxophon hatte. Nachdem ein Jahr verstrichen war, hatte es keiner der Instrumentenbauer geschafft, ein Saxophon herzustellen, und Sax wurde am 22. Juni 1846 ein Patent für dieses Instrument zugesprochen, das zunächst für 15 Jahre galt.
Neben den herausragenden Qualitäten des Instrumentenbauers Sax störte seine Widersacher vor allem auch die Tatsache, dass er ursprünglich aus Belgien kam und somit ein Ausländer war. Denn in Paris wurde eigentlich kein Instrumentenbauer geduldet, der nicht ursprünglich aus der traditionsreichen und erfolgsverwöhnten Pariser „Handwerks-Gilde“ stammte. Zudem hatte er eine verhältnismäßig moderne Unternehmensphilosophie, denn er bestand darauf, dass alle Bauteile in der eigenen Werkstatt hergestellt werden, denn er war überzeugt, dadurch die Qualität seiner Instrumente steigern zu können. Dadurch waren die zahlreichen Zulieferer, für die die übrigen Instrumentenbauer einen großen Teil ihres Kapitals investierten, für Sax plötzlich überflüssig. Das war sicherlich ein Grund dafür, dass er es sich erlauben konnte, seine Arbeiten zu wesentlich geringeren Preisen als die Konkurrenz zu verkaufen. Ein anderer Grund für die geringen Preise war aber auch, dass seine Fähigkeiten als Geschäftsmann mangelhaft bzw. überhaupt nicht ausgeprägt waren und Sax sich lieber mit dem Erfinden und Musizieren beschäftigte als mit der Optimierung seines finanziellen Kapitals.[30]
Die Situation war für Sax denkbar ungünstig: Nicht nur, dass die Zahl seiner Gegner sehr groß war, sie verbündeten sich in einem eigens dafür gegründeten Verein gegen ihn; hinzu kam, dass die meisten von ihnen über wesentlich größere finanzielle Mittel verfügten als er. So stellte das Jahr 1846 für Sax auch den Beginn einer wahren Flut von Gerichtsprozessen dar, in denen er sowohl angeklagt war, als auch selbst Klage erhob. Diese Prozesse begleiteten ihn sein Leben lang und waren selbst bei seinem Tod noch nicht abgeschlossen.
[...]
[1] vgl. BARTSCH, W.: Das Saxophon als Produkt seiner Zeit. Entstehungsgeschichte und Faktoren, die sie beeinflussten; 1999, S. 6/7
[2] Ein Bläseroktett war die Standardbesetzung seit den 1770er Jahren gewesen. Dabei variierte der Gebrauch der Instrumente ständig und richtete sich nicht nur nach künstlerischen Gesichtspunkten, sondern vor allem nach den vorhandenen Möglichkeiten. Die klassische Besetzung bestand aus jeweils zwei Oboen, Klarinetten, Hörnern und Fagotten. Ebenso konnten aber auch Trompeten, Posaunen, Flöten und andere Instrumente in verschiedenen Zahlenverhältnissen eingesetzt werden; vgl. BARTSCH (1999): S. 5
[3] vgl. BARTSCH (1999): S. 8-10
[4] In einigen Quellen wird dieses Instrument auch „Superoktavfagott“ oder „Alto-Fagott“ genannt.
[5] Jaap Kool erwähnt Lazarus in diesem Zusammenhang in seinem Buch „Das Saxophon“(S.186/187). Gegen Lazarus als Erfinder spricht, dass er am 1. Januar 1815 geboren wurde und demnach 1820 erst fünf Jahre alt war; vgl. F.G. Rendall: The Sax before Sax, in: The Musical Times, S.1078 (Fußnoten)
[6] W.F. Wieprecht war u.a. preußischer Generaldirektor der Militärkapelle und gilt als Reformator der preußischen Militärmusik. Er wurde später für Sax zu einem der entschiedensten Widersacher.
[7] Das Bombardon bezeichnet eine drei- oder vierventilige Bass- oder Kontrabasstuba und gehört damit zur Familie des Bügelhorns. Es wurde nach 1835 in den Militärkapellen eingesetzt.
[8] vgl. BARTSCH (1999), S. 10 und 20
[9] VENTZKE/RAUMBERGER/HILKENBACH: Die Saxophone. Beiträge zu ihrer Bau-Charakteristik, Funktion und Geschichte; 2001, S. 101
[10] Für Aufführungen in geschlossenen Räumen kam sie überhaupt nicht in Frage, da sie die meisten anderen Instrumente überdeckte. Außerdem war der Klang kaum variabel, sowohl in der Lautstärke wie auch in der „Farbe“.
[11] vgl. BARTSCH (1999): S.20/21
[12] Dieses Mundstück hatte sah äußerlich einem „Bassklarinettenschnabel“ auffallend ähnlich, hatte aber im Gegensatz dazu einen breiteren Ausstich und eine mehr abgerundete Form.
[13] Die Saxophone werden „offiziell“ zu den Holzblasinstrumenten gezählt, da sie nach deren akustischen Regeln konstruiert wurden und ihnen somit auch in der Bauweise weitgehend entsprechen (z.B. beim Mundstück und der Anordnung der Klappen); die einzige Gemeinsamkeit der Saxophone mit den Blechblasinstrumenten besteht im Material des Korpus.
[14] Sein Vorname lautet eigentlich Antoine-Joseph.
[15] Seinen ersten Antrag stellte er am 21. Juni 1838. Dieser bezog sich auf ein neu entwickeltes System der Bassklarinette. Insgesamt wurden ihm im Laufe seines Lebens mehr als 30 Patente für die unterschiedlichsten (auch außermusikalischen) Erfindungen und Verbesserungen zuerkannt; allerdings haben sich davon allein die Saxophone dauerhaft durchgesetzt.
[16] Neben den Blasinstrumenten widmete er sich auch Verbesserungen von Orgeln, Perkussionsinstrumenten u.a.
[17] Zu den Tätigkeiten des Instrumentallehrers Sax finden sich nähere Erläuterungen unter 1.6.1.
[18] vgl. VENTZKE/RAUMBERGER/HILKENBACH (2001): S. 96-99
[19] vgl. VENTZKE/RAUMBERGER/HILKENBACH (2001): S. 101
[20] Rudolf Diesel, zit. nach K.E. Haeberle, Phänomen Nachfrage, Essen 1963, S. 84; in: VENTZKE / RAUMBERGER / HILKENBACH (2001): S.106
[21] vgl. VENTZKE/ RAUMBERGER/ HILKENBACH (2001), S. 90
[22] Zitat aus dem „Journal des Débats“ vom 12. Juni 1842
[23] Die genaue Besetzung des Stückes: Hohe Trompete in B, Kornett, Klarinette, Bassklarinette, Flügelhorn und Basssaxophon. Alle Instrumente wurden in der jeweiligen von Sax verbesserten oder neu erfundenen Form benutzt.
[24] vgl. VENTZKE/RAUMBERGER/HILKENBACH (2001): S. 96-98
[25] Seinem Patentantrag auf neuartige Gestaltung von Konzert- und Theatersälen wurde am 24. August 1866 statt gegeben.
[26] vgl. DULLAT, G.: Saxophone; 1995, S. 24/25
[27] in: BERLIOZ, H.: Lebenserinnerungen; 1914, S 63
[28] Sie beriefen sich dabei auf Artikel 31 des französischen Patentgesetzes von 1844, der eine Patentnahme für den Fall untersagte, dass eine Erfindung bereits vorher Publizität erlangt hatte; vgl. ROSENKAIMER: „Das Saxophon in seinen Frühzeiten und im Urteil berühmter Musiker“; in: Die Musik, Sept. 1928, S. 898
[29] Zu W.F. Wieprecht und seinem Werk finden sich nähere Erläuterungen unter 1.6.3.
[30] vgl. DULLAT, G.: Saxophone; 1995, S. 18-23
Details
- Titel
- Aufstieg und Siegeszug der Luftgeige in den USA und in Europa
- Untertitel
- Das Saxophon wird ein populäres Instrument
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 69
- Katalognummer
- V227097
- ISBN (eBook)
- 9783836633840
- Dateigröße
- 683 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- saxophon luftgeige musikinstrument musikgeschichte
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2003, Aufstieg und Siegeszug der Luftgeige in den USA und in Europa, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/227097

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.


