Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos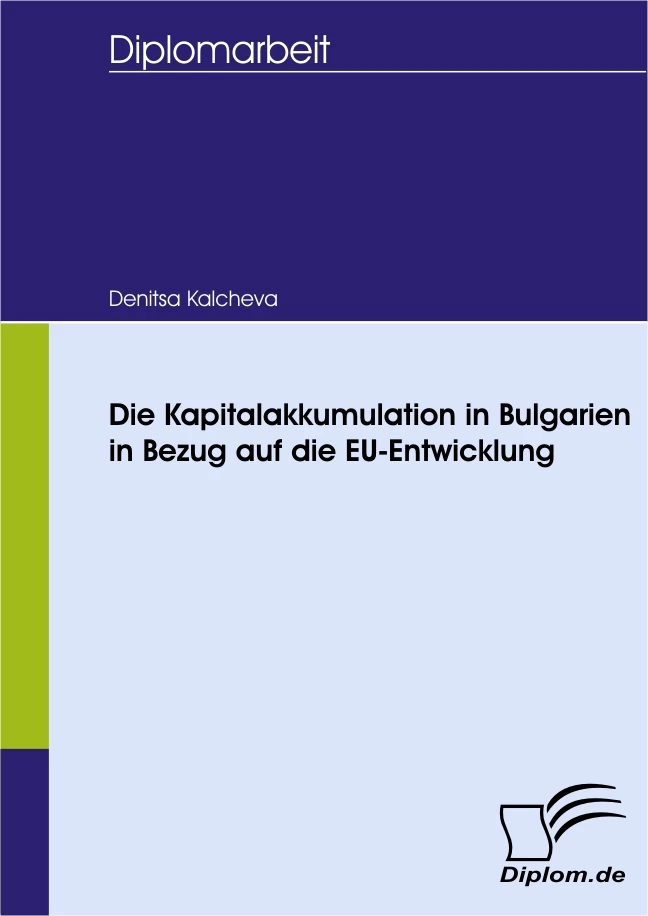
Die Kapitalakkumulation in Bulgarien in Bezug auf die EU-Entwicklung
Diplomarbeit, 2009, 88 Seiten
Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Freie Universität Berlin (Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre)
Note
1,7
Leseprobe
Inhaltsverszeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Problemstellung
1.2. Aufbau der Arbeit
2. Kapitalakkumulation
2.1. Begriffserklärung
2.2. Krisentheoretische Ansätze der Kapitalakkumaltion
2.2.1. Überproduktionstheorie
2.2.2. Tendenzieller Fall der Profitrate
2.2.3. Die Rolle des Finanzsektors
3. Die Europäische Union (EU)
3.1. Entstehungsgeschichte der Europäischen Union (EU)
3.2. Aufbau und Zielsetzungen der EU
3.2.1. Struktur und Aufbau
3.2.2. Förderprogramme für EU-Beitrittsländer
3.3. Bulgarien und die EU
4. Bulgarien - jüngstes Mitglied der EU
4.1. Historisches
4.2. Entwicklung unter sozialistischer Planwirtschaft
4.3. Transformationsprozess seit 1989
4.3.1. Entwicklung der Profitrate
4.3.1.1. Mathematische Herleitung
4.3.1.2. Datenbasis für die Berechnung
4.3.1.3. Ergebnisse der direkten Berechnung der Profitrate
4.3.2. Komponentenbewertung
4.3.2.1. Entwicklung Erwerbstätigkeit
4.3.2.2. Demographische Krise
4.3.2.3. Kapitalbildung
4.3.2.3.1. Ausländische Direktinvestitionen
4.3.2.3.2. Staatliche Aktivitäten
4.3.2.4. Arbeitsproduktivität
4.3.2.5. Lohn- und Gewinnquote
4.3.3. Ergebnisse und Schlussfolgerungen
4.4. Finanzwirtschaft
4.5. Kapitalakkumulation und soziale Lage
5. Fazit
Anhangi
Literaturverzeichnisv
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Öffentliche Meinung in Bulgarien über die EU-Mitgliedschaft
Abbildung 2: Reales BIP-Wachstum in Bulgarien 1996-2008
Abbildung 3: Profitrate(Zeitreihe) und Wachstumsrate in % für Zeitraum 1990-2008
Abbildung 4: Lebenserwartung nach Geschlecht und Alter (Männer)
Abbildung 5: Lebenserwartung bei der Geburt, nach Geschlecht und Alter (Frauen)
Abbildung 6: ADI in Bulgarien in Mio. Euro und in % des BIP im Zeitraum 1991-2007
Abbildung 7: Wohlstandsunterschiede in Abhängigkeit von verschiedenen Steady State-Pfaden
Abbildung 8: Arbeitsproduktivität je Beschäftigten, BIP in KKS je Beschäftigten im Vergleich zu EU-27 (EU-27=100)
Abbildung 9: Gewinn und Lohnquote in Bulgarien für Zeitraum 1997-2007
Abbildung 10: Gewinnquote für Bulgarien, MOEL-8 und EU-15 für Zeitraum 1997-2007
Abbildung 11: Repräsentative Umfrage über das Zugehörigkeitsgefühl der bulgarischen Bevölkerung zur EU
Abbildung 12: Repräsentative Umfrage der bulgarischen Bevölkerung über die Erwartungshaltung zum EU-Beitritt
Abbildung 13: Altersstruktur der bulgarischen Bevölkerung nach Geschlecht und Alter, 1995
Abbildung 14: Altersstruktur der bulgarischen Bevölkerung nach Geschlecht und Alter, 2008
Abbildung 15: Altersstruktur der bulgarischen Bevölkerung, Prognose für 2050
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Jährliche durchschnittliche Veränderung (%) wichtiger Wirtschafts-daten 1961-1973 für die EU-Gründungsländer
Tabelle 2: Die finanzielle Heranführungshilfe für Bulgarien aus dem EU-Haushalt (in Mio.)
Tabelle 3: Die Verteilung der EU-Mittel pro Jahr für Bulgarien und neue Mitgliedsländer insgesamt (EU 12), gerundete Beträge in Mio. EUR, Preise 2007
Tabelle 4: Abwertung gegenüber dem US-Dollar in % gegenüber dem Vorjahr (negatives Vorzeichen signalisiert Aufwertung)
Tabelle 5: Ergebnisse der Transformation (in %)
Tabelle 6: Notwendige Jahre, um bei verschiedene Wachstumsraten das BIP je Einwohner der EU-15 zu erreichen (EU-15-Wachstumsrate mit 2% p.a. angenommen)
Tabelle 7: Beschäftigungsquote nach Geschlecht,insgesamt
Tabelle 8: Bevölkerung zum 31.12 nach Jahren und Geschlecht
Tabelle 9: Absorbtionsgeschwindlichkeit von Kapitalzuflüssen
Tabelle 10: Niveauunterschiede der AP in % , EU-27= 100%
Tabelle 11: Berechnung der Profitrate
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Die europäische Integration kann als das wesentliche Merkmal der heutigen Epoche angesehen werden. Sie verbindet derzeit etwa eine halbe Milliarde Menschen in 27 Ländern, beeinflusst ihr Leben, ihren Alltag und ihre Arbeitswelt. Die Dynamik dieses Prozesses hat sich Anfang des 21. Jahrhunderts rasant entwickelt. Durch den Wegfall des „Eisernen Vorhangs“ ergaben sich neue Möglichkeiten einer gesamteuropäischen Integration. Die osteuropäischen Staaten drängten und drängen immer noch mit Entschlossenheit und aus Überzeugung in den Staatenverbund. Es ist spürbar und mit den Händen greifbar, dass diese Entwicklung eine tiefgreifende Veränderung des Kontinents von historischer Dimension nach sich ziehen wird.
1.1. Problemstellung
Das von mir vorgeschlagene Thema der Diplomarbeit untersucht die wechselseitigen Zusammenhänge der EU-Osterweiterung im Rahmen der europäischen Integration. Als Gradmesser und Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung möchte ich die Kapitalakkumulation in Bulgarien, meinem Heimatland, untersuchen. Insbesondere soll die Profitratenbestimmung als komplexer ökonomischer Terminus Gegenstand der Untersuchung sein. Die einzelnen Faktoren der Profitrate werden dargestellt und bewertet. Desweiteren werden die endogen und exogenen Einflussmöglichkeiten bei den Kohäsions-bemühungen der bulgarischen Volkswirtschft benannt und durch Prognosen und Szenarien, Perspektiven aufgezeigt. In engem Kontext mit den Erkenntnissen und Theorien von Karl Marx zur Kapitalakkumulation, sollen dabei das Wesen, die inneren Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge kontrovers beleuchtet und die Theorien auf ihre Gültigkeit und Aktualität untersucht werden. Die zentralen Fragestellungen des Themas ergeben sich aus dieser Gegenüberstellung:
Gelingt es durch Kapitalakkumulation einen beständigen wirtschaftlichen Aufschwung und gesellschaftlichen Wohlstand zu generieren?
Können die Divergenzen in der wirtschaftlichen Leistungskraft zwischen den EU-Mitgliedsländern durch vermehrte Akkumulation verringert werden?
Welche Auswirkungen hat die EU-Mitgliedschaft für die EU insgesamt und für die bulgarische Gesellschaft?
1.2. Aufbau der Arbeit
Nach einleitenden und determinierenden Abschnitten gliedert sich die Arbeit in drei Hauptteile. Im ersten Teil wird die historische Entstehung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und die Entwicklung Bulgariens vor dem EU-Beitritt dargestellt.
Der zweite Abschnitt untersucht die Profitrate in Bulgarien. Anhand der direkten Berechnungsmethode soll dargestellt werden, welche Auswirkungen die Kapitalakkumulation auf die Profitratenentwicklung hat. Da der Untersuchungs-zeiraum von 1990 bis 2008 für eine Trendaussage relativ kurz bemessen ist, kann keine gesicherte Tendenzbestimmung erfolgen. Die Komponenten, die den Profitratenverlauf beeinflussen, werden für den Zeitraum erfasst und auf ihre Korrelation zur Profitrate bewertet. Eine Komponentenanalyse zeigt die Perspektiven, Entwicklungsmöglichkeiten und Szenarien für den Angleichungs-prozess. Zu diesem Zweck werden einige Zeitreihen dargestellt und ihre Auswirkungen auf reale Lebens- und Arbeitsbedingungen in der EU und in Bulgarien verifiziert. Es wird verzichtet komplizierte, stringente mathematische Herleitungen und Modelanalysen mit Regressionsanalysen und anderen Wertungskriterien zu verbinden. Dies nicht aus Ignoranz- oder Fähigkeitsgründen, sondern aus zwei, für die Zielsetzung der Arbeit, wichtigen Überlegungen, wobei sich die Zweite aus der Ersten ableitet:
- wird als theoretische Grundlage die Marx`sche Akkumulationstheorie in der Arbeit Anwendung finden. Verfügbare statistische Daten und Kennziffern sind jedoch nicht ausreichend kompatibel mit dem Marx`schen Akkumulations-begriff. Dies gilt insbesondere für den Kapitalbegriff, der im Gegensatz zur angewandten neoklassischen und keynsianischen Methode, nicht nur das konstante Kapital (Anlagevermögen oder Kapitalstock) erfasst, sondern das wertschöpfende variable Kapital ausdrücklich einbezieht.[1] Insbesondere bei der Marx`schen These des „tendenziellen Fall der Profitrate“ sind empirische Untersuchungen der Zusammenhänge und Einflussfaktoren äußerst problematisch und fehlerbehaftet. Die Datenlage insbesondere in den neuen Mitgliedsländern, eingeschlossen Bulgarien, ist derzeit noch sehr unvollständig, obgleich alle nach dem Konzept der ESVG 1995[2] ihre statistischen Angaben aufarbeiten.
Es wird zweitens darauf verzichtet Zyklenanalysen, Zeitreihenregressionen mit diversen Filtern und Determinanten abzubilden. Es erscheint für die Verfasserin zielführender, nachvollziehbarer und ausreichend gesichertes Datenmaterial zu verarbeiten, dieses vergleichend zum gesellschaftlichen Istzustand zu setzen und damit der Aufgabenstellung und dem Ziel der Arbeit zu entsprechen.
Der abschließende Teil der Arbeit zieht ein Fazit sowohl über den europäischen Integrationsprozess im Allgemeinen, als auch im Spezifischen über die Situation in Bulgarien. Eine Chancen-Risiko-Bewertung der EU-Mitgliedschaft wird abgegeben. Schließlich sollen Gültigkeit und Aktualität Marx`scher Erkenntnisse geprüft werden. Das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate (GTP) und die Überproduktionstheorie mit ihrer finanz-basierten Ausprägung findet Beachtung.
2. Kapitalakkumulation
2.1. Begriffserklärung
Die Kapitalakkumulation ist eine der zentralen Kategorien in der politischen Ökonomie von Karl Marx. Im ersten Band des „Kapitals“ leitet er diesen Begriff aus der Entstehung des Geldes und des Mehrwerts, der Umwandlung von Mehrwert in Kapital und schließlich deren Wiedereinbringung in den Produktionsprozess her. Er zeigt wie unter kapitalistischen Produktions-verhältnissen die erweiterte Reproduktion eine stetig sich vermehrende Kapitalakkumulation hervorruft, wie das dabei eingesetzte Kapital sich unter verschiedenen historischen Bedingungen in seiner organischen Zusammensetzung verändert und damit auch die bestehenden Produktions- und Machtverhältnisse festigt und auf immer höherer Entwicklungsstufe reproduziert. Als organische Zusammensetzung des Kapitals bezeichnet Marx das technische und wertmäßige Verhältnis der zwei Kapitalkomponenten - konstantes (fixes) und variables Kapital. Im konstanten Teil werden im Wesentlichen die im Produktionsprozess aufgewendeten Resourcen an Rohstoffen, Maschinen und deren Verschleiß zusamengefasst.[3] Der variable Teil ist durch die im Produktionsprozess aufgewendete lebendige Arbeit gekennzeichnet. Das Verhältnis dieser beiden Kapitale kann sowohl wertmäßig, als auch technisch erklärt werden und beeinflusst Art und Umfang der Kapitalakkumulation. Die Akkumulation kann in extensiver und intensiver Form vollzogen werden. Erstere ist durch eine gleichbleibende Zusammensetzung der Kapitalteile, letztere durch eine Veränderung in Folge des technischen Fortschritts gekennzeichnet. Unter kapitalistischen Produktionsbedingungen ist das stetige Steigen der organischen Zusammensetzung (konstanter Kapitalteil wachsend) charakteristisches Merkmal, um mit Hilfe besserer, moderner Maschinen mehr Produkte in gleicher Zeiteinheit herzustellen. Die dazu aufgewendete lebendige Arbeit, kann dabei im selben Verhältnis wachsen – dies ist die intensive Ausprägung der Akkumulation. Die extensive Form bedarf einer Steigerung der Arbeitsproduktivität, einer Erhöhung der Produktion bei gleichem, besser geringerem Kapitalaufwand. Die „Verwohlfeilerung“ [4] des Produktionsprozesses durch den Einsatz verbesserter Maschinen und Produktionsmethoden vergrößert die erzeugte Warenmenge, erhöht die Kosten des konstanten Kapitalteils im Verhältnis zum variablen.
Auslösendes Moment der veränderten organischen Proportion zwischen fixen und variablen Kapital ist zuvorderst die Produktivitätsentwicklung:
„Ein […] wichtiger Faktor in der Akkumulation des Kapitals ist der Produktivitätsgrad der gesellschaftlichen Arbeit.“ [5]
Aus der wachsenden Differenz zwischen den konstanten und variablen Teilen des Kapitals entwickelt Marx mehrere ökonomische Tendenzen und Wirkungs-bedingungen, die der Verwertung des Kapitals als Schranken seiner Akkumulationsintentionen entgegenstehen. Der tendenzielle Fall der Profitrate, die Konzentration und Zentralisation des Kapitals, die Entstehung einer Reservearmee von lebendigen Kapital (Arbeitslose) werden zusammengefasst im allgemeinen Gesetz der kapitalistischen Akkumulation:
„ Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital, Umfang und Energie seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats und die Produktivkraft seiner Arbeit, desto größer die industrielle Reservearmee [...]. Die verhältnismäßige Größe der Reservearmee wächst also mit den Potenzen des Reichtums [...]. Je größer endlich die Lazarusschichte (Armenschicht) der Arbeiterklasse und die industrielle Reservearmee, desto größer der offizielle Pauperismus (Zahl der Armen). Dies ist das absolute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Es wird gleich allen andren Gesetzen in seiner Verwirklichung durch mannigfache Umstände modifiziert […].“ [6]
Als zentrale Aussage wird hier die Verantwortung für die gesellschaftliche Teilung in Arme und Reiche der kapitalistischen Produktionsweise und den Verwertungszwängen des Kapitals zugewiesen. Dieser von Marx erkannte Zusammenhang wird von seinen Kritikern als „Verelendungstheorie“ interpretiert und verhöhnt, obgleich gerade im letzten Satz des o.g. Zitats und auch an anderen Stellen des „Kapitals“ die Begrifflichkeit von Armut und Verelendung im Marx´schen Sinne klar definiert werden.
Für die vorliegende Arbeit ist die Akkumulationstheorie von Marx von zentraler Bedeutung, leiten sich daraus doch mehrere krisentheoretische Ansätze ab, die in der Vergangenheit und verstärkt in der Gegenwart, Gegenstand kontoverser Auseinandersetzungen der gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen sind. Die folgenden Unterabschnitte beschäftigen sich mit der theoretischen Herleitung des Gesetzes vom tendenziellen Fall der Profitrate (GTP), als eine sich langfristig durchschlagende Tendenz und den zyklischen Überproduktionskrisen, als eine in kürzeren Zeitanständen auftretende Disproportion der kapitalistischen Produktionsweise. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Profitrate für Bulgarien zwischen 1990 und 2008 empirisch ermittelt und interpretiert.[7]
2.2. Krisentheoretische Ansätze der Kapitalakkumaltion
Abgeleitet aus der Marx´schen Akkumulationstheorie sollen nun zwei grundlegende krisentheoretische Ansätze beschrieben werden. Diese werden bei Marx und anderen Ökonomen als mögliche Erklärungen für die zyklischen Krisen der kapitalistischen Produktionsweise herangezogen. Sie werden bestimmt durch die Entwicklungstendenzen der Kaptitalakkumulation. Sie bilden gleichzeitig aber auch Schranken für die Kapitalverwertung.
„Die kapitalistische Produktion strebt beständig, diese ihr immanenten Schranken zu überwinden, aber sie überwindet sie nur durch Mittel, die ihr diese Schranken aufs neue und auf gewaltigerm Maßstab entgegenstellen.“ [8]
Im Einzelnen werden folgende Fragestellungen von zentraler Bedeutung sein:
- Bestätigen diese Theorien die Erkenntnisse und empirischen Daten, die im Verlaufe dieser Arbeit gewonnen werden?
- Spiegeln sie die konkreten Verhältnisse richtig wieder?
- Welche Einflussnahmen, Regulationsmechanismen gibt es, um den allgemeinen Bewegungsgesetzen des Kapitals eine gesellschaftsfördernde und sozialverträgliche Komponente entgegenzustellen?
Die vorliegende Arbeit wird versuchen darauf Antworten zu finden und den äußeren Erscheinungen, mit Hilfe der Abstraktion und der Interpretation, das Wesentliche und Allgemeingültige herauszuarbeiten. Die Problematik der empirischen Darstellbarkeit von krisentheoretischen Tendenzen ist in der marxistischen Diskussion breit gefächert und reicht von formal mathemathischen Modellbildungsproblemen bis zu einer nicht notwendigen und möglichen empirischen Darstellbarkeit und ist stark akademisch geprägt.[9] Einigkeit besteht in der Auffassung, dass mehrere Krisenursachen zeitgleich auftreten können und dass es Einflüsse und Bedingungen gibt, die die Durchsetzung der Krisentheorien entgegenwirken können.
Nach der Überproduktionstheorie und dem GTP ist die Korrelation zwischen Bank- und Industriekapital, oder anders ausgedrückt zwischen dem Finanz- und Realsektor, ein zunehmend krisenverschärfendes Moment in der kapitalistischen globalisierten Entwicklung. Auswirkungen der sogenannten „Entkopplung“ dieser Sektoren sind in der aktuellen Bankenkrise exemplarisch und in drastischer Form verdeutlicht. Für die Kapitalakkumulation ist diese entfesselte finanzgetriebene Hyperakkumulation bedeutsam. Deshalb soll die Rolle des Finanzsektors im Abschnitt 2.2.3. die krisentheoretischen Betrachtungen abschließen. Als Hebel zur Forcierung der Zentralisation des Kapitals teilt Marx Finanzkapital in Bank- und Industriekapital. Das Bankkapital versorgt das Industriekapital mit notwendigen Finanzmitteln zu seiner Reproduktion auf erweiterter Stufe. Welch „mächtige Waffe“ dadurch geschaffen wurde zeigt die gegenwärtige Bankenkrise, ausgelöst durch Immobilienspekulationsgeschäften in den USA, welche die Realwirtschaft weltweit in eine krisenhafte Situation gebracht hat. Die funktionalen Verflechtungen sind von größter Bedeutung für die Akkumulationsdynamik und die Verwertungsmöglichkeiten des Kapitals.
2.2.1. Überproduktionstheorie
Die Überproduktionstheorie, als ein Teil der Disproportionstheorie, ist verbunden mit der Realisationsproblematik hergestellter Waren und Dienstleistungen. Sie kann durch zweiseitige Disproportionalität bedingt sein. Zum einen aus der angebotsseitigen Überproduktion, zum anderen aus nachfrageseitigen Konsumtion. Aus dieser Nichtübereinstimmung von Angebot und Nachfrage entstehen krisenhafte Verhältnisse, die eine Kapitalverwertung erschweren oder obsolet machen. Als Reaktion auf Überproduktion erfolgt in den meisten Fällen eine Vernichtung von Produktionskapazitäten, d.h. Kapital-vernichtung, bis sich ein gleichgewichtiger Zustand wieder hergestellt hat. Historisch gesehen wird die Wirtschaftskrise Anfang der 70er Jahre als Überproduktionskrise bezeichnet.
In der politischen Ökonomie wurden differierende Lösungsansätze zur Überwindung, Vermeidung von Überproduktionskrisen theoretisiert. Dass das Angebot sich seine eigene Nachfrage schafft ist als neoliberaler Lösungsansatz durch die kapitalistische Produktionsweise ad absurdum geführt worden. Das „Prinzip der effektiven Nachfrage“ von John Maynard Keynes beschränkt die Verwertungserfordernisse des Kapitals und behindert damit Konkurrenz, Konzentration und Zentralisation desselben. Es erweitert die verstärkte Nachfragepolitik durch planwirtschaftliche Elemente seitens des Staates. Die zyklische Kontraktion der Überproduktion, Kapazitätsvernichtung und Gleichgewichtssetzung veranschaulicht auf beeindruckende Weise den anarchischen Charakter im kapitalistischen Produktionsprozess. Gleichwohl bedrohen die Folgen dieser zyklischen Krisen das gesellchaftliche Gemeinwesen und werden deshalb durch institutionelle Regulationsinstrumente gemildert .[10]
Betrachten wir im Folgenden die zwei Abteilungen der Gesamtproduktion, die in Produktionsmittel- und Konsumtionsmittelproduktion unterschieden wird.[11] Die Überproduktionsproblematik in den beiden Abteilungen sind im Hinblick auf ihre Entstehung, Auswirkung und Überwindung zu differenzieren.
Eine sinkende Nachfrage im Produktionsmittelbereich signalisiert eine Verwertungsproblematik des fungierenden Industriekapitals (Abteilung I). Die Anschaffung neuer Maschinen und Anlagen ist aus Rentabilitätsgründen obsolet, Investitionen werden auf Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen beschränkt. Eine Überproduktion von Maschinen und Anlagen, welche nicht im Produktions-prozess eingesetzt werden, unterliegen einem moralischen und technischen Verschleiß und sind gleichbedeutend mit einer Kapitalvernichtung. Gleichzeitig versucht das fungierende Kapital Akkumulations- und Profitmasse durch Rationalisierungmaßnahmen stabil zu halten. Freisetzung von Arbeitskräften und verstärkter Druck auf die Löhne der Arbeiter sind Folgen des Prozesses. Profitträchtige Anlageformen werden verstärkt im Finanzkapitalmarkt gesucht. Nach erfolgter Vernichtung überschüssiger Kapazitäten (Marktbereinigung) nimmt die Investitionsneigung des Industriekapitals auf erweiterter technischer und wertmäßiger Stufenleiter wieder zu und schafft somit die Voraussetzung einer temporären Ausgewogenheit zwischen Angebot und Nachfrage.
Abteilung II ist eng verbunden mit der kaufkraftfähigen Nachfrage von Produkten aus der Konsumtionsmittelproduktion. Eine Überproduktion von Konsumtions-mitteln kann auf der einen Seite durch ein niedriges Lohnniveau der Beschäftigten hervorgerufen werden, andererseits Ausdruck eines Überangebots sein. Da die Stärkung der kaufkraftfähigen Nachfrage die Erhöhung der Lohnkostensumme der Beschäftigten beider Abteilungen der Produktion erdorderlich macht, beeinflusst dies das Verteilungsverhältnis des Profits und die allgemeine Profitrate.[12]
Die Überproduktion im Bereich der Konsumtionsmittelindustire verschärft genau wie in der Abteilung I die Konkurrenz und vernichtet Waren und Dienst-leistungen, die keine kaufkraftfähige Nachfrage erhalten haben. Wir kennen aus der Vergangenheit insbesondere die landwirtschaftliche Überproduktion bei gleichzeitigen Hungersnöten in der dritten Welt. Von Interesse für diese Arbeit wird deshalb die Entwicklung der Kaufkraft und des Lohnniveaus in der EU und ihrem jüngsten Mitglied Bulgarien sein.
2.2.2. Tendenzieller Fall der Profitrate
Im krisentheoretischen Ansatz vom tendenziellen Fall der Profitrate, zeigt Marx, wie die steigende organische Zusammensetzung des Kapitals[13] einen Fall der Profitrate hervorruft.
„Diese Veränderung in der technischen Zusammensetzung des Kapitals, das Wachstum in der Masse der Prokuktionsmittel, verglichen mit der Masse der sie belebenden Arbeitskraft, spiegelt sich wider in seiner Wertzusammensetzung [...].“[14]
Die allgeneine Profitrate bildet sich im kapitalistischen Produktionsprozess als Verwertung des vorgeschossenen Gesamtkapitals heraus, wobei Marx bei ihrer Herleitung beispielhaft von einer einheitlichen Mehrwertrate (m´=m/v) der Einzelkapitale ausgeht, die sich durch unterschiedliche Umschlagszeiten differenzieren.[15] Daraus kann bei einer niedrigen organischen Zusammensetzung des Kapitals und einer hohen Umschlagsgeschwindigkeit eine über-durchschnittliche Profitrate entspringen. Für die Einzelkapitale ist dies Antrieb ihre Profitrate zu optimieren und ihr vorgeschossenes Kapital zu verwerten.
Es bildet sich eine Konkurrenzsituation zwischen den Einzelkapitalen um die Profitratenoptimierung, in deren Verlauf es zu Kapitalab- und zuflüssen kommt. Aus der Produktion mit unterdurchschnittlicher Profitrate wird Kapital abfließen, überdurchschnittliche wird Kapitalzufluss verzeichnen. Tendenziell bildet sich aus den konkurrierenden Einzelkapitalen die allgemeine Profitrate heraus. Das Niveau der Profitrate wird durch drei Komponenten bestimmt:
1. dem Wert der Waren, das zu ihrer Erzeugung eingesetzte konstante und variable Kapital,
2. dem durchschnitlichen Exploitationsgrad der Arbeit,
3. der durchschnittlichen organischen Zusamensetzung des Kapitals.[16]
Nach Marx konstituiert sich die Profitrate über den Wert der produzierten Waren, nicht über ihren Preis, den sie im Austauschprozess annimmt. Zur Transformationsproblematik Wertform – Preisform von Waren soll an dieser Stelle nicht ausführlicher eingegangen werden.[17]
Das gesellschaftliche Gesamtkapital verwertet sich zu einer durchschnittlichen, allgemeinen Profitrate. Individuelles Kapital, als Teil des Gesamtkapitals, welches dieses Profitratenniveau nicht erreicht, verschwindet, wird absorbiert durch andere Einzelkapitale. Eine Konzentration von Kapital in immer weniger Händen ist Folge dieses Prozesses. Die Konzentration von Kapital ist Akkumulation, begrenzt durch das Volumen des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. „Die grösseren Kapitale schlagen [...] die kleineren“.[18] Die Verwandlung vieler kleinerer in weniger größere Kapitale hat auch eine Zentralisation des Kapitals zur Folge, welche durch Mobilisierung gewältiger Akkumulationsmassen beherrschend auf einen gegeben „Geschäftszweig“ wirkt.
Wir haben also gesehen, dass unter kapitalistischen Produktionsmechanismen, die Profitrate entscheidendes Kriterium für den Verwertungserfolg, –Misserfolg des eingesetzten Kapitals ist. Was, wie ein Naturgesetz erscheint („Fressen oder gefressen werden“ ), ist durch die Veränderung der organischen Zusammen-setzung des fungierenden Kapitals determiniert. Wenn Marx von der „Verwohlfeilerung der Elemente des konstanten Kapitals“ spricht, so ist von der steigenden organischen Zusammensetzung des Kapitals (c/v) die Rede: der verhältnismäßigen Zunahme[19] des konstanten Teils gegenüber dem variablen Teil. Sowohl in seiner technischen, als auch in seiner wertmäßigen Form impliziert dieses Verhältnis wieviel lebendige Arbeit (v) benötigt wird, um mit Hilfe von Rostoffen, Maschinen und Anlagen (c) eine Ware herzustellen. Der Wert der Ware ist durch die beiden in ihr enthaltenen Kapitalteile plus einem durch die lebendige Arbeit geschaffenen Zuschuss, dem Mehrwert, festgelegt. Marx benutzt bewusst die wertmäßige Entstehung des Mehrwerts und scheidet von der preislichen, stofflichen Darstellung. Der Wert einer Ware ist objektiv durch den in ihr steckenden gesellschaftlichen Aufwand bestimmt, wohingegen der Preis einer Ware als äußerer Ausdruck des Werts fungiert, um Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit auf dem Markt möglich zu machen.
Die Quelle des Mehrwerts ist die lebendige Arbeit, daraus der Profit und Profitrate entspringen. Mit der Zunahme der organischen Zusammensetzung des Kapitals sinkt die Profitrate. Somit wird eine Verwertung des Kapitals beschränkt und die Akkumulation gerät ins Stocken.
2.2.3. Die Rolle des Finanzsektors
Als Hebel zur Forcierung der Zentralisation des Kapitals erkannte Marx das Bankkapital. Er teilte Finanzkapital in Bank- und Industriekapital, gleichzusetzen mit zinstragenden und fungierenden Kapital. Das Bankkapital versorgt das Industriekapital mit den notwendigen Finanzmitteln zu seiner Reproduktion auf erweiterter Stufe. Diese klassische Aufgabe wurde jedoch in der jüngsten Geschichte kontakariert. Welch „mächtige Waffe“ [20] dadurch geschaffen wurde zeigt die gegenwärtige Bankenkrise. Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass diese von imenser Bedeutung für die Akkumulationsfähigkeit der Realwirtschaft ist, und damit die Akkumulationsdynamik und die Verwertungsmöglichkeiten des fungierenden Kapitals begrenzen wird.
Das Kreditsystem, so wir es in seiner heutigen totalen Ausprägung kennen, entwickelte sich logisch und historisch mit der Ausdehnung der kapitalistischen Produktionsweise. Nur andeutungsweise konnte Marx ahnen welch mächtiges Instrument entstehen würde, welch großer Einfluss auf den Akkumulations-prozess vollzogen wird, wenn er schreibt:
„[...] mit der kapitalistischen Produktion (bildet sich) eine ganz neue Macht, das Kreditwesen, das in seine Anfängen verstohlen, als bescheidne Beihilfe der Akkumulation, sich einschleicht, [...].“ [21]
Aus dieser bescheidnen Beihilfe ist im Laufe des kapitalistischen Entwicklungsprozesses ein Wirtschaftssektor gewachsen, der in seiner Ausprägung und seinem Umfang, gewaltiges Potential angehäuft hat. Wie Marx schon vorausahnte, erwuchs damit eine „furchtbare Waffe“ für den Konkurrenzkampf und ein „mächtiger Hebel“ für die Zentralisation der Kapitale.[22]
Konkret historisch entsprang das Kreditwesens aus der explosionsartigen Entwicklung der Produktivkräfte in der Phase der Industrialisierung des 18. Jahrhunderts. Mit wachsendem Akkumalationstempo wurde immer mehr neues „zuschüssiges“ Kapital im Reproduktionsprozess erforderlich. Kapitalintensive, von Technik und Technologie durchsetzte Produktionsprozesse und -systeme, machten es dem individuellen Kapital immer schwerer genügend Mittel vorzuschießen und der Reproduktionsdynamik in seinem rasanten Tempo zu entsprechen. Hier griff das Kreditwesen dem fungierenden Kapital mit dem Kredit unter die Arme. Es stellte Geldmittel (Kapital) zur Verfügung, in der Erwartung, nach der Verwertung diese mit Zins erweitert (zinstragend) honoriert zu bekommen. Folglich basierte dies auf ein Zahlungsversprechen aus einer noch zu erwartenden späteren Verwertung. Aber nicht nur die Verteilung und Um-verteilung von schon vorhandenen Geldmitteln oblag dem Kreditwesen, auch die Geldschöpfung „aus dem Nichts“, sofern die sachlichen Voraussetzungen im Reproduktionsprozess existent waren, stellten dem fungierenden Kapital zusätzliche Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung. Marx spricht vom „fiktiven Kapital“, welches dem Akkumulatinsprozess eine Elastizität verleiht, die es benötigt um seine Dynamik noch mehr zu forcieren.[23] Zu welchen Bedingungen Geldmittel in den Akkumulationsprozess fließen, beeinflusst die Ausdehnungs-möglichkeiten oder -beschränkungen desselben (Zinspolitik). Somit erwächst eine weitere Aufgabe für das sich herausgebildete Kredit- und Finanzsystem in der Steuerung der Geldmenge im Produktions- und Zirkulationsprozess. Kapitalistische Produktion und Finanzsystem sind untrennbar verbunden, dies wird auch von Marx an verschiedenen Stellen seines Hauptwerks erkannt.[24]
Mit der Herausbildung des Bankensektors wurde ein neuer Wirtschaftszweig geschaffen, der auf der Grundlage des existierenden Standes der Produktivkräfte einen imensen Einfluss auf die Volks- und in der heutigen Zeit auf die Weltwirtschaft hat. Die zyklischen Entwicklungsphasen, die in der kapitalistischen Produktionsweise impliziert sind, werden stark beeinflusst und die, in den vorangegangene Abschnitten behandelten krisentheoretischen Ansätze, sind ohne die Darstellung der monetären gesellschaftlichen Gegebenheiten schwer erklärbar, obschon sie eine eigenständige Wirkungsweise besitzen.
Die oben dargestellten, ursprünglichen und klassischen Aufgaben des Finanz-systems sind in den zurückliegenden zwei Dekaden zu einem Nebenprodukt degradiert worden. Die Liberalisierung des Bankensektors und die Entkopplung von realwirtschaftlichen Paradigmen machte den Weg frei für Finanzprodukte mit hochspekulativer Inkrementierung und astronomischen Renditen. Aus dem Desaster der New Economie am Aktienmarkt Ende der 90er Jahre wurden keine Lehren gezogen. Die Loslösung der Finanzwirtschaft von den realwirtschaftlichen Gegebenheiten schlagen nun in verstärktem Maße durch. Eine Rückkopplung ist mit all seinen weltwirtschaftlichen Folgen, eingeschlossen den Folgen für die EU und Bulgarien schwer einschätzbar.
Wie tief in seiner Wirkungsweise das Finanzwesen die wirtschaftliche Realität durchdringt, zeigt die aktuelle Bankenkrise. Ausgelöst durch hochspekulative Immobiliengeschäfte in den USA, erschüttert es derzeit das gesamte System und zeigt die enge Verflechtung von Finanz- und Wirtschaftssektor, zeigt somit exemplarisch die Schwachstellen und Anfälligkeiten desselben. Die Folgen dieser „unproduktiven Spekulation“ für die Realwirtschaft sind noch nicht im vollen Umfang durchgeschlagen, haben aber schon jetzt laute Rufe nach Regulation und Kontrolle des Finanzsystems hervorgerufen, unter ihnen vehemente Verfechter der freien unregulierten Entfaltung der Märkte. So wandelte sich der Chef der größten deutschen Bank nach eigenen Worten vom „Saulus zum Paulus“ in Bezug auf Einführung von Regeln für das Finanzsystem.[25]
3. Die Europäische Union (EU)
Als am 18. April 1951 der Vertag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS bzw. Montanunion) zwischen sechs europäischen Staaten[26] in Paris unterzeichnet wurde ahnte wohl niemand, dass dies der Beginn eines Prozesses war, der ein halbes Jahrhundert später den Kontinent prägt und bestimmt.
Dieser erste überstaatliche Zusammenschluss erwuchs zum Einen aus der historischen Notwendigkeit nach zwei verhängnisvollen Weltkriegen eine friedenssichernde Zusammenarbeit auf wirtschaftlichen und politischen Gebiet voranzutreiben. Zum Anderen waren mit den zollrechtlichen Bestimmungen und anderen Absprachen und Regelungen Schranken gefallen, die bisher die wirtschaftliche Interaktion zwischen den Ländern auf dem Kohle- und Stahl- sektor behinderten. Die Begrenzung auf den Kohle- und Stahlsektor erwies sich schon bald als problematisch und setzte einen Integrationsprozess in Gang, der in den folgenden Abschnitten in seinen wichtigsten Etappen nachgezeichnet werden soll.
3.1. Entstehungsgeschichte der Europäischen Union (EU)
Die europäische Einigungsbewegung kann in erster Linie als Folgeerscheinung zweier Weltkriege angesehen werden. Die Entstehungsmechanismen, die zu diesen historischen Katastrophen führten lehrten, dass ohne eine wirtschaftliche Zusammenarbeit keine politisch stabile Situation in Europa geschaffen werden kann. Die nationalstaatlichen Interessen und Hegemoniebestrebungen waren im Kern immer ökonomischer Natur. Die konkurrierenden Industrienationen in Europa waren deshalb bestrebt ihre Positionen zu behaupten und auch gewaltsam durchzusetzen. Aus dieser historischen Einsicht heraus wurde der west-europäische Integrationsansatz geboren. Die Tiefe der politischen, wie auch der wirtschaftlichen Integration der Mitglieder, der Umfang der rechtlichen Aus-gestaltung und das Ausmaß der Übertragung nationaler Hoheitsrechte gehen jedoch weit über das übliche Maß hinaus.
Nach der Gründung der EGKS im Jahr 1951 wurde schon bald die Notwendigkeit erkannt eine umfassendere zwischenstaatliche Zusammenarbeit zu organisieren, um den wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten einen einheitlichen Rahmen und eine gemeinsame Zielsetzung zu geben. Mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), sowie der Europäischen Atom-gemeinschaft (Euratom) im Jahr 1957, wurde dem entsprochen und unter anderem folgende Schwerpunkte gesetzt[27]:
- Steigerung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts,
- Abschaffung der Zölle und anderer wirtschaftlicher Hemnisse,
- Verbesserung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen,
- Freier Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr.
In einem Zeitrahmen von 12 Jahren, so die Zielsetzung der Gründerstaaten, sollte eine Harmonisierung der Volkswirtschaften einen möglichst homogenen Wirtschaftsraum schaffen. Wie aus der Tabelle 1 hervorgeht, konnten die Mitgliedsländer in den wichtigsten ökonomischen Kenngrößen diese Vorgabe erfüllen.
Tabelle 1 : Jährliche durchschnittliche Veränderung (%) wichtiger Wirtschaftsdaten 1961-1973 für die EU-Gründungsländer
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Onlinequelle: Europäische Kommission, Generaldirektion ECFIN: Statistischer Anhang zu „Europäische Wirtschaft“, 2008 [28]
Die nächste Etappe im europäischen Integrationsprozess war die Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG) im Jahr 1967, welche aus den drei vorherigen Organisationen entstand und die Zollunion der Gründerstaaten vollendete. Die politische und wirtschaftliche Einigung Europas kam 1973 mit dem Beitritt Dänemarks, Irlands und des Vereinigten Königsreichs einen großen Schritt voran und wurde 1979 mit dem Inkrafttreten des europäischen Währungssystems (EWS) um ein weiteres integratives Instrument verstärkt.[29]
Es folgte der Beitritt Griechenlands 1981 und die sogenannte Süderweiterung 1986 mit dem Beitritt Portugal und Spaniens. Finnland, Österreich und Schweden wurden 1995 Vollmitglieder.
Die Liberalisierung des EG-Binnenmarktes 1993 machte einen ungehinderten Güter-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr möglich.
In den Verträgen von Maastricht (1992) wurde die Schaffung einer einheitlichen Wirtschafts- und Währungsunion bis zum Jahr 1999 beschlossen. Der Integrationsprozess wurde im „Vertrag von Amsterdam“ (1997) mit der Osterweiterung der EU fortgeführt. Von 13 Bewerberländern wurden im Mai 2004 zehn als Mitglieder aufgenommen. Der Beitritt von Bulgarien und Rumänien folgte am 01.01.2007.
Die EU hat damit ihre heutige Gestalt und Größe erhalten, befindet sich jedoch noch immer in einem dynamischen Prozess der Erweiterung, da immer neue Staaten (Kroatien, Türkei) unter das Dach des europäischen Hauses drängen.
3.2. Aufbau und Zielsetzungen der EU
Auf der Grundlage der, in den „Römischen Verträgen“[30] festgelegten Zielsetzungen, wurden im Zuge der Erweiterungsetappen umfangreiche und detailierte Rahmenvereinbarungen beschlossen. Wichtige Etappen waren dabei die Änderung der europäischen Akte 1986 in Den Haag, der Maastricht-Vertrag[31] (1993) und im Jahr 2003 der in Nizza ausgearbeitete gemeinsame Verfassungs-entwurf.[32]
In Maastricht wurde die organisatorische und institutionelle Basis, für die in der heutigen Form existente Staatengemeinschaft, geschaffen. Sie beruht auf ein „Drei Säulen“-Modell, kennzeichnet somit die Zielsetzungen und Rahmen-bedingungen.
Erste Säule: Die europäische Gemeinschaft beinhaltet ökonomische Momente wie: Angelegenheiten des gemeinsamen Marktes, Agrarpolitik Wirtschafts- und Währungsangelegenheiten, Umweltpolitik.
Zweite Säule: Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) umfasst die Entwicklung und Schutz der Demokratie, Menschenrechte – im Kern wird hier die Verteidigungspolitik koordiniert.
Dritte Säule: Die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Einwanderungs- und Asylpolitik, Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des Drogen-handels werden in dieser Säule vereinheitlicht.
Europäisches Parlament, der Europarat, verschiedene Europäische Kommissionen, der Europäische Gerichtshof sind die wichtigsten Institutionen des gewaltigen Verwaltungsapparats der EU, die auf der Grundlage der „Drei Säulen“ einheitliches europäisches Handeln durchsetzen sollen.
[...]
[1] Vgl. Marx, K.: Das Kapital, MEW 23, S. 270ff.
[2] Konzept der einheitlichen Erfassung und Bewertung makroökonomischer Daten Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG), letzte Revision 1995.
[3] gleichzusetzen mit dem Begriff Kapitalstock oder Anlagevermögen in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR).
[4] Marx, K.: Das Kapital, MEW 25, S. 1003ff.
[5] Marx, K.: Das Kapital, MEW 23, S. 631.
[6] Marx, K.: Das Kapital, MEW 23, S. 673f.
[7] direkte Berechnung mit anschließender Komponentenbetrachtung.
[8] Marx, K.: Das Kapital, MEW 25, S. 260.
[9] Vgl. Mattfeldt, H. und Profitratenanalysegruppe (PRAG): verschiedene Publikationen, Uni Hamburg; Bontrup, H.: Lohn und Gewinn, München/Wien 2000; Zinn, K.- G.: Niedergang des Profits, Köln 1978.
[10] weiterführende Literatur zu Regulationstheorien: Aglietta, M.: Ein neues Akkumulationsregime. Die Regulationstheorie auf dem Prüfstand, Hamburg 2000; Lipietz, A.: Akkumulation, Krisen und Auswege aus der Krise, Prokla 1985; Girschner,C.:Ökonomismus und Funktionalismus - Eine Kritik an der Regulationstheorie von J. Hirsch: http://www.trend.infopartisan.net/trd 1206/t281206.html. Abruf am 15.11.08 um 16.45 Uhr.
[11] Vgl. Marx, K.: Das Kapital, MEW 24, S. 394.
[12] Vgl. dazu Glyn, A.: Britischer Kapitalismus, der Arbeitnehmer und der Profit-Squeeze, 1972.
[13] Anwachsen des konstanten Kapitals gegenüber dem variablen; c/v.
[14] Marx, K.: Das Kapital, MEW 23, S. 651.
[15] Vgl. Marx, K.: Das Kapital, MEW 25, S. 162.
[16] Vgl. Marx, K.: Das Kapital, MEW 25, S. 176.
[17] Zur Vertiefung wird empfohlen: Hein, E.: Konzentration und Profitratendifferenzierung-theoretische und empirische Aspekte, Verlag Peter Lang, Frankfurt/M. 1991.
[18] Marx, K.: Das Kapital, MEW 23, S. 654.
[19] Marx, K.: Das Kapital, MEW 25, S. 245.
[20] von K. Marx verwendeter Ausdruck.
[21] Marx, K.: Das Kapital, MEW 23, S. 655.
[22] Ebd., S. 655.
[23] Marx, K.: MEW 25, S. 457.
[24] Marx, K.: MEW 25, S. 245f.
[25] vgl. Rede Josef Ackermann, Chef der größten deutschen Bank, auf Bankentreffen in Frankfurt/M. am 17.11.2008.
[26] Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und Niederlande.
[27] Vgl. EWGV, Veröffentlichungstelle der Europäische Gemeinschaften, 8012/2/1/1964/5.
[28] Europäische Komission, Generaldirektion ECFIN Wirtschaft und Finanzen: Statistischer Anhang zu „Europäische Wirtschaft“, Frühjahr 2008. Online: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication12534_de.pdf. Abruf am 16.11.2008 um 10.35 Uhr.
[29] Dänemark und Großbritanien haben den EURO als gemeinsame Währung abgelehnt, Frankreich und die Niederlande haben per Volksabstimmung gegen die EU-Verfassung votiert.
[30] Vgl. EWGV, Veröffentlichungstelle der Europäische Gemeinschaften, 8012/2/1/1964/5.
[31] Vgl. Europa: Vertrag von Maastricht über die Europäische Union. Online: http://europa.eu/scadplus/treaties/maastricht_de.htm. Abruf am 14.12.2008 um 13.20 Uhr.
[32] Vgl. Europa: Vertrag von Nizza. Online: http://europa.eu/scadplus/nice_treaty/index_de.htm. Abruf am 14.12.2008 um 13.25 Uhr.
Details
- Titel
- Die Kapitalakkumulation in Bulgarien in Bezug auf die EU-Entwicklung
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 88
- Katalognummer
- V227003
- ISBN (eBook)
- 9783836632256
- Dateigröße
- 984 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- eu-erweiterung moel sozio-ökonomisch bulgarien transformationsprozess
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2009, Die Kapitalakkumulation in Bulgarien in Bezug auf die EU-Entwicklung, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/227003
- Angelegt am
- 6.7.2009

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.



