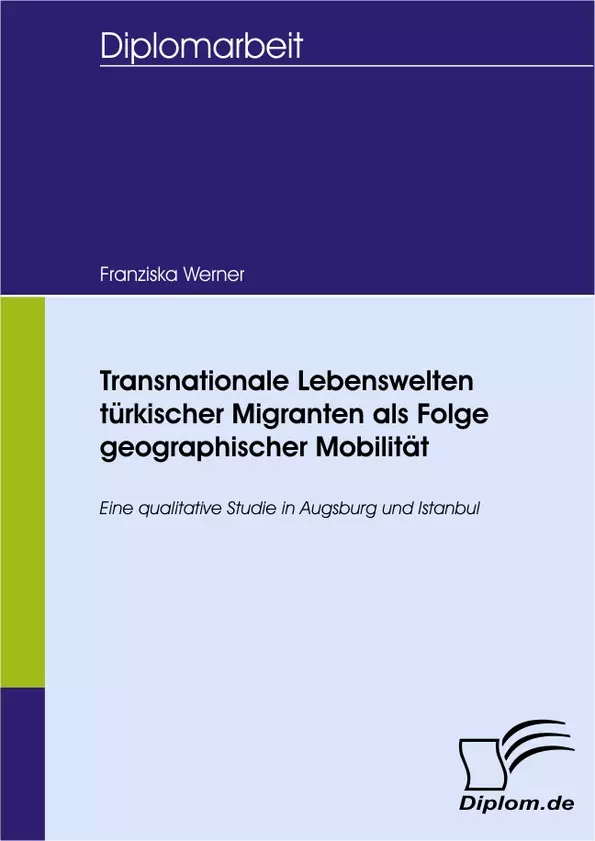Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos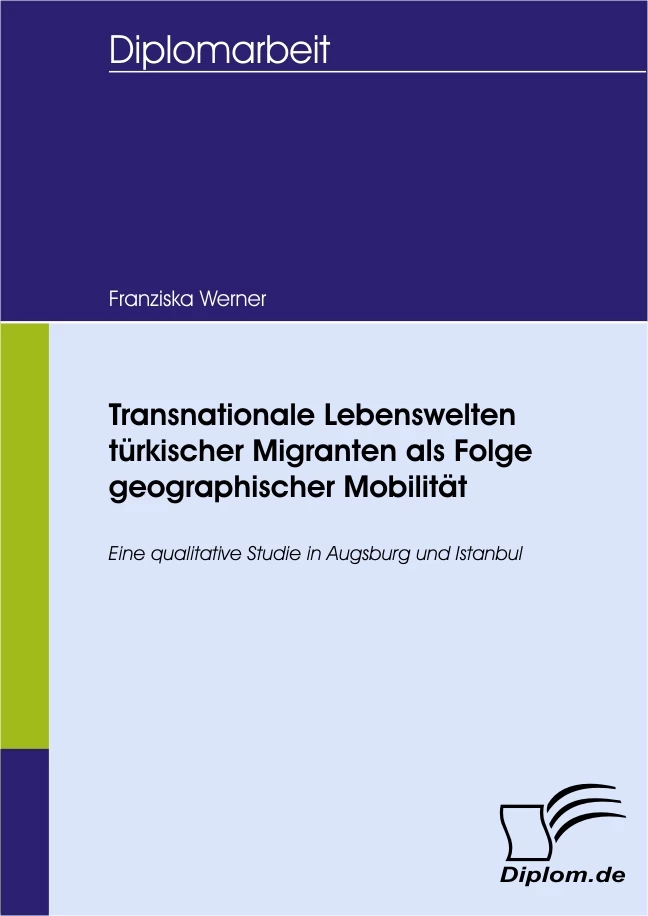
Transnationale Lebenswelten türkischer Migranten als Folge geographischer Mobilität
Diplomarbeit, 2008, 246 Seiten
Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Universität Augsburg (Fakultät für Angewandte Infomatik, Sozial- und Kulturgeographie)
Note
1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I. Einführung und Zielsetzung
1. Aktueller Forschungsstand zur transnationalen Migration
1.1 Theoretische Grundlagen und Sozialgeographische Perspektive
1.2 Die Transnationalismustheorie
1.2.1 Entstehung und Kontinuität von transnationalen sozialen Räumen
1.2.2 Transnationalismus und Globalisierung
1.2.3 Der Transmigrant als neuer Typus
1.2.4 Klärung einiger Begrifflichkeiten
1.3 Lebenswelten von Migrantenfamilien
1.3.1 Selbstpositionierung und kulturelle Leitbilder
1.3.2 Soziale Netzwerke und Verflechtungen
1.3.3 Multikulturelle Gesellschaft oder Parallelgesellschaft
1.4 Geschichtlicher Hintergrund: Von der Gastarbeitergeneration zur modernen Transmigration
1.4.1 Das Anwerbeabkommen
1.4.2 Anwerbestopp und Familiennachzug
1.4.3 Sozialer Aufstieg - vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber
1.4.4 Aktueller rechtlicher Rahmen
1.4.5 Türkische (Re)Migranten in Augsburg /Istanbul
II. Forschungsansatz und Untersuchungsrahmen
1. Forschungskonzept
2. Empirische Erhebung
2.1 Empirische Instrumente
2.1.1 Methoden der qualitativen Sozialforschung
2.1.2 Das problemzentrierte Interview
2.2 Definition der Untersuchungsgruppe
2.3 Auswahl der Untersuchungsgebiete
III. Analyse der Lebenswelten der Befragten
1. Methodisches Vorgehen
2. Individuelle Kurzporträts und Typisierung der Probanden
2.1 Die Weltbürger
2.1.1 „Rational-Strategische“
2.1.2. „Lokal Verortete“
2.2 Die Hochmobilen
2.2.1 „Hochmobile in der Partnerschaft“:
2.2.2 „Bikulturell Verortete“
2.3 Die Rückbesonnenen
2.3.1 „Beziehungsmotivierte“
2.3.2 „Erfolglose“
3. Datenpräsentation und Auswertung
3.1 Migrationsmotive und Standortwahl
3.2 Lebensart und Kultur
3.3 Einfluss von Diskriminierungserfahrung auf Lebenswelten
3.4 Arbeitssituation/ Wirtschaftlicher Anreiz
3.5 Bildung und Erziehung
3.6 Partnerwahl und Eheschließung
3.7 Räumliche Mobilität und transnationale Lebenswelten
3.7.1 Transnationale Partnerschaft
3.7.2 Physische Mobilität zwischen Türkei und Deutschland
3.7.3 Pendelverhalten der Familienmitglieder
3.7.4 Informations-, Waren- und Geldtransfer
3.7.5 Wohn- und Besitzverhältnisse
3.7.6 Sozialkontakte und Netzwerke
3.7.7 Selbstverortung und Identifikationsstrategien
IV. Ergebnisdiskussion und Schlussfolgerung
Literaturverzeichnis
Internetseiten
Weiterführende Literatur
Anhang
A1: Leitfaden
A2: Kategorienliste
A3: Transkribierte Interviews
Interview mit Sevda am 15.10.07
Interview mit Erol am 24.10.07
Interview mit Nurcihan am 12.12.07
Interview mit Leyla am 16.11.07
Interview mit Özlem am 30.10.07
Interview mit Yasemin am 31.10.07
Interview mit Ömid am 12.12.07
Interview mit Süleyman am 22.11.07
Interview mit Ceren am 21.11.07
Interview mit Hamdine am 15.10.07
Interview mit Sevim am 16.10.07
Interview mit Ali am 26.10.07
I. Einführung und Zielsetzung
Migration und deren Folgen stellen schon seit längerem eines der Topthemen in Politik und Gesellschaft. So diskutieren Politiker über Wege und Anstrengungen zur Integration von Ausländerinnen und Ausländern und Pflegedienste kämpfen gegen irreguläre Beschäftigung osteuropäischer Arbeitskräfte in der häuslichen Pflege. Hingegen locken lukrative und interessante Arbeitsplätze qualifizierte Deutsche ins Ausland. Wenn man die heutige Fernsehlandschaft mit ihren zahlreichen Live-Dokumentationen über Auswanderer und Aussteiger betrachtet, zeichnet sich gar ein wahrer Trend dahingehend ab. Als ich mit der Arbeit zu meiner Studie über die Lebenswelten türkischer Migranten begann, war jedoch nicht abzusehen welche Wellen dieses Thema bald schlagen würde. Nach Ereignissen, wie dem Brand in einem türkisch bewohnten Mietshaus in Ludwigshafen und der umstrittenen Rede des türkischen Präsidenten bei seinem Besuch in Köln. Auch in Hinblick auf 2008 als das, von der Bundesregierung ausgerufenen, „Jahr der Integration“ , das Europäische Jahr des interkulturellen Dialogs und der Türkei als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse, sowie den fortlaufenden EU-Beitrittsverhandlungen, vergeht nun kaum ein Tag ohne Medienberichterstattungen über Modernisierungsprobleme in der Türkei oder mangelnde Integration türkischer Mitbürger in Deutschland. Andere Stimmen betonen hingegen die vollbrachte soziale Eingliederung und emotionale Verbundenheit vieler Menschen türkischer Herkunft mit Deutschland. Beides ist sicherlich richtig und doch wird deutlich, dass Aufklärungsbedarf über Lebenswelten von Menschen mit türkischem Migrationshintergrund besteht. Gerade die Sichtweisen, der als integriert Geltenden unter ihnen und wie sie ihren Lebenslauf gestalten, ist weitgehend unbekannt. Diese Studie versucht mit einer qualitativen Erhebung daher nicht nur die räumliche Mobilität, transnationale Netzwerke und Bezugssysteme der Befragten näher zu beleuchten, sondern vor allem einen illustrativen Einblick in die Lebensentwürfe der Untersuchungsgruppe zu gewähren.
1. Aktueller Forschungsstand zur transnationalen Migration
Das Kapitel versteht sich als eine Darstellung des Forschungsstandes mit Blick auf die neueren, zum Teil kontrovers diskutierten Ansichten zum Thema Migration und versucht einen theoretisch-empirischen Rahmen aufzuspannen, innerhalb dessen (Re-) Migrationsentscheidungen getroffen wurden und werden. Im Bestreben, mich dem Thema auf vielseitige Weise zu nähern, verwendete ich folgende Arten von Quellen: An erster Stelle standen theoretische Analysen und wissenschaftliche Veröffentlichungen aus verschiedenen Fachbereichen (siehe Literaturliste) sowie Berichte von verschiedenen (Nicht-) Regierungsorganisationen. Als hilfreich erwiesen sich des weiteren Ergebnisse solcher empirischer Studien, die insbesondere persönliche Sichtweisen der Migranten zu verschiedenen Lebenssituationen analysiert haben.
1.1 Theoretische Grundlagen und Sozialgeographische Perspektive
In den 90er Jahren sah sich die Migrationsforschung mit einer Vielzahl von neuartigen Migrationsprozessen konfrontiert. Klassische einflussreiche Eingliederungstheorien, wie der Race-Relation-Cycle oder der Three-Generation-Assimilation-Cycle, mussten überdacht und erweitert werden (vgl. Goebel/Pries 2003, S.40). Der von Robert Park 1920 konzipierte „race-relations-cycle“ ist eine vierstufige zeitlich aufeinanderfolgende Eingliederung von Einwanderern, bei der die zweite Stufe durch Wettbewerb und Kulturkampf zwischen Migranten und Ankunftsgesellschaft geprägt ist. Als letzte Stufe erfolgt zwangsläufig die Assimilation[1] (vgl. ebd., 2003). Daraus sollte allerdings nicht voreilig geschlussfolgert werden, dass das herkömmliche Push-Pull-Modell zur Erklärung der Ursachen und Dynamik von Migration von Migrationssystemtheorien und neuerdings von transnationalen Ansätzen abgelöst worden sei (Faist 2006 S.17). Neben vielfältigen Wanderungsrealitäten, wie z.B. „zirkulären und oszillierenden Formen“ von Arbeitsmigration, traten nun aber neue Konzepte in den wissenschaftlichen Blickwinkel (Hillmann 2004, S.8). Diese neu entdeckten Aspekte der Migration stellten die Forschung vor Erklärungsprobleme, da man sich nun auch mit veränderten räumlichen Bezügen auseinandersetzten musste.[2]
Bei der Durchsicht der Publikationen kann man laut Hillmann feststellen, dass sich die sozialgeographische Forschung zu Migration und Integration bislang gerne von anderen Disziplinen inspirieren lässt und nur zögerlich eigene Konzepte vorlegt.
„ Doch wäre aus mindestens zwei Gründen gerade die sozialgeographische Forschung in der Lage, die neuen Migrationsprozesse, die sich vor dem Hintergrund von Globalisierung und damit einhergehender Entwicklung vollziehen, zu fassen. Erstens ist Migration immer ein Ausdruck der Verflechtung regionaler Systeme und zweitens können viele Formen der Migration vor allem durch eine interdisziplinäre, lokal orientierte, wissenschaftliche Herangehensweise verstanden werden.“ (ebd., S.8) „Die Beschäftigung mit transnationaler Migration, sozialräumlicher Entkoppelung und Identitätsentwicklung geht einher mit einer konzeptionellen Neuorientierung im Bereich der Migrationsforschung wie auch der Bevölkerungsgeographie, die die Integration induktiver Forschungsmethoden (…) zur Konsequenz hat.“ (Glorius 2007, S.40)
Seit dem Paradigmenwechsel in der Geographie 1968/69, wird „der Raum“ als ein Verteilungs-, Verknüpfungs- und Ausbreitungsmuster gesehen. Der Mensch ist nach dem wahrnehmungs-geographischen Ansatz nicht nur von physisch-materiellen Gegebenheiten seiner Umgebung abhängig. Vielmehr beurteilen und gestalten die Subjekte ihre Bewertung und Ziele gemäß ihrer Wahrnehmung. Wahrnehmung führt zu Entscheidungen, Entscheidungen wiederum führen zu Handlungen, die dann ihrerseits die Raumstrukturen wieder verändern, natürlich beeinflusst durch die jeweiligen sozialen, rechtlichen, ökonomischen, historischen und kulturellen Rahmenbedingungen (vgl. Budke 2003, S.89). Demnach müssten die Subjekte, die ihr Handeln durch „mentale Räume“ steuern, im Interressenmittelpunkt der modernen Geographie stehen. Der mentale Bereich umfasst die Erfahrungen und das verfügbare Wissen der Subjekte (Werlen, 1997, S.62). Weiter kann, so Werlen, die Sozialgeographie keine Raumwissenschaft sein, da Soziales keine direkte räumliche Existenz aufzeige (vgl. ebd., S.62). „Raum“ stelle nur eine Art Synonym für Probleme und Möglichkeiten der individuellen Handlungsverwirklichung dar. Bürkner spricht am 52. deutschen Geographentag von der Transnationalisierung von Migrationsprozessen als einer konzeptionellen Herausforderung für die geographische Migrationsforschung.
„ Noch in den 80er Jahren konnte die klassische Gastarbeitermigration aus dem süd- südost-europäischen Raum in der geographischen Literatur als unidirektionaler Prozess beschrieben werden. Es war die Annahme vorherrschend, dass es für die wandernden Individuen jeweils einen fest umrissenen Herkunftsbereich und einen ebenso klar konturierten Zielbereich geben müsse.“ (Bürkner 2000, S.301)
Seit Ende der 80er Jahre ist jedoch ein Anstieg internationaler Migrationsströme zu verzeichnen, der nicht bloß als ein Folge des Nord-Süd-Wohlstandsgefälles gesehen werden kann (vgl. Pries 2003, S. 23), sondern als eine quantitative und qualitative Veränderung der internationalen Migration an sich, die „an Dynamik, Reichweite und Bedeutung den klassischen Beschreibungs- und Erklärungsrahmen sprengt“ (Pries 1997, S. 15).
Die im Folgenden vorgestellten Ansätze zur transnationalen Migration sind vorwiegend in der deutschsprachigen Wissenschaft thematisiert worden. Weitere Ansätze können im Rahmen dieser Diplomarbeit nicht zur Sprache gebracht werden, es soll vielmehr nur ein kurzer Überblick geboten werden. Die ersten konzeptionellen Überlegungen zum Thema transnationale Migration entstanden Anfang der 90er Jahre in den USA. Anhand von Studien machten die Anthropologen Glick Schiller, Basch und Blanc-Szanton auf das Phänomen der transnationalen sozialen Verflechtungen aufmerksam. Die Werke von Portes et. al. (1995, 1997, 1999 und 2002) sollen nicht unerwähnt bleiben. Im deutschsprachigen Raum führen vor allem Faist und Pries die Diskussionen an. Neben zahlreichen Abhandlungen widmete sich Pries, anhand einer Studie typischer Immigrantengruppen aus Mexiko, der Entstehung von transnationalen sozialen Räumen. Auf den europäischen Raum beziehen sich die bekanntesten Werke z.B. auf transstaatliche Wirtschafts-, Politik- und Kulturräume zwischen der Türkei und Deutschland (in Faist 1998, 2000b). Otyakmaz (1995, 1999) beschäftigt sich mit den Lebensentwürfen und dem Selbstverständnis türkischer Migrantinnen. Salzbrunn (2001) erforscht dies bei westafrikanischen Migranten in Paris. Weitere, auch kritische, Abhandlungen zur Transnationalismusdebatte kommen aus der humangeographischen Forschung wie z.B. Goeke (2007) in seinem Buch Transnationale Migrationen am Beispiel von post-jugoslawischen Biographien in der Weltgesellschaft, des weiteren Heller, Becker /Felgentreff (2002) sowie Bürkner (2000). Glorius (2007) untersucht die multiplen Referenzsysteme polnischer Transmigranten in Leipzig und Pütz (2004) beschäftigte sich in seiner Studie mit der Transkulturalität türkischer Unternehmer in Berlin.
1.2 Die Transnationalismustheorie
Es soll hier keine umfassende Diskussion der Transnationalismustheorie erfolgen, vielmehr werden einige Ansätze aufgegriffen, die im Zusammenhang mit der sozialen Realität der nachfolgenden Fallstudien stehen.
1.2.1 Entstehung und Kontinuität von transnationalen sozialen Räumen
„Transnationalism is the process by which immigrants build social fields that link together their country of origin and the country of settlement“ (Glick Schiller et al. 1992, S. 10) . „Transnationale soziale Räume“ definiert Pries (2001a, S. 53) als „relativ dauerhafte, auf mehrere Orte verteilte bzw. zwischen mehreren Flächenräumen sich aufspannende verdichtete Konfigurationen von sozialen Alltagspraktiken, Symbolsystemen und Artefakten“. In einer allgemeinen Form bedeutet Transnationalität lediglich über Grenzen hinausgehende Interaktionen. Unter dem Schlagwort „Transnationalität“ begann man jedoch, teilweise neuen Mobilitätsvorgängen Aufmerksamkeit zu schenken. Man versteht darunter „multidirektionale internationale Wanderungsformen, die hauptsächlich erwerbs- oder lebens-phasenbezogen sind und häufig innerhalb eigens gebildeter Migranten-Netzwerke ablaufen“ (Glorius 2007, S.28). In Zusammenhang mit Transnationalität oder transnationaler Migration wird von transnationalen sozialen Räumen gesprochen. In jenen Räumen bilden sich (vgl. Pries 2001b), neue sozial-kulturelle Muster und Formen der Vergesellschaftung heraus, die transferierbare Elemente der Herkunfts- und Ankunftsgesellschaft[3] miteinander vermischen. Es entstehen neue soziale Wirklichkeiten jenseits von einer Ortsgebundenheit. Primär werden transnationale soziale Räume durch Migration und Mobilität ausgebildet, in einem späteren Stadium können die sozialen und symbolischen Verbindungen jedoch auch ohne körperliche Mobilität aufrecht erhalten werden und dabei soziale Nähe ohne geographische Nähe erzeugen (vgl. Faist 2000a, S.13). Um sie erklären zu können, muss man sich von der historisch gewachsenen Vorstellung des Raums als Container distanzieren, der den Flächen- mit dem Sozialraum gleichsetzt. Vor allem frühere Modelle untersuchten Migrations- und Assimilationsprozesse aus der Perspektive nationaler Container (vgl. Pries 1997). Wanderungsmotive, -arten und -auswirkungen sowie das Integrationsverhalten der Migranten sind Themen, die in der Sozialgeographie früher innerhalb einer solchen Raumvorstellung angesiedelt waren. Demzufolge verlassen Migranten ihren „Herkunfts-Container“ und wechseln in den „Container“ der jeweiligen Ankunftsstaaten (vgl. ebd., S.32). Faist und Özveren schreiben zur Transnationalismusdebatte:
„In the age of transboundary expansion, travel and mass media have increased the potential for cultural exchange. International migrants and their descendants, in particular, can be seen as prototypical representatives of this trend. How intensive this trend really is remains a matter of dispute. […] Various responses are possible to cultural diffusion and exchange in transnational spaces.” (Faist/Özveren 2004, S.23)
1.2.2 Transnationalismus und Globalisierung
Globalisierung ist das Schlagwort des ausgehenden 20. Jahrhunderts. In Hinblick auf die Globalisierung der Märkte und die weltweiten Kommunikationstechnologien („WorldWideWeb“), präsentiert sich die zunehmende Auflösung nationalstaatlicher Grenzen immer deutlicher (vgl. Bräunlein/Lauser 1997). Gern wird Transnationalismus daher im Zusammenhang mit Globalisierung gesetzt. Sicherlich begünstigen nun Globalisierungsprozesse die transnationale Migration. So zum Beispiel, wenn man an grenzübergreifende Informationsflüsse und massenmediale Verbreitung von Migrationsgelegenheiten, oder günstige Transportmöglichkeiten denkt (vgl. Faist 2006, S.6f). Die Annahme, Transnationalismus sei ein spezifisches Globalisierungsphänomen fällt aber bereits mit dem Argument, dass beide an sich keine neuen Phänomene sind. Vor- und koloniale Wirtschafts- und Handelsverbindungen, oder teilweise jahrhundertelange grenzüberschreitende Verbindungen von Diaspora- und Exilgesellschaften, beweisen dies. Sicher kann man aber die neue Dimension der weltweit zirkulierenden Migrationsbewegungen in Verbindung mit Globalisierung und damit einhergehenden ökonomischen, politischen und kulturellen Veränderungen, nicht leugnen (vgl. Breuer 2006).
Auch Arbeitsmigration mit Rückkehr in die Heimat, Kontakte zum Herkunftsland und periodische Besuche wurden bereits jahrhundertelang praktiziert. Der Unterschied zu heute ist jedoch, dass es früher an Möglichkeiten fehlte, grenzüberschreitende Kontakte zu pflegen. Es war nur privilegierten Migranten möglich, ein Leben zwischen zwei nationalen Kontexten zu führen (vgl. Portes et al. 1999).
Auffallend an den gegenwärtigen transnationalen Aktivitäten ist neben der „ (…) zunehmenden Heterogenisierung und globalen Homogenisierung von Lebensstilen und Alltagspraktiken“ (Glorius 2007, S.48). Auf Grund der verbesserten Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur (vgl. Bürkner 2000, S.303) ist die Steigerung der Möglichkeiten, Intensität, Dichte, Reichweite, Regelmäßigkeit und Dauer von Migrationsprozessen deutlich zu erkennen. Zweifelsohne fördert Globalisierung transnationale Wanderungen, jedoch stellt sie keine Bedingung dieser (vgl. Faist 2006). „Gerade die Transnationalisierung lebensweltlicher Bezüge von Migranten [ist] ein entscheidendes Merkmal dessen, was gemeinhin Globalisierung genannt wird“ (ebd S.26).
1.2.3 Der Transmigrant als neuer Typus
Die herkömmlichen Beschreibungen von Migration in Europa in der Nachkriegszeit setzten sich zum großen Teil aus, mehr oder weniger gelenkten, Arbeitsmigrationen zusammen. Je nachdem wurden sie entweder als Einwanderungen, als zeitlich begrenzte und auf Rückwanderung zielende Migrationen oder als Diasporawanderungen gesehen. Diese drei Idealtypen bilden zwar weiterhin einen Großteil der beobachtbaren Migrationsformen, jedoch zeigen sich in den letzten zwei Jahrzehnten Formen zunehmender Komplexität. Als vierter Idealtypus tritt so der Transmigrant auf (vgl. Pries 1997, Faist 2000a). Viele dieser Transmigranten pendeln im bestimmten Rhythmus oder in ganz unregelmäßigen Abständen zwischen Herkunftsort und Zielgebieten. Gerade in städtischen Bereichen lassen sich zunehmend Menschen finden, welche „Pendelexistenzen über große Distanzen führen bzw. in permanenter Mobilität leben“ (Breuer 2006, S.15f). Transmigranten bilden soziale Verbindungen und ökonomische Ressourcen und zirkulieren zwischen verschiedenen ökonomischen, kulturellen und sozialen Räumen, ohne sich dauerhaft für einen zu entscheiden bzw. entscheiden zu müssen. Die Grund-daseinsfunktionen können an beiden oder mehreren geographischen Orten bestehen. Anders gesagt, die Chancen auf Arbeit, Wohnen, Freizeit und soziale Kontakte sind an beiden Orten in ähnlichem Maße gewährleistet und die Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung wird immer seltener an das Territorium eines Nationalstaates gebunden (vgl. Goeke 2007, S.12 ). Eine Integration erfolgt bedingt soweit, wie es für die Lebenspraxis des Transmigranten notwendig und hilfreich ist (vgl. Pries 2000; Glick Schiller et al. 1992). Michael Braun und Adrian Favell identifizierten im so genannten “PIONEUR Projekt“, ein innereuropäisches Projekt zur Untersuchung von EU-Mobilität und EU-Identität, den neuen Migrantentypus des „free mover“. Diese privilegierten Migranten
„unterliegen kaum institutionellen Restriktionen und besitzen im Kontrast zu den traditionellen Arbeitsmigrant(inn)en ein höheres Migrationsalter, eine höhere Ressourcenausstattung und eine geringere Rückkehrmotivation. Die Suche nach Lebensqualität steht im Vordergrund der Migrationsentscheidung.“ (Hunger/Jeuthe 2006, S.80f)
Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass Liebe heute noch vor Arbeitssuche und Geldverdienen der vorherrschende Migrationsgrund sei, wobei Migranten meist in ihrer sozialen Klasse bleiben würden. Die Mehrheit dieser innereuropäischen „free mover“ entstamme jedoch bereits bürgerlichen und oberen Schichten (vgl. Hollerbach 2006).
Transmigranten wird ein hohes Maß an Flexibilität, Mobilität und Anpassungsfähigkeit, sowie funktionierender sozialer Netzwerke jenseits eines nationalen Bezugsrahmens, zugeschrieben. Dabei aktivieren sie mehrfache (Identitäts-) Bindungen, die jedoch von nationalen oder lokalen Rahmenbedingungen weiterhin beeinflusst werden. „Kreisläufe von Menschen, Waren, Geld, Symbolen Ideen und kulturellen Praktiken charakterisieren diese transstaatliche Bindungen“ (Faist 2000b, S. 13).
Im Gegensatz zu klassischen Einwanderern, die sich über mehrere Generationen in die Aufnahmegesellschaft assimilieren oder dauerhaft in die Herkunftsregion zurückkehren, positionieren sich Transmigranten in beiden oder mehreren regionalen und lokalen Orten gleichzeitig (vgl. Goebel/Pries 2003; Portes et al 2002). Die Vermischung von Elementen aus Herkunfts- und Zielland zu einer spezifischen Identität wird oft bei Transmigranten oftmals als „hybrid“ bezeichnet (Leggewie 2001, S. 6). Ihre heterogene Lebens- und Erwerbsorientierung kann aber zu einer kulturellen Zerrissenheit führen, verbunden mit Nachteilen gerade bezüglich der Integration (Pries 2000, S. 61).
In Zeiten der Globalisierung und moderner Technologien besteht nicht nur für Migranten die Möglichkeit eines mobilen Lebensstils. Aber ein teilweise von Geburt an verlaufender, soziokultureller Bezug zu beiden Gesellschaften, begünstigt sicherlich ein transnationales Leben. Ein gewisser politischer Status (z.B. Doppelstaatsbürgerschaft) spielt dabei auch eine Rolle.
Wichtig ist hierbei die Tatsache, dass auch Immigranten mit starken Verflechtungen zum Herkunftsland, die nicht zwischen den Nationalstaaten pendeln, trotzdem einem transnationalen sozialen Raum angehören können. Ebenso sind nicht migrierende Personen im Herkunftsland durchaus in transnationale soziale Räume involviert. Darüber hinaus werden auch transnationale soziale Räume nicht ausschließlich durch transnationale Migration erzeugt und auch nicht jede transnationale Migration bringt transnationale soziale Räume hervor. Dennoch stehen beide Phänomene in engem Zusammenhang (vgl. Pries 2000, 2001a).
1.2.4 Klärung einiger Begrifflichkeiten
Zunächst einmal geht es darum, migrationsrelevante Begriffe wie Assimilation, Integration, Segregation und Marginalisierung, die uns, teilweise stark wertgeladen, in Medien und politischen Debatten begegnen, ganz allgemein zu ordnen. Auf Seiten der Migranten lassen sich vier Optionen unterscheiden: Bei Integration und Assimilation sind Handlungsoptionen stärker auf die aufnehmende Gesellschaft bezogen. Von Integration spricht man, wenn auch Bezüge zur Herkunftskultur bzw. zur eigenen Ethnie erhalten bleiben, die Übernahme eigener kultureller Muster von der Aufnahmegesellschaft akzeptiert und wertgeschätzt wird und diese selbst einen sozialen Wandel durchläuft. Segregation ist dagegen durch eine stärkere Abgrenzung zur aufnehmenden Gesellschaft bei gleichzeitiger Hinwendung zur eigenen Ethnie gekennzeichnet (vgl. Goebels/Pries 2003, S.39). Die individuelle Segmentation gilt als die soziale Einbindung der Migranten in die ethnische Gruppe (vgl. Esser 2001, S.46). Esser strukturiert in kognitive, strukturelle, soziale und identifikative Assimilationsmöglichkeiten. (vgl. ebd) Kognitive oder kulturelle Assimilation bezieht sich auf Sprachbeherrschung, auf die Fähigkeit Normen zu erkennen und situativ richtig zu handeln. Unter struktureller Assimilation versteht man dagegen die Position von Individuen in der Gesellschaft, gemessen an Indikatoren wie berufliche Position, Bildungsniveau, Einkommen oder räumliche De-Segregation. Die soziale Assimilation meint formelle und informelle interethnische Sozialkontakte. Zuletzt die identifikative oder auch emotionale Assimilation, thematisiert das Selbstbild der Migranten und kann anhand von Variablen wie Rückkehrabsicht, ethnische Zugehörigkeitsdefinition, politischem Verhalten und Beibehaltung ethnischer Bräuche beschrieben werden (vgl. ebd, zit. in Keim 2003, S.34). Indikatoren gelten, auf Grund der Pluralisierung der Lebenswelten, als schwierig (vgl. Goeke 2007). Goebels und Pries schlagen zur ergebnisoffene gesellschaftlichen Eingliederung transnationaler Migranten das Konzept der gesellschaftlichen Inkorporation vor. Dabei werden partielle, segmentierte oder multiplen Formen dieser Inkorporation mit berücksichtigt (vgl. Goebels/Pries 2003,S. 42).
Zur Bestimmung des Begriffs der Lebenswelt wird in Stäheli (2006) auf Schütz hingewiesen, dieser beschreibt sie als die uns je umgebende „Wirklichkeitsregion, in die der Mensch eingreifen und die er verändern kann. ...Die Lebenswelt in ihrer Totalität als Natur- und Sozialwelt verstanden, ist sowohl Schauplatz als auch Zielgebiet meines und unseres wechselseitigen Handelns“ (vgl. Schütz 1975, zit. in Stäheli 2006, S41). Um die Lebenswelten der Interviewten zu verstehen muss man berücksichtigen was für diese von Bedeutung ist, d.h. auf deren Aussagen in der Befragung eingehen.
1.3 Lebenswelten von Migrantenfamilien
Um die transnationalen Lebenswelten der Untersuchungsgruppe besser einordnen zu können, werden im Folgenden einige allgemeine Aspekte migrantischer Lebenswelten dargestellt.
1.3.1 Selbstpositionierung und kulturelle Leitbilder
Bis zum Anwerbestopp 1973 wurden türkische Migranten in Deutschland in der Öffentlichkeit als eine Art „ homogene Gruppe “ wahrgenommen (Uslucan 2004, S.91). Heute dringt jedoch allmählich die Vielschichtigkeit und Differenziertheit der „türkischen Community“ durch. Dies gilt nicht nur in Bezug auf religiöse Zugehörigkeiten, sondern auch in Bezug auf ihre Angehörigkeiten zu unterschiedlichen Sozialschichten und Integrationsgraden. Auch zeigt sich immer mehr, dass Identität nicht homogen ist. Vielmehr ist sie meist ein Mosaik aus unterschiedlichen Bezugspunkten, entsteht und verändert sich fortwährend in einem Prozess der wechselnden Identifikation innerhalb eines Beziehungsnetzwerks. Orte mit denen man sich identifiziert, müssen nicht zwangsläufig mit aktuellen Lebensräumen zusammenhängen (vgl. Bräunlein/Lauser 1997, S.7). Stereotype Zuschreibungen wie „die Deutschen, „die Türken“ verbergen letztlich die Unfähigkeit einer adäquaten Betitelung. Denn heute werden multiple Identitäten nicht nur in den Subkulturen salonfähig, sondern zunehmend zum Entwurf von Normalität (vgl. ebd, S.8f). Bereits1908 spricht Georg Simmel über diese Thematik.
„ Simmel betrachtet die Moderne nicht unter den Vorzeichen der Zerstörung oder Störung von Identität, sondern erkennt die Fähigkeit des Menschen zu angemessener Reaktion. In heutiger Zeit überkreuzen sich nicht nur soziale Kreise, sondern es überlagern sich kulturelle Räume. Folgerichtig wird Identität und Raum, bzw. dessen Entgrenzung zum Thema. Mit dem Rückgriff auf Simmel sei auf eine Umbruchszeit verwiesen, die von großer Aktualität für die gegenwärtige Umbruchszeit ist.“ (Bräunlein/Lauser 1997, S.10)
Die Lebenspraxis der Arbeitsmigranten und ihrer Nachkommen ist nicht eine bloße Weiterführung ihrer Traditionen, die sie aus der Heimat mitgenommen haben, sondern ist geprägt von der Erfahrung der Migration. „Von Religion bis Familie, von Arbeit bis Feiern: Zentral ist stets der doppelte Bezugsrahmen, der Spannungsbogen zwischen dem „Hier“ und dem „Dort“, aus dem die neuen kulturellen Mischformen erwachsen“ (Breuer 2006, S.25). Jene sich fortwährend weiter ausdifferenzierenden, multiplen Teil-Identitäten, die sich im Besonderen bei der jüngeren Migrantengeneration beobachten lassen, können dennoch untereinander kompatibel gemacht werden. Bei einem genaueren Blick ist ihre Position viel weniger als Zwischenstellung zu verstehen, sondern vielmehr als vielschichtiges Identitätsgebilde, wobei mal die eine Seite und mal die andere dominiert (vgl. Uslucan 2004, S.95). „Diese neue Uneindeutigkeit zeigt sich gerade in der widersprechenden bzw. kuriosen Bezeichnung für diese Menschen: einheimische Ausländer, fremdländische Inländer, fremde Deutsche, Inländer mit fremden Pass, Pass- oder Fußballdeutsche, Bindestrich-Deutsche etc.“ (ebd, S.95). Begriffe wie „dazwischen“, „Ausländer“, „Almanci (deutsch-ähnlich)“, „entartet“, „konservativ“, „radikal“, „nationalistisch“, „Parallelgesellschaft“ oder „verlorene Generation“ werden ihnen sowohl in ihrem Herkunftsland als auch im Ankunftsland angelastet (vgl. Kaya/Kentel 2005, S.8). In Deutschland werden wohl „diese doppelten bzw. multiplen, ineinander verschachtelten Identitäten das künftige Bild prägen“ (Uslucan 2004, S.93). Herausforderung bleibt es für Migranten und ihre nachfolgenden Generationen, ein angemessenes und stabiles Selbstverständnis zu entwickeln. Die „ethnische Identität, als ein Teil der sozialen Identität, kann [dabei] als eine Perspektive der Selbstdarstellung, der Identifikation und der Wahrnehmung fungieren“ (ebd, S.69). Durch das Leben in Migration werden altbewährte kulturelle Orientierungs- und Verhaltensmuster teilweise außer Kraft gesetzt. Als Reaktion auf diese Änderung ist fortwährende Reflexion des eigenen Identitätsbildes nötig. Häufig geschieht das durch Identitätsabgrenzung. Durch die übersteigerte Wahrnehmung von Unterschieden (polarisierte Wahrnehmung), die Erhöhung des Eigenen und Abwertung des Fremden, wird zunächst zum eigenen Schutz eine Trennung vollzogen. Die Konstruktion von Feindbildern liegt dabei jedoch nahe (vgl. Langer 2004, S.63). Es besteht auch die Gefahr, dass sich ethnische Minderheiten als „Opfer“ fühlen, wenn sie sich zu lange in Kreisen bewegen, die schlechteren Zugang zu Dienstleistungen, Arbeit, Bildung und anderen Ressourcen haben. Diese Opferrolle entwickelt sich dabei zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Identität, die sich weiter verfestigt und gegenüber anderen Gruppen und der dominierenden Aufnahmegesellschaft verschließt (vgl. ebd, S.62). Interessant ist, dass es dabei nicht so sehr die kulturellen Unterschiede sind, die zu Missverständnissen und zu Konflikten führen, sondern vielmehr die Unsicherheit der Selbstverortung, für die tatsächliche oder angebliche kulturelle Unterschiede als Rechtfertigung dienen (vgl. ebd, S.53). Meistens ist hier ein stärkerer Rückzug der Migranten in eigenethnische Nischen zu beobachten, um die erfahrene Abwertung zu verringern.
„(…) Denn das Leben in eigenethnischen Kontexten verleiht das Gefühl, die Situation eher kontrollieren und verstehen zu können, was sich zwar kurzfristig förderlich für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden auswirkt, langfristig jedoch sich als kontraproduktiv erweist, da es zu weiterer Separation von der Mehrheitsgesellschaft und zu sozialer Desintegration führt.“ (Uslucan 2004, S.55)
Oftmals kommt es zu Problemen zwischen Migranten und ihren, meist im Ankunftsland geborenen, Kindern. Aufgrund ihrer schulischen Sozialisation müssen sie sich meist rascher und intensiver als ihre Eltern mit etwaigen Kulturkonflikten auseinandersetzen. Erschwerend kommt hinzu, dass Migran-tenkinder für ihre Eltern oft als Vermittler fungieren. Sozusagen als Brücke zwischen Herkunfts- und Ankunftskultur. Da sich Kinder meist schneller akkulturieren können als ihre Eltern, auch durch geringere Sprachbarrieren, werden sie oftmals in die Rolle des „Kulturübersetzers“ gedrängt (ebd, S.72).
Im Bezug auf die religiöse Selbstverortung von Migranten konnten zum Beispiel Merkens / Ibaidi (2000) in ihrer empirischen Studie zeigen, dass es deutliche Differenzen zwischen deutschen und türkischen Jugendlichen bezüglich der religiösen Orientierung gibt. Während bei türkischen Jugendlichen die Religion nach wie vor ein wichtiges kulturelles Leitbild darstellt, ist die Bindung an religiöse Vorgaben für deutsche Jugendliche gering. Die Studie zeigte außerdem, dass Orientierungen an modernen Lebensformen und Wertauffassung in erster Linie durch den Sozialstatus bzw. Bildungshintergrund be-stimmt werden (vgl. Uslucan 2004, S.72). Eine Untersuchung der Konrad-Adenauer Stiftung (2001/2002) zeigt dagegen jedoch, dass die Religion unter den türkischstämmigen Einwohnern Deutschlands extrem an Bedeutung für ihre Lebensgestaltung verloren hat (vgl. von Wilamowitz-Moellendorff 2001, S.13). Den Ergebnissen nach, betrachteten mehr als die Hälfte Deutschland schon als ihre Heimat, für die sie sich gegebenenfalls sogar militärisch einsetzen würden (vgl. ebd, S.6).
Schulz und Sackmann kamen in ihrer Studie zur kollektiven Identität türkischer Migranten im Jahre 2001 zu einigen überraschenden Ergebnissen bezüglich kultureller Werte und Leitbilder. Jüngere türkische Migranten hatten, bis auf Angaben zum Stellenwert eines anregenden Lebens, deutlich stärkere sicherheits- und traditionsorientierte Wertevorstellungen als die älteren Migranten. Eine Erklärung könnte vielleicht sein, dass jüngere Migranten noch stärker lebensweltlichen Verunsicherungen ausgesetzt sind und sich deshalb eher an traditionellen Normen orientieren (vgl. Uslucan 2004, S.82). „Ferner kann die Überlegung nicht von der Hand gewiesen werden, dass jüngere Migranten deutlich stärker in Kontakt und Diskurs mit Deutschen geraten und vermutlich eher das Bedürfnis verspüren, sich von der Mehrheitsgesellschaft abzugrenzen, offensiver die Differenzen zu betonen und die als „typisch“ für die „türkische Kultur“ unterstellten traditionalen Werte (…) verteidigen oder zumindest wertschätzen zu müssen“ (ebd, S.82). Bereits 1997 hatte man in einer vergleichenden Jugendstudie ebenfalls einen starken Konservatismus türkischer Jugendlicher in Deutschland festgestellt. In dieser Studie hatten türkische Jugendliche in Deutschland, höhere Konservatismuswerte als gleichaltrige Jugendliche in der Türkei gezeigt. Insofern scheint dieser Befund über die Zeit hinweg recht stabil zu sein. (vgl. ebd, S.83). Laut der Studie von Schulz/Sackmann (2001) bewerten viele junge Türken in Deutschland ihre Selbstverortung überwiegend als positiv und weniger von Gefühlen der Zerrissenheit geprägt. So sehen sich die Migranten der jungen Generation vermehrt als „Deutsch-Türken“. Dessen ungeachtet soll nicht unterschlagen werden, dass bei einigen wenigen eine Zwischenposition vorzufinden ist, manche sich sogar in keinem der beiden Staaten bzw. Kulturen akzeptiert fühlen.
„Daneben schreiben die „Türken“ sich Charaktereigenschaften bzw. Identitätsmerkmale wie bspw. „Warmherzigkeit, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit“ zu, die sie von den eher etwas kühlen „Deutschen“ unterscheiden, ohne damit die deutsche Gesellschaft insgesamt geringschätziger zu betrachten. Vielmehr assoziieren sie mit Deutschland bestimmte positive Eigenschaften, wie „Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit und Freiheit.“ (Schultz/Sackmann 2001, S. 43)
Insgesamt lässt sich also feststellen, dass die türkischen Migranten der deutschen Gesellschaft positiv zugewandt und aufgeschlossen sind, ohne dass sie deswegen eine „deutsche Identität“ herausbilden würden (vgl. ebd, S. 43). Trotz aller Definitionsschwierigkeiten sind die „die Türken in Deutschland“ nach über 40 Jahren Migration wohl auf dem Weg, ihre eigene Form des „kollektives Selbstverständnis“ zu entwickeln, das geprägt von gemeinsamen ethnischen Wurzeln und ihrer Lebenssituation in Deutschland ist. Die deutsch- türkische Jugend-Subkultur hat inzwischen auch ihren spezifischen Platz in der deutschen Jugendkultur eingenommen. Studien in Berlin bestätigen, dass deutsch-türkischer Hip Hop und Rap inzwischen auch vom deutschen Publikum als musikalische Avantgarde wahrgenommen und honoriert wird. Im Zusammenhang mit dieser Musikrichtung steht auch ein ganz bestimmter Lebensstil, der sich bereits zum festen Bestandteil von Jugendkultur entwickelt hat (vgl. Kottmann 2002).
1.3.2 Soziale Netzwerke und Verflechtungen
Erfolgreiches Leben in transnationalen Lebenswelten und die Bildung stabiler hybrider Identitäten sind entscheidend von der Bildung sozialer Netzwerke abhängig, (vgl. Haug 2000, S. 22) die Transferprozesse von sozialem, ökonomischem und humanem Kapital erst ermöglichen und meist nachfolgende Migrationsbewegungen in Gang setzen (vgl. Boomers 2005, S.173f). Man beobachtet nämlich bei Migrationsflüssen von Familien häufig Kettenmigration und eine Orientierung an so genannten „Pioniermigranten“. Durch die Etablierung von länderübergreifenden Netzwerken, können gegenseitige oder gar solidarische Hilfeleistungen angeboten werden, wie z.B. Finanzierungen, Arbeitsplatz- oder Wohnungssuche oder Betreuung der Kinder. So gibt es zum Beispiel eine Vielzahl von ehemaligen türkischen Arbeitsmigranten, die inzwischen wieder in ihr Herkunftsland zurückgekehrt sind, jedoch einige Monate im Jahr in Deutschland verbringen, wo sie ihren Familienangehörigen bei der Kinderbetreuung helfen oder altersbedingte Beschwerden kurieren (vgl. Faist 2000b). Daneben besteht oftmals weiterhin die aktive oder passive Teilhabe an der Politik im Herkunftsland. Auch ist es interessant, dass das Heiraten meist innerhalb dieser transnationalen Netzwerke erfolgt. So wünschen sich viele jugendliche Migranten einen Partner mit Migrationshintergrund oder sogar aus der, teils fremden, Heimat. Transnationale Verflechtungen zeigen sich in vielfältiger Art. So stellte z.B. eine Untersuchung fest, dass unter türkischen Migranten häufig TV-Sendungen konsumiert werden, die in der Türkei produziert wurden, im Gegenzug „ dienten Anfang der 90er aus Deutschland in die Türkei gesendete Programme dazu, das staatliche TV-Monopol am Bosporus aufzubrechen“ (ebd, S.53). Auch wenn transnationale Beziehungen eine Generation nicht überdauern, sind sie doch zwischen den Generationen angelegt. Z.B. wenn sich Migranten um ihre alternden Eltern im Herkunftsland kümmern, die Eltern ins Ankunftsland nachholen oder ihnen Geldüberweisungen ins Heimatland schicken (vgl. ebd).
Deutlich werden vor diesem Hintergrund bereits die komplexen Gesellschaftsbezüge, in denen die Beteiligten unterschiedliche Positionen beziehen können. „ Teilweise sind diese mehrschichtigen Vergesellschaftungsbezüge vergleichbar mit unterschiedlichen Sozialrollen, welche Individuen in einer modernen Gesellschaft einnehmen “ (Goebels/Pries 2003, S.38).
1.3.3 Multikulturelle Gesellschaft oder Parallelgesellschaft
Die Frage, ob wir uns in Deutschland auf dem Weg in eine multikulturelle Gesellschaft befinden, oder sich die ausländischen Mitbürger, allen voran die stärkste Einwanderergruppe, die Türken, längst schon in eine Parallelgesellschaft zurück gezogen haben, wird in Politik und Medien immer wieder kontrovers diskutiert. Im Zusammenhang mit Parallelgesellschaft steht auch der Begriff der ethnischen Kolonie. Segregierte ethnische Gemeinschaften, oder ethnische Kolonien, können Parallelgesellschaften entwickeln, also eine eigene spezifische Lebenswelt und durchaus neben einem eigenen Territorium sogar eine eigene Infrastruktur besitzen (vgl. Häußermann/Siebel 2001, S.72). „Die ethnische Ökonomie ist ein besonders auffälliges Merkmal der Koloniebildung von Migranten innerhalb der Einwanderungsgesellschaft“ (ebd., S.71). Das sind eigene Grundversorgungseinrichtungen, allen voran Lebensmittelgeschäfte, Ausbildungseinrichtungen wie z.B. Schulen, Zeitungen, religiöse Versammlungsorte, Vereine, Arbeitsstätten und Verwaltungsorgane. Man könnte sagen, eine Großstadtbevölkerung sortiert sich eigendynamisch in segregierte Quartiere. So suchen Zuwanderer in der Stadt nach Quartieren, wo ihre Landsleute bereits ansässig sind. In solchen Kolonien, in denen die Normen und Gebräuche, die sie aus der Heimat mitgebracht haben, gepflegt werden und vertraute Anschauungen (z.B. Religion), Verhaltensweisen und Lebensstile nicht in Frage gestellt werden. Den Neuankömmlingen werden dort die notwendigen Einweisungen und Orientierungen gegeben und sie werden in die formellen und informellen Unterstützungssysteme der Gemeinschaft aufgenommen (vgl. ebd., S.10f). Ethnische Kolonien werden, soweit sie freiwillig gewählt und einen vorübergehenden Zustand darstellen auch positiv bewertet. Der gemeinsame Raum trägt zur Stärkung der Identität bei, die Produktion von Gütern und Dienstleistungen (Ethnic Business) kann den spezifischen Bedürfnissen angepasst werden. „Damit kann auch die ethnische Kolonie die Voraussetzungen für eine allmähliche Integration in die Aufnahmegesellschaft verbessern, denn nur auf der Basis einer halbwegs gesicherten Identität ist eine offene Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur möglich“ (vgl. ebd., S.72).
Wichtige Befunde der Studie zu kollektiven Identitäten von Schultz/Sackmann (2001) sind, dass zwar viele Migranten Beziehungen zur Türkei aufrechterhalten, der Bezugspunkt für die Identität jedoch die hier lebenden Türken sind, mit denen sie spezifische Erfahrungen der Migration, hybride Identitäten und ein Lebensmittelpunkt in Deutschland gemeinsam haben. Ein Bezug auf die Migrantengemeinschaft für die Etablierung einer kollektiven Identität stehe für die meisten nicht in einem Widerspruch zu einer positiven Orientierung auf die deutsche Gesellschaft. Befürchtungen von einer „Parallelgesellschaft“, wie sie schon öfters angeführt wurden, konnten mit diesen Daten nicht bestätigt werden (vgl. Schultz/Sackmann 2001, S.45). In diesem Zusammenhang stellt sich auch unweigerlich die Frage, warum man an die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund oder ausländischem Pass strengere Maßstäbe anlegen sollte, als an die von „deutschstämmigen“ untereinander. Denn im Bezug auf Probleme und Unterschiede zwischen deutschen Villenvororten und Sozialwohnungsbauten spricht niemand von den Gefahren einer Parallelgesellschaft.
1.4 Geschichtlicher Hintergrund: Von der Gastarbeitergeneration zur modernen Transmigration
1.4.1 Das Anwerbeabkommen
Um dem steigenden Arbeitskräftebedarf in Deutschland gerecht zu werden, wurde in den 60er Jahren eine großangelegte Rekrutierung von Arbeitern aus Südeuropa veranlasst. Nach dem ersten Anwerbevertrag mit Italien 1955 folgten im Jahr 1960 Verträge mit Spanien und Griechenland, 1961 mit der Türkei, 1963 und die folgenden Jahre mit Marokko, Portugal und Tunesien, 1968 schließlich mit Jugoslawien. Nach Kriegsende konnten zunächst heimgekehrte Kriegsgefangene, Vertriebene und Flüchtlinge aus der Sowjetischen Besatzungszone den Mangel ausgleichen. Doch bald machten sich neben dem Wirtschaftsaufschwung auch noch weitere Aspekte einer modernen Industriegesellschaft, wie „Pillenknick“ und Ausalterung der Erwerbstätigen, bemerkbar. Hinzu kam die Abriegelung der DDR-Grenze 1961 und dem daraus folgenden Stopp des Arbeitskräftezustroms aus dem Osten (vgl. Terkessidis 2000). Da die Türkei ein wichtiges Mitglied der NATO war, wurde sie als erstes nichteuropäisches Land in das Anwerbeprogramm aufgenommen. Erwähnenswert ist, dass nur die Verträge mit Marokko, der Türkei und Tunesien, Klauseln über eine grundsätzliche Beschränkung des Aufenthalts enthielten. Zudem findet sich nur in den Abkommen mit der Türkei und Tunesien „ ein ausdrücklicher Hinweis darauf, dass die gesundheitliche Voruntersuchung der Bewerber „ auch zum Schutz der Bevölkerung aus seuchen-hygienischen Gründen“ vorgenommen werden sollte “ (ebd, S.18).
Für die Türken präsentierte sich der Arbeitsmarkt in Deutschland sehr attraktiv, denn um die ökonomischen Verhältnisse in der Türkei war es zu dieser Zeit nicht gut bestellt. Neben dem stark saisonabhängigen Arbeitsangebot, waren unsicher Arbeitsplätze und niedrige Löhne gegeben. Dagegen bot ihnen Deutschland einen, für türkische Verhältnisse, sicheren Job, der gut bezahlt war. Allerdings wurden die Gastarbeiter aus dem Ausland nur für das „unstrukturierte“ Segment des Arbeitsmarkts benötigt. Also im Bereich unsicherer, unqualifizierter, schlecht bezahlter Arbeit. Vor allem in Industrie und Bergbau wurden sie benötigt. Gewohnt wurde zumeist in firmeneigenen Unterkünften. „Das „Lager“ diente einerseits dazu, die ausländischen Arbeiter deutlich zu separieren. Zum anderen symbolisierte es den Aufenthalt im Transit, das Provisorium sollte den „Gastarbeitern“ quasi im Alltag vor Augen führen, dass ihre Zeit in der Bundesrepublik begrenzt war“ (ebd S.21).
Seit 1972 bilden nun die Einwanderer türkischer Herkunft in Deutschland die stärkste Gruppe der Arbeitsmigranten (Arslan/Schaffer/Klinshirn 1993, S.118).
1.4.2 Anwerbestopp und Familiennachzug
Der offizielle deutsche Anwerbestopp von Gastarbeitern im Jahr 1973 führte bekanntlich nicht dazu, dass die Wanderungen der Familienmitglieder stoppten, bzw. dass Remigration in hohem Maße erfolgte. „1973 war lediglich das Jahr in dem der Anteil ausländischer Arbeiterinnen und Arbeiter in Deutschland so hoch wie nie zuvor und seitdem nicht mehr war“ (Goeke 2007, S.138). Der Abbruch der Anwerbung wurde vor allem durch die schwierige ökonomische Situation durch die Ölkrise begründet, aber auch der Aspekt der Modernisierungshemmung war in Politik und Öffentlichkeit präsent. Angeblich verhinderte die Beschäftigung von Migranten in veralteten Handarbeitjobs die notwendige Rationalisierung der Betriebe. Dabei hatten viele von ihnen bereits die Regelung der Familienzusammenführung aus den mittleren Sechzigern genutzt und Frauen und Kinder nachkommen lassen (vgl. Terkessidis 2000). Allerdings waren diese Regelungen nur für EG-Angehörige einigermaßen verbindlich. Bei den türkischen Migranten blieb die Familienzusammenführung „eine Sache behördlichen Wohlwollens auf der Grundlage des verfassungsmäßigen Schutzes von Ehe und Familie“ (ebd, S.26). Die deutsche Regierung versprach sich nach dem Anwerbestopp eine Rückwanderungswelle. Zwar gingen in den folgenden zwei Jahren tatsächlich eine halbe Million Arbeitskräfte zurück, doch die Behörden hatten zahlreiche Faktoren falsch bewertet. Zum einen war der Grad der Sesshaftigkeit unterschätzt worden. Aus verschiedenen Gründen hatten sich viele längst zum Bleiben entschlossen. Zum anderen forcierte der Anwerbestopp bei vielen Nicht-EG-Angehörigen die Entscheidung zu bleiben. Ihnen wurde nämlich damit die Chance genommen, nach einer Ausreise wieder nach Deutschland zurückzukehren. Dazu kamen die „unbeabsichtigten Effekte abschreckender Sparmaßnahmen“: Beispielsweise kürzte die Bundesregierung das Kindergeld für die, in den Heimatländern zurückgelassenen Kinder, was zu einem verstärkten Familiennachzug dieser Kinder führte. „Insofern nahm die „ausländische“ Wohnbevölkerung mitnichten ab; 1980 lag sie um etwa eine Million höher als 1972“ (ebd, S.26). Auch die demographischen Daten hatten sich denen der Einheimischen angeglichen. Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen war nahezu ausgeglichen, ein Drittel der Bevölkerung war unter 20 und die Erwerbsquote lag bei 45% (vgl. ebd, S.27). Die Graphik in Abb.1 macht nochmal die zeitliche Verteilung der Zu- und Fortzüge der Türkischen Migranten und die Zahl der Türken in den verschiedenen Bundesländern deutlich.
Trotz des 1973 verhängten Anwerbestopps existieren bis heute zahlreiche Ausnahmeverordnungen (z.B. Arbeitsgenehmigungsverordnung (ArGV) und Anwerbestopp-Ausnahmeregelungen (ASAV)), die die Beschäftigung von Ausländern auf dem deutschen Arbeitsmarkt eingeschränkt erlauben. (vgl. ebd) Mit dem Nachzug der Familienangehörigen wurde das Wohnen in den, von den Arbeitgebern bereitgestellten, Sammelunterkünften seltener. Die Gastarbeiter bezogen nun Mietwohnungen. Auch das Wohnstandortverhalten näherte sich mit steigender Aufenthaltsdauer an das der deutschen Staatsangehörigen an (vgl. Häußermann/Siebel 2001, S.16).
„Ab 1981 wurde der Nachzug von Familienangehörigen nur genehmigt, wenn eine ordnungsgemäße, nicht unzureichende und familiengerechte Wohnung, nachgewiesen wurde. Eine eigene Wohnung wurde also zur Voraussetzung für den Nachzug von Familienangehörigen. 1998 wohnten 81,8 % der Ausländer in Mietwohnungen, 8,8 % waren Eigentümer, nur noch 1,2 % lebten in Gemeinschaftsunterkünften.“ (ebd, S.16)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb 1: Wanderung der Türken zwischen Deutschland und der Türkei 1960 bis 2003
Quelle: http://www.isoplan.de/mi/tr/k2005-1.pdf
1.4.3 Sozialer Aufstieg - vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber
„(…) Im Jahr 2000 sind bundesweit am stärksten die Türken und Türkinnen von Arbeitslosigkeit betroffen (20,2 %), gefolgt von Griechen und Griechinnen sowie Italienern und Italienerinnen“ (Hillmann 2004, S.13). Angesichts des fortdauernden Stellenabbaus im produzierenden Gewerbe aufgrund von Auto-matisierung, Rationalisierung und Standortverlagerung, sind gering qualifizierte Arbeiter besonders von Arbeitslosigkeit bedroht. Als sich in den 90er Jahren die Lage der ausländischen Bevölkerung auf dem deutschen Arbeitsmarkt verschlechterte, suchten ausländische Arbeitnehmer zunehmend den Weg in die berufliche Selbständigkeit, allen voran die türkische Bevölkerung. Im Sinne des „immigrant business“ werden vorrangig Familienangehörigen oder Verwandte im eigenen Betrieb beschäftigt. Von einer so genannten „Nischenökonomie“, die auf die Bedienung der Landsleute mit speziellen kulturellen Produkten innerhalb einer community ausgerichtet war, hat sich die so genannte türkische ethnische Ökonomie mittlerweile wegentwickelt und sich eine wichtige Position innerhalb der verschiedenen regionalen und nationalen Arbeitsmarktbereiche erarbeitet (vgl. Hillmann 2004, S.14). Nischen können nach Rieple als Ausgangspunkt für sozioökonomische Aufwärtsmobilität von Minderheitengruppen interpretiert werden. Die in der Regel kleine Unternehmensgröße, die starke Inanspruchnahme von Familienmitarbeit, die dichte Vernetzung mit der türkischen community und die transnationale Vernetzung mit Zulieferbetrieben sind typisch für solche ethnischen Gewerbe (vgl. Faist 2000b, S.90). Die Selbständigkeit setzt eine längerfristige Investition und somit auch eine langfristige Verbundenheit mit dem Unternehmensstandort im Ankunftsland voraus. So ist auch die Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit bei den selbständigen Türken, laut Informationen des Zentrums für Türkeistudien 2006, meist stärker verbreitet als unter der türkischen Bevölkerung insgesamt (vgl. Hillmann 2004). Gemäß des Statistischen Bundesamtes 2006 tätigten die Türken in Deutschland, nach den Polen die meisten Gewerbeneugründungen in diesem Jahr. Auch wenn nach wie vor ein großer Teil der migrantischen Unternehmen in der Gastronomie und dem Lebensmittelhandel angesiedelt sind, wächst vor allem die Zahl der Dienstleistungsunternehmen, der Handwerks- und Baubetriebe. Aber auch Computertechnik, Unternehmensberater, Anwälte und Architekten sind zu finden. Eine Studie zur Struktur der türkischen Ökonomie in Mühlheim 2006 zeigt, dass sich die Betriebe, darüber hinaus mehr und mehr professionalisieren, um zunehmendem Konkurrenzdruck zu begegnen. Aus Imbissbuden wurden Restaurants, aus Kiosken Supermärkte, aus Dönerläden Dönerproduktionen und aus Ticketverkaufsstellen Reisebüros (vgl. Stiftung Zentrum für Türkeistudien, S.5). Nebenbei entstehen immer mehr mittelständische und sogar Großunternehmen, die von Zugewanderten geleitet werden. Siehe „Öger Tours“ im Tourismusbereich oder „Santex“ in der Textilbranche (vgl. Rieple in Faist 2000b, S.87). Manche türkischstämmigen Unternehmer nutzen dabei die „Wirtschaftsstrukturen zweier Kernmärkte, Deutschland und Türkei, für ihre Geschäfte und tragen somit grenzübergreifend zum Wirtschaftswachstum bei “ (ebd, S.87). Rieple fügt das Beispiel von Allianzen zwischen deutschen und türkischen Unternehmen in den Anrainerstaaten des schwarzen Meers an, an welchen sich mehrere Konzerne aus unterschiedlichen Staaten beteiligten (vgl. ebd, S.87). Logistik, Personal und Rohstoffe werden je nach Kosten und Bedarf in den jeweiligen Mitgliedsländern aktiviert. Firmenkooperationen dieser Art fänden sich überwiegend in der Baubranche (vgl. Hillmann 2004, S.20).
Das Integrationspotenzial selbständiger Beschäftigter in Deutschland gilt als nicht unumstritten. So gibt es die Bedenken, dass sich Ausländer nicht zuletzt aus einer ökonomischen Notlage für die Selbständigkeit entscheiden und es sich daher vielmehr um eine „Flucht in die Selbständigkeit“ handle. Die Betroffenen machen sich selbständig, weil ihre Beschäftigungschancen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund mangelnder Qualifikationen relativ gering sind (vgl. Rudolph/Hillmann 1997). Türkische Selbständige weisen in der Branchenstruktur, aber auch im Nettoeinkommen deutliche Unterschiede zu deutschen Selbständigen auf. Gleichzeitig wird deutlich, dass selbständige Türken oftmals ein besseres Bildungs- und Einkommensniveau aufweisen als türkische Angestellte (vgl. Hillmann 2004, S.25). Vermutlich hat Selbständigkeit bei Türken einen höheren Statuswert, da viele nach wie vor als un- und angelernte Arbeiter tätig sind und aufgrund der andauernden wirtschaftsstrukturellen Veränderungen besonders von Erwerbslosigkeit bedroht sind, schätzen sie „Unabhängigkeit“ besonders hoch (vgl. ebd, S.25). „(…) Eine Bewertung des Integrationspotenzials der Selbständigkeit kann [daher] nicht beim Einkommen, der Branche und der Bildung stehen bleiben, sondern muss auch den Stellenwert bzw. Status der Selbständigkeit berücksichtigen, ebenso die positive Funktion von Selbständigen als Vorbilder oder Eliten und schließlich ihre Wirkung auf die intergenerationale Mobilität “ (ebd, S.25). Rieple erklärt die Entwicklung des transnationalen Wirtschaftsraums zwischen Türkei und Deutschland in zwei Stufen. Die ersten kontinuierlichen wirtschaftlichen Austauschprozesse reduzierten sich hauptsächlich auf Produkte, insbesondere Lebensmittel, die Immigranten, aus dem Heimatland einkauften. Daher befanden sich unter den ersten türkischen Selbstständigen in Deutschland zunächst Lebensmittelhändler. Auch die Eröffnung eigener Reisebüros lag natürlich nahe, da sich diese besser auf die spezifischen Bedürfnisse der Migranten einrichten konnten. Schließlich kamen Import-Exportgeschäfte hinzu. Auf der zweiten Stufe fingen migrantische Unternehmer in Deutschland an, die so genannte „Ethno-Nische“ zu verlassen und investierten im türkischen Wirtschaftsraum, um Waren kostengünstiger als in Deutschland zu produzieren bzw. einzukaufen. Nebenbei änderte sich allmählich auch die Kundenstruktur der türkischen Unternehmen. Damit entwickelten sich türkischstämmige Unternehmer zu Konkurrenten von deutschen und europäischen Konzernen, denn nun gehörten zum Kundenstamm, neben türkischer, auch deutsche- und europäische Kundschaft (vgl. Faist 2000b, S.89).
1.4.4 Aktueller rechtlicher Rahmen
Für Ausländer in Deutschland gelten nahezu alle Rechte des Grundgesetzes. Die Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Berufsfreiheit, das Recht der Freizügigkeit, das Auslieferungsverbot, das Widerstandsrecht, das aktive und passive Wahlrecht, das Recht auf Zugang zu allen öffentlichen Ämtern und das Recht auf staatsbürgerliche Gleichstellung in allen Bundesländern bleibt jedoch den deutschen Staatsangehörigen vorbehalten. Ausländer sind dagegen dem Ausländergesetz unterstellt. Nimmt man unbefristete Aufenthaltserlaubnis und Aufenthaltsberechtigung zusammen, verfügen jedoch die Mehrheit der Türken über einen gesicherten Aufenthaltsstatus in Deutschland (vgl. Prümm 2003, S.8). Gemäß der Ausländerbeauftragten 2000 verfügen türkische Staatsangehörige in Deutschland grundsätzlich über einen weit reichenden Ausweisungsschutz (vgl. ebd., S.11). Eine befristete Aufenthaltserlaubnis wird zunächst für ein Jahr ausgestellt, danach für je zwei Jahre befristet erteilt. Später erhalten sie die unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Diese gewährleistet Ausländern einen rechtlich abgesicherten Daueraufenthalt. Der Großteil, der in Deutschland lebenden Türken hat einen sicheren Aufenthaltsstatus (vgl. Prümm 2003). Dieser gewährleistet dem Ausländer ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht und einen verstärkten Schutz vor Ausweisung. Dieses gesicherte Aufenthaltsrecht wird aber nur dann erteilt, wenn der Ausländer seit acht Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, seinen Lebensunterhalt sowie seine Altersversorgung gesichert ist und er in den letzten Jahren straffrei war. Mit dem neuen Staatsangehörigkeitsgesetz 2000 erhalten Kinder von ausländischen Eltern unter gewissen Voraussetzungen bei der Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit. Dabei dürfen diese Kinder zunächst auch die nicht-deutsche Staatsangehörigkeit ihrer Eltern behalten. Im Alter zwischen 18 und 23 müssen sie sich dann für eine Staatsbürgerschaft entscheiden (vgl. ebd).
„The Imperial and State Citizenship Law provide that citizenship is passed by descent from parent to child. […] Now it is possible to acquire German citizenship as a result of being born in Germany (jus soli). According to the new law, children who are born in Germany to foreign nationals will receive German citizenship when one of the respective child’s parents has resided lawfully in Germany for at least eight years and holds entitlement to residence or has held an unlimited residence permit for at least three years.” (Kaya/Kentel 2005, S.9f)
In den Jahren 2000 und 2001 erhielten knapp 80.000 Geborene ausländischer Abstammung aufgrund des neuen Staatsangehörigkeitsgesetzes einen deutschen Pass (vgl. Özcan 2004, S.8). Vor dem Inkrafttreten dieses neuen Gesetzes hatte sich ein großer Teil dieser Personen nach der Einbürgerung wieder um den türkischen Pass bemüht und erhielt diesen auf relativ unkompliziertem Wege auch wieder zurück. Nun führt die Annahme der türkischen Staatsbürgerschaft nach einer Einbürgerung zum Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit (vgl.ebd S.9). Trotz der Einschränkungen durch das neue Staatsangehörigkeitsrechts gibt es heute zahlreiche Möglichkeiten einer doppelten Staatsbürgerschaft. So sind ein großer Teil der Türken, die vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes eingebürgert wurden, ohnehin Doppel-Staatsbürger. Auch Kinder binationaler Ehen können die doppelte Staatsbürgerschaft erhalten, oder wenn die Entlassung aus der bisherigen Staatsbürgerschaft aus bestimmten Gründen nicht möglich ist. Beispielsweise wenn ein ausländischer Staatsangehöriger, der in Deutschland aufgewachsen ist, seinen Wehrdienst im Herkunftsland noch nicht abgeleistet hat (vgl. Prümm 2003, S. 14). Außerdem gewährt die Türkei „mit der so genannten „pembe kart“ ihren ehemaligen Staatsbürgern einen Status, der diese „Nicht-Mehr-Türken“ mit Türken in der Türkei teilweise gleichstellt“ (Goeke 2007, S.18). Früher war die türkische Gesetzeslage so, dass die Aufenthalts-, Reise-, Arbeits-, Eigentums- und Erbrechte durch die Übernahme andere Staatsbürgerschaft eingeschränkt wurden oder sogar ganz entfielen. Eine Rückkehr der Eltern hätte bislang also für eingebürgerte Familienangehörige beispielsweise den Verlust ihrer türkischen Erbrechte bedeutet (vgl. Datenbank für Mobilität und Integration 2005). Trotz zahlreicher Neuerungen im deutschen Rechtssystem schöpft ein Großteil der türkischen Einwanderer in Deutschland den ihnen zustehenden Rechtsstatus nicht aus (vgl. Prümm 2003, S.16). Potenzielle Einbürgerungskandidaten werden z.B. durch langwierige Verfahren abgeschreckt. Eine weitere bedeutende Ursache für das relativ geringe Einbürgerungsinteresse ist wohl darin zu sehen, dass die türkischen Migranten (vor allem die mit unbefristeter Aufenthaltserlaubnis) im deutschen Wohlfahrtsstaat die gleichen sozialen Rechte (Kinder-, Arbeitslosengeld, Renten-, Kranken-, Unfallversicherung ect.) wie Staatsangehörige besitzen. Somit würde sich ihre Lage durch eine Einbürgerung nicht verbessern (vgl. ebd., S.16). Prinzipiell gilt für den Zugang zum bundesdeutschen Arbeitsmarkt bis heute das “Inländerprimat“, d.h. die Vergabe eines Arbeitsplatzes an eine Person mit ausländischem Pass ist nur dann möglich, wenn kein deutscher bzw. EU-Arbeitnehmer hierfür zur Verfügung steht. Allerdings gilt diese Regelung nicht für Ausländer mit sicherem Aufenthaltsstatus. Wer einen solchen Status besitzt, ist den deutschen Arbeitsplatzsuchenden rein rechtlich gleichgestellt. Auch lange Zeit nach dem Gastarbeiteranwerbestopp werden noch ausländische Arbeitnehmer für Deutschland benötigt. Zum Beispiel wurden, vor allem seit den 90er Jahren, gezielt Arbeitskräfte für den deutschen Bauarbeitsmarkt angeworben.
„Es konnten nun auf inländischen Baustellen zusätzlich ausländische Arbeitskräfte auf der Basis von Werkverträgen beschäftigt werden. (…) Unternehmen aus den Staaten Mittelosteuropas und der Türkei können Arbeitskräfte nach Deutschland entsenden, es handelt sich dann um Werkvertragsarbeitnehmer oder Kontingent- Arbeitskräfte.“ (Hillmann 2004, S.16)
1.4.5 Türkische (Re)Migranten in Augsburg /Istanbul
Augsburg ist eine vielkulturelle Großstadt. Der Anteil der Augsburger Bürger, die keinen deutschen Pass besitzen, ist mit 16,1 % dieses Jahr im deutschlandweiten Vergleich der Großstädte als relativ hoch zu bezeichnen. Die meisten Bürger mit Migrationshintergrund wohnen in den Planungsräumen Oberhausen, Herrenbach-Textilviertel, Hochfeld und Lechhausen (vgl. Stadt Augsburg, Statistik und Stadtforschung 2008). Als so genannte Gastarbeiter kamen die billigen Arbeitskräfte aus der Türkei, Italien, Kroatien und dem ehemaligen Jugoslawien in den 60er Jahren nach Augsburg, um in der chemischen Industrie, in der Textilindustrie („Vileda“), der Papierherstellung und bei namhaften Firmen wie MAN, KUKA Geld zu verdienen. Bekanntlich gestaltete sich der Aufenthalt in Deutschland nicht vorübergehend, sondern viele „Gastarbeiter“ blieben und ihre Familien wurden nachgeholt. Diese und ihre Nachkommen, meist schon in Deutschland geboren, leben seither in der Fuggerstadt. Die stärkste Migrantengruppe unter ihnen, ist mit 13.898 Mitbürgern, die der türkischen Staatsangehörigen. Das entspricht 32,3% aller, in Augsburg lebender, Ausländer (vgl. ebd. 2008). Im Vergleich dazu zeigt Abb.2 den Anteil der Türken in Europa bzw. in Deutschland, sowie die Zu- und Fortzüge von türkischen (Re)Migranten aus bzw. nach Deutschland. Demnach bilden Muslime in Augsburg, die zweitgrößte religiöse Gemeinschaft. In der Stadt befinden sich daher eine Vielzahl von Gebets- und Vereinsräumen, die mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Schwerpunkten geführt werden. In Augsburg-Oberhausen leben die meisten Menschen mit Migrationshintergrund, das Quartier wird neben dem Textilviertel schwerpunktmäßig von türkischstämmigen Migranten bewohnt und benennt einen Ausländeranteil von 29%. Der Gesamtprozentsatz an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Oberhausen beträgt im Schnitt sogar über 50%. Charakteristisch für den Oberhausener Wirtschaftsraum sind die zahlreichen Kleinbetriebe, ethnische Familienunternehmen und die noch immer starke Präsenz von großen Betrieben und Handelsketten. Mit über 8000 Beschäftigten alleine im Mechatronikbereich setzt Oberhausen nach wie vor den Schwerpunkt der industriellen Produktion der Stadt (vgl. Stadt Augsburg, Stadtteilgespräche 2007). Deutlich wird die gegenwärtige ethnische Heterogenität vor allem in Augsburgs Grundschulen, wo jedes zweite Kind aus einem anderen Kulturkreis stammt. Davon leben 47% in türkischsprachigen Familienkontexten (vgl. Stadt Augsburg Weissbuch 2006). Wenn man die Konfession betrachtet, bilden muslimische Kinder nach den katholischen bereits die zweitstärkste Gruppe.
Wenn man Eingebürgerte und die knapp 50.000 Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion dazu zählt, die ja statistisch nicht als Ausländer erfasst werden, wohnen in Augsburg etwa 90.000 Menschen mit Migrationshintergrund. Anders ausgedrückt, haben 30% aller Augsburger Bürger einen Migrationshintergrund. Für das Jahr 2015 liegt die Schätzung für den nicht-deutsch-stämmigen Bevölkerungsanteil bei 50% (vgl. ebd). Dieser multiethnischen Realität sowie dem negativen Entwicklungstrend einzelner Stadtviertel, wurde seit den letzten Jahren durch vielfältige Maßnahmen und Reaktionen Rechnung getragen. Dazu gehörten die Entwicklung eines Interkulturellen Stadtplans von Augsburg, zahlreiche „interkulturelle Hearings“, die Einrichtung des „Pax-Büros“, sowie eines interkulturellen, auf die unterschiedlichen Quartiere abgestimmten Sozialraummanagements. Weiter sind zu nennen die Gründung der „Interkulturellen Akademie Augsburg“ und Projekte wie „Smena“ und „Pusula“. Pusula, das Projekt des Jugendforums interkulturelle Integration, unter Beteiligung des Stadtjugendrings, des Deutschen Kinderschutzbundes und türkischer Vereine, hat sich zur Aufgabe gemacht den Dialog zwischen der Stadt und der türkischen Community voranzubringen und die Eigenverantwortung von jungen Eltern und Jugendlichen zu stärken. Dies geschieht durch die Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit als Freiwillige und Multiplikatoren bei diversen Teilprojekten zu Kultur, Jugendarbeitslosigkeit, Gesundheits- und Suchtfragen und bei Hausaufgabenhilfen. Darüber hinaus wurde ein Beratungs- und Ideentelefon in türkischer Sprache aufgebaut. 2006 wurde, als Maßnahme für ein kulturelles Leitbild der Stadt, ein Katalog mit diesen vorhandenen Projekten und Konzepten, sowie 20 Grundsätze für eine Integrationspolitik Augsburgs, im so genannten „Weißbuch: Eine Stadt für Alle“ festgelegt. Im selben Jahr trat Augsburg als bundesweit zweite Stadt der so genannten »Charta der Vielfalt« bei. Darin verpflichtet sich die Stadt im Bezug auf Angebote und Arbeitsplätze, die Chancen der Vielfalt in der Stadtbevölkerung anzuerkennen und gewinnbringend zu nutzen (vgl. Stadt Augsburg Weissbuch 2006).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: http://www.isoplan.de/mi/tr/k2005-1.pdf
Abb.2: Anteil der türkischen Bevölkerung in Europa mit Zu- und Fortzügen aus/nach Deutschland
Die meisten Remigranten wandern nicht (zurück) in die östlichen Gebiete der Türkei, sondern bevorzugen die Wirtschaftszentren, von denen das wichtigste nach wie vor der Großraum Istanbul ist, gefolgt von Ankara und Izmir. In diesen Großstädten lässt sich, bei entsprechendem Einkommen, ein Lebensstandard verwirklichen, der ungefähr dem in Deutschland entspricht (vgl. Datenbank Mobilität und Integration 2005). Das kosmopolitische Istanbul ist, mit seinen offiziell rund 12 Millionen Einwohner, realistische Einschätzungen liegen bei 15 Mio. Einwohnern oder mehr, weltweit die einzige Megastadt, die auf zwei Kontinenten liegt. Muslimische Welt prallt hier auf europäische Lebenswelten. Anders ausgedrückt, Orient berührt Okzident (vgl. Thumann 2006).
„ İstanbul ist sowohl hinsichtlich der Einwohnerzahl und Fläche, als auch in Hinblick auf Wirtschaft, Handel, Kapital und Kultur die größte Stadt der Türkei. Nahezu die Hälfte des gesamten türkischen Steueraufkommens wird in dieser Stadt und ihrer Umgebung erwirtschaftet. İstanbul verfügt über den größten Importhafen der Türkei, ist Ausgangs-punkt der wichtigen Meeresverbindungen und verfügt über Luftverbindungen in Länder überall auf der Welt, und wahrt somit seine Eigenschaft als eine bedeutende Metropole.“ (vgl. Dôgan 2008, S.30)
Im Jahr 2006 hat die EU-Jury in Brüssel sogar beschlossen, die Stadt Istanbul zur Kulturhauptstadt 2010 zu ernennen (vgl. Deutsches Generalkonsulat Istanbul). Leider hat die Stadt, vor allem wegen der enormen Zuwanderung von Arbeitssuchenden aus vorwiegend ländlichen und wirtschaftlich rückständigen Landesteilen in den letzten Jahrzehnten, mit sozialer Fragmentierung, Polarisierung, sowie erheblichen Umwelt- und Verkehrsproblemen zu kämpfen. Wie die meisten Megacities lebt Istanbul mit seinen extremen Gegensätzen, von Gecekondus der armen, bildungsfernen Bevölkerung am ausufernden Stadtrand, bis hin ist zu noblen Banken und Konzernzentralen und drängt darüber hinaus mit aller Macht in die Zukunft von morgen. So glauben, laut einer Studie der Hamburger Körber-Stiftung, die Hälfte aller Türken, dass die positiven Veränderungen in ihrem Land überwiegen, während nur 16 Prozent der Deutschen die gleichen Aussage über das eigene Land machen (vgl. Thumann 2006). Im Rahmen der Globalisierung scheint Remigration bzw. Pendelmigration an Bedeutung zu gewinnen. Das ist z.B. an der Diskussion um „brainreturn“, der Rückkehr der besser ausgebildeten Fachkräfte, zu sehen (vgl. Wolfart 2002,S.4).
„ Dazu passt die (…) Frage, warum denn eine wachsende Zahl von jungen, gut ausgebildeten Deutschtürken neuerdings in die Türkei zieht? Nicht in das anatolische Dorf des seligen Großvaters, sondern in die boomenden Metropolen des türkischen Westens. “ (Thumann 2006, S.1)
Die Organisatorin eines „Rückkehrerstammtisch“ in Istanbul sagte dazu in einem Interview der Berliner Zeitung vom 13.Juni 2008, die wirtschaftliche Lage der Türkei sei eine große Motivation für den Umzug.
"Besser gesagt die wirtschaftliche Lage Istanbuls, denn die Deutschländer kommen hauptsächlich hierher und nicht in den Rest der Türkei. Hier boomt die Wirtschaft und diese Stadt ist ein verrückter und lebendiger Schmelztiegel, der gerade jungen Leuten viel bietet“. (Leipert 2008)
In bestimmten Bereichen ließe sich sogar wesentlich besser verdienen als in Deutschland. Für gut ausgebildete Rückkehrer gibt es in der Türkei in einigen Branchen recht gute Berufschancen. Beispielsweise suchen viele deutsch-türkische Unternehmen qualifizierte Rückkehrer mit guten Deutsch- und Türkischkenntnissen und mit in Deutschland erworbenem Know-How. Die Weltoffenheit und Kontakte zu Deutschland sind vor allem für den deutsch-türkischen Handel, bei Tochterfirmen deutscher Unternehmen oder im Tourismus von Vorteil. Andere Betriebe stellen jedoch ungern Rückkehrer ein, weil eine Verwertbarkeit der beruflichen Erfahrungen bisweilen begrenzt gegeben ist. Dazu kommt eine meist an deutsche Arbeitsverhältnisse orientierte, hohe berufliche und finanzielle Erwartungshaltung (vgl. Datenbank für Mobilität und Integration 2005). Die meisten deutschen Tochterfirmen und Joint Ventures in Istanbul sind tätig im Handel (darunter allerdings viele kleine Im- und Exportfirmen), im Energiesektor und im verarbeitenden Gewerbe (Bekleidung, Fahrzeuge, Maschinenbau, Chemie und Nahrungsmittel). Zu den größten gehören AEG Eti Elektrik Endüstrisi, Bayer Türk Kimya., Türk Henkel Kimyevi Maddeler, Türk Hoechst, M.A.N. Kamyon ve Otobüs, und Mercedes-Benz Türk (vgl. ebd.). Gemäß Leipert (2008), ist die Anzahl der Remigranten, die derzeit in der Stadt Istanbul leben, öffentlich nicht bekannt (vgl. ebd). So gibt es keine genauen (zugänglichen) Daten über Umfang, demographische Zusammensetzung, Verbleib und Integrationserfolg von türkischen Remigranten, weder bei deutschen, noch bei türkischen Stellen. Auch wird der Informationsstand der Rückkehrwilligen über die Bedingungen allgemein als mangelhaft eingeschätzt. Es bestünden zwar in Deutschland, wie auch in der Türkei einige staatliche und private Beratungsangebote, die jedoch auch nur über unzureichendes Wissen verfügen (vgl. Wolfart 2002, S.12). Die Kurzzeit-Studie des „Zentrums für Türkei-Forschung Essen“ fand heraus, dass die Frage, unter welchen Umständen die ehemaligen Rückkehrerinnen und Rückkehrer in der Türkei leben und ob sie mit den dortigen Lebensbedingungen zurechtkommen, findet leider nur wenig Aufmerksamkeit in der aktuellen Politik der Türkei und der Bundesrepublik (Enquete-Kommission Demographischer Wandel, 1999, zitiert in Wolfahrt 2002,S. 4-5). Im Jahr 2003 hat die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung aber ein Büro für Rückkehrerberatung in Istanbul eingerichtet (vgl. Datenbank für Mobilität und Integration 2005). „Anadolu Lisesiler“ zu Deutsch Anatoliengymnasien, wie z.B. das „Üsküdar Anadolu Lisesi“ in Istanbul, wurden ursprünglich für die Remigrantenkinder eingerichtet. Nach wie vor werden diese weiterführenden staatlichen Schulen mit deutschsprachigem Fachunterricht bevorzugt und zählen zu den angesehensten Schulen in der Türkei. Ihr Abschluss berechtigt außerdem zum Studium an deutschen Hochschulen. Die deutsche Schule Istanbul ist teuer und die Aufnahme äußerst begrenzt, wobei sowohl türkische als auch nicht-türkische Schüler unterrichtet werden. Von Deutschland werden die Schulen durch die Entsendung von deutschen Lehrern gefördert (vgl. ebd).
II. Forschungsansatz und Untersuchungsrahmen
1. Forschungskonzept
Forschungsziel ist es, die vielfältigen Aspekte und Formen transnationaler Räume, bzw. Folgen für die beteiligten Individuen zu analysieren. Die Arbeit möchte zur Präzisierung und Ausdifferenzierung des transnationalen Forschungsansatzes beitragen und etwaige Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten bzw. Bestätigungen zwischen diesen Fallstudien und der wissenschaftlichen Debatte aufdecken. Verschiedene Fragestellungen ergeben sich bereits beim Durchgang der vorhandenen theoretischen Abhandlungen zum Thema Transnationalismus, diese finden sich daher im Interviewleitfaden wieder.
- Welche Formen grenzüberschreitender Mobilität lassen sich bei Familien mit Migrationshintergrund beobachten und welche Bedeutung haben diese Formen für das Raumverständnis der einzelnen Akteure?
- Mit welchen Mechanismen operieren die beteiligten Personen, Geld, Vertrauen, Solidarität ect. ?
- Welche Auswirkungen haben dichte transnationale Bindungen für die Integration der Migranten in Deutschland, für die Remigranten in der Türkei (vgl. dazu Faist 2000b)?
- Welchen Einfluss haben unterschiedliche rechtliche, ökonomische und soziale Rahmenbedingungen auf die Bildung und Nutzung transnationaler sozialer Räume?
- Die Frage nach der Selbstpositionierung beinhaltet auch die Frage, welche Vorstellungen die Probanden überhaupt von ihrem Leben haben, ihre Erfahrungen und Lebensrealitäten, wie sie sich selber definieren und welche Rolle eventuelle Erfahrungen von Fremdzuschreibungen spielen.
- Eine besondere geographische Frage ist, ob die Lebensläufe zunehmend unabhängig von Orten und Nationen werden.
- Inwiefern korreliert ein höherer Bildungsstand mit der Ausbildung transnationaler Lebenswelten?
Im empirischen Mittelpunkt der Arbeit stehen einzelne Fallbeispiele. Ein Beweis von Theorien kann aufgrund der geringen Fallzahl natürlich nicht erbracht werden, vielmehr soll eine Auseinandersetzung mit der Thematik durch die Darstellung der beobachteten Lebenswelten der befragten (Re-)Migranten, sowie der Einordnung dieser Lebensstile in die theoretische Debatte zur transnationalen Migration erfolgen. Die Entscheidung, auf persönliche Migrations- und Lebensgeschichten einzugehen, erlaubt zudem abstrakte Theorien anhand von Beispielen zu veranschaulichen und die Innenperspektive der Individuen zu verstehen.
2. Empirische Erhebung
2.1 Empirische Instrumente
2.1.1 Methoden der qualitativen Sozialforschung
Das Ziel dieser Studie besteht darin, die individuellen Lebensentwürfe der ausgewählten Migranten, aus deren Sicht darzustellen. Wenn ein so vielschichtiges Phänomen wie Transnationalität untersucht wird, muss eine Forschungsstrategie gewählt werden, die es ermöglicht, subjektive Sichtweisen und Meinungen möglichst umfassend und differenziert abzubilden. Die Anwendung von qualitativen Interviews schien passend, da es vorrangig darum geht, von der Relevanz, dem Wissen und Handlungsmustern der Befragten auszugehen statt sie durch theoretisch vorgefertigte Begriffe und Antwortmöglichkeiten zu beeinflussen oder gar in ihren Ausführungen zu hemmen (vgl. Mayring 2002, Flick 1995, Lamnek 1995).
Da die, in der vorliegenden Arbeit angewandte, Methode qualitativ ist, scheint es angebracht, erst einige allgemeine Aspekte qualitativer Sozialforschung darzustellen. Viele Studien über Migranten operieren nach wie vor mit rein quantitativen, standardisierten und statistischen Methoden sowie einer möglichst großen, repräsentativen Fallzahl. So kann jedoch auf individuelle Lebensentwürfe und Entscheidungen nicht angemessen eingegangen werden. Migranten werden in der öffentlichen Debatte oft nur auf Zahlengrößen und Prozentangaben reduziert und damit Bestandteil von einer undifferenzierten Masse (vgl. Bräunlein/Lauser 1997). Spezifisches Forschungsinteresse an einzelnen Lebensläufen wird jedoch immer nötiger, „ weil immer deutlicher wird, dass statistische Durchschnittswerte in dem Maß an Aussagekraft verlieren, wie die Pluralisierung von Lebensläufen voranschreitet“ (Goeke 2007, S.13).
Das Forschungsinteresse ist hier nicht primär von Hypothesen geleitet, sondern konzentriert sich auch auf die, im Interview vorgefundenen, Erkenntnisse und Interpretationen. So sollen sich Hypothesen und theoretische Einschätzungen erst im Verlauf des Forschungsprozesses konkretisieren oder überhaupt erst entstehen (Flick, 1995). Das Prinzip der Offenheit besagt auch, dass während des Interviews auch auf unerwartete Aspekte eingegangen werden darf. Es gelten jedoch noch andere Prinzipien. So gilt das Prinzip der Reflexivität von Gegenstand und Analyse, das heißt, dass sich Inhalt und anschließende Interpretation aufeinander beziehen sollen (vgl. Mayring, 2002, Witzel 2000). Bei qualitativen Methoden geht es, ohne Anspruch auf Repräsentativität, um die Frage nach den Forschungszielen. Um das Beschreiben, Interpretieren und Verstehen von Zusammenhängen, die Aufstellung von Klassifikationen oder Typologien, die Weiterentwicklung von Hypothesen und Erkundung von Ursachen. Das Hauptaugenmerk liegt also auf inhaltlicher Repräsentativität, wohingegen zahlenmäßige Repräsentativität und Generalisierung kaum eine Rolle spielen (vgl. Flick 2002; Lamnek 1995). Anders als bei der reinen Zufallsstichprobe quantitativer Erhebungen, bedarf es einer kriteriengestützten Fallauswahl und Kontrastierung, um eine angemessene Zusammenstellung der Untersuchungsgruppe zu erhalten (vgl. Kelle/Kluge 1999). „Das Ziel (…) besteht (…) nicht (...) darin, ein (...) maßstabsgetreu verkleinertes Abbild einer Grundgesamtheit herzustellen, sondern darin, theoretisch bedeutsame Merkmalskombinationen bei der Auswahl der Fälle möglichst umfassend zu berücksichtigen“(ebd., S.53). Die Haupterzählung eines narrativen Interviews wird meist durch eine allgemein gehaltene Fragestellung, das Stimuli, eingeleitet. In der späteren Nachfragephase können dann Unklarheiten, nur angedeutete Sachverhalte oder Lücken im Erzählten, besprochen werden. Der entscheidende Nachteil bei der Auswertung qualitativer Interviews besteht darin, dass das Forschungsmaterial unterschiedlicher Qualität sein kann, außerdem schwieriger kontrollierbar und vergleichbar ist. Ein weiteres Problem ist, dass das Interview nur eine Verhaltensstichprobe der Probandenauswahl liefert (vgl. ebd). Für das qualitative Interview kommen nur solche Personen in Frage, die einerseits über die nötige sprachliche und soziale Kompetenz verfügen und andererseits bereit sind, über ihr Leben zu sprechen. Dafür sind die Informationen mit hoher Wahrscheinlichkeit gültiger, umfassender und damit bedeutungsvoller als bei standardisierten Vorgehen (vgl. Hopf 2000). „Das Festhalten an der subjektiven Perspektive bietet die einzige, freilich auch hinreichende Garantie dafür, dass die soziale Wirklichkeit nicht durch eine fiktive, nicht existierende Welt ersetzt wird, die irgendein wissenschaftlicher Beobachter konstruiert hat“ (vgl. Schütz 1977 zit. in Stäheli 2006, S45). Außerdem gilt es den Kulturkreis der befragten Personen und damit verbunden andere Erzähl- und Kommunikationsregeln, zu beachten (vgl. Hopf, 2000).
Abschließend möchte ich noch meine persönlichen Gründe für die Wahl der Erhebungsmethode in dieser Diplomarbeit darlegen. Das Interesse war besonders groß, da ich bislang im Rahmen von universitären Erhebungen, Erfahrungen mit quantitativen Verfahren machen konnte. Während meines Praktikums beim Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Institut habe ich jedoch bereits erste Einblicke in die qualitative Forschungsarbeit groß angelegter Studien zu Migranten in Deutschland gewinnen dürfen und daher interessierte es mich diese Methode eigenhändig anwenden zu können.
2.1.2 Das problemzentrierte Interview
In meiner empirischen Erhebung werde ich mit dem problemzentrierten Interview arbeiten, welches eine Variante des narrativen Interviews darstellt. Als eigenständige Interviewtechnik wurde es 1982 von Andreas Witzel entwickelt. Unter diesem Begriff sollen sämtliche Formen der offenen, halbstrukturierten Befragung zusammengefasst werden. (Mayring, 2002). Das problemzentrierte Interview lässt sich, anders als sein narrativer Vertreter auch hypothesenprüfend einsetzen. Der Forscher kann hier individuelle und kollektive Bedingungsfaktoren seiner Fragestellung ergründen und seine theoretischen Vorkenntnisse überprüfen bzw. gegebenenfalls anpassen (vgl. Friebertshäuser, 1997). Erlaubt ist während des Interviews unter anderem Nachfragen, Stellen von Verständnisfragen und Interpretation des vom Interviewpartner Gesagten (vgl. ebd). Bei dieser Interviewvariante dreht es sich primär, wenn auch nicht ausschließlich, um eine bestimmte, gesellschaftliche Problem- oder Fragestellung, die in dieser Arbeit die Frage nach dem Transnationalitätsanspruchs der Probanden, bzw. ihrer Familie, darstellt. Da aber auch die Lebensentwürfe der einzelnen Befragten im Allgemeinen veranschaulicht werden sollen, würde ein gänzlich narratives Interview womöglich die angestrebten Informationen nicht erbringen, da aufgrund von Umfang und Komplexität des Themas eine Steuerung notwendig ist (vgl. Witzel 2000). Zur Datenerhebung auf Grundlage des problemzentrierten Interviews gehören verschiedene Bestandteile. Hier ist zunächst einmal der Kurzfragebogen zu nennen, der zur Ermittlung von biographischen Daten der Befragten dienen soll. Diese allgemeinen Sozialdaten müssen dann nicht mehr während des Interviews ermittelt werden (vgl. ebd). Ein wichtiges Instrument des problemzentrierten Interviews ist der Leitfaden. Darin finden sich die bislang vorhandenen theoretische Vorkenntnisse des Forschers ebenso wie seine Annahmen und Konzepte, aufgegliedert in zusammengehörige Themenbereiche. Im Leitfaden sind die Forschungsthemen lediglich als Gliederungshilfe und Orientierungsrahmen zur Sicherung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse festgehalten (vgl. ebd). Die Fragen können aber situationsspezifisch geändert oder dem Kontext genauer angepasst werden. Folglich kann der Leitfaden auch als Resultat einer wissenschaftlichen Erarbeitung der untersuchten Thematik verstanden werden (vgl. Schmidt-Grunert, 1999, S. 43).
Die Entwicklung meines Interviewleitfadens wurde unter Berücksichtigung mehrerer Komponenten vorgenommen. Den Schwerpunkt bildeten Themen zu transnationalen, plurilokalen Beziehungs-, Mobilitäts- und Identitätsstrukturen. Daneben wurden Aspekte wie Aufenthalts- bzw. Remigrationsabsichten, Religiosität, Werteauffassung und rechtlicher Status der Befragten angesprochen. Weitere empirische Indikatoren für das Bestehen transnationaler sozialer Räume wurden ebenfalls erfragt, wie z.B. Geldüberweisungen, Loyalitäten, finanzielle Abhängigkeit, allgemeine Zirkulation von Gütern und grenzüberschreitende Kommunikationsmittel der Befragten. Daneben wurden der wirtschaftliche Anreiz in Deutschland bzw. der Türkei, sowie erworbene berufliche Qualifikationen überprüft. Darüber hinaus wurde gefragt, ob die Probanden Fähigkeiten besitzen, die nach eigener Einschätzung ein Pendelleben ermöglichen. Im Weiteren wurde die Rolle des Partners als auslösender und aufrechterhaltender Faktor des Pendelns besprochen. Weitere Motive sollten benannt und gewichtet werden.
Zum ersten Einsatz kam der Leitfaden (siehe Anhang A1) im Rahmen einer Pilotphase, um den Themenkatalog nachbessern zu können, aber auch um mich selbst in die Rolle der Interviewerin einzufühlen und mit dem Verlauf vertraut zu machen. Im Anschluss an jedes Interview wurden Gesprächsprotokolle, so genannte Postskripte erstellt. Denn es gibt noch weitere Elemente, die für die Auswertung wertvolle Informationen liefern können. So z.B. bestimmte Rahmenbedingungen, wie Situationseinschätzungen, Stimmung und Dynamik des Interviews (vgl. Witzel 2000). Alle Interviews wurden mittels eines Tonbandgerätes vollständig aufgenommen. So konnte ich mich völlig auf das Gespräch, sowie auf nonverbale Gesprächsinhalte der befragten Migranten konzentrieren. Meine Gesprächspartner waren in der Regel nicht abgeneigt, dass ich das Interview auf Band festhalte, dennoch gestaltete es sich schwierig, für die verschiedenen Interviewsituationen (gerade in Istanbul) geeignete Räumlichkeiten zu finden, in denen keine allzu großen Störungen durch Nebengeräusche stattfanden, oder gar andere Personen unbedingt mitreden wollten.
Nun zum Ablauf des Interviews selbst. Das jeweilige Interview begann mit der kurzen Schilderung des Forschungsvorhabens und Punkten wie Anonymisierung, Verwendung der Tonbandaufnahme und Zeitbeanspruchung durch das Interview. Nach dieser einleitenden Phase folgte der zentrale Teil des Interviews. Ich begann meine Interviews, je nach Vorkenntnissen, mit Fragen zur Migrationsgeschichte oder zum rechtlichen Status der Probanden. Von der Staatsangehörigkeit zu Beweggründen bzw. Vor- und Nachteilen der jeweiligen Staatsbürgerschaft hinzuführen, schien mir als Einleitung passend, da diese Fragen weitgehend konkret und einfach zu beantworten waren, jedoch bereits durch die Angabe der Beweggründe in die subjektive Erfahrungswelt des Befragten übergegangen werden konnte. Ihre Antworten führten die Probanden hier auch meist von selbst zu weiteren Themen meines Leitfadens.
Das problemzentrierte Interview beinhaltet Kommunikationsstrategien, wie den Gesprächseinstieg, spezifische Sondierungsfragen und „Ad-hoc-Fragen“ (vgl. Flick 2002, S. 135). Ad-hoc-Fragen wurden im Laufe der Interviews notwendig, wenn bestimmte Themenbereiche, die auch die Vergleichbarkeit der Interviews sichern, von den Interviewten ausgeklammert wurden (vgl. Witzel 2000).
2.2 Definition der Untersuchungsgruppe
Da möglichst nur relevante Fälle berücksichtigt werden sollten, musste vorab der Frage nachgegangen werden, welche Personen potenziell Informationsquellen für diese Studie liefern können und welche Probanden helfen könnten, das Phänomen des Transnationalismus besser zu verstehen, bzw. bestehende wissenschaftliche Erkenntnisse zu bestätigen, diese gegebenenfalls zu ergänzen oder sogar neue Thesen aufstellen zu können (vgl. Lamnek 1995). Zur Größe des qualitativen Samples gilt nach Kelle und Kluge, je enger selektiert wird, desto weniger Interviews werden benötigt (vgl. ebd. 1999).
Wobei dem Prinzip der minimalen und maximalen Kontrastierung im Sinne des theoretical samplings nach Glaser und Strauss gefolgt wurde. Nämlich möglichst nach ähnlichen und abweichenden Fällen zu suchen, um das Forschungsfeld weitestgehend breit zu erschließen (vgl. Flick 2002). Gemäß der Theorie von Glaser und Strauss wurden die einzelnen Interviewteilnehmer möglichst auch nach dem Kriterium der theoretischen Sättigung ausgewählt, d.h. ob ihre Interviews neue Erkenntnisse hervorbringen (vgl. ebd, S.97ff; Glaser/Strauss 1967). Außerdem orientiert sich die Fallzahl nach der Dimension und dem Ziel der Studie, so dass es keine empfohlene Anzahl von Interviews gibt[4] (vgl. Kelle/Kluge 1999).
Im Hinblick auf diesen theoretischen Verweis, wurde die Zusammensetzung der Interviewten daher so gewählt, dass Daten von Menschen verschiedenen Alters, unterschiedlicher „Einwanderergenerationen“ und daher unterschiedlichen Migrationsverläufe, sowie verschiedener Familienkonstellationen gewonnen werden können. In dieser Untersuchung sollten jedoch nur jene in Deutschland lebenden Migranten zu Wort kommen, die nach dem Integrationsmodell von Esser, vor allem in struktureller Hinsicht, als gelungen in die deutsche Gesellschaft eingebunden gelten können. Das heißt, sie leben schon lange in Deutschland, manche sind sogar hier geboren, haben Sozialkontakte zu Deutschen, besitzen gute Sprachkenntnisse und weisen alle einen mittleren bis hohen Bildungsgrad auf. Auch für die, in Istanbul Befragten, waren vor allem die Kriterien der strukturellen Assimilation ausschlaggebend. Zum einen hatte die Auswahl pragmatische Gründe, da ein gewisser Kenntnisstand der deutschen Sprache bzw. ein guter Bildungshintergrund für eine gehaltvolle qualitative Erhebung und eine gute Verständigung während der Interviews, unumgänglich ist. Zum anderen liegt die Vermutung nahe, dass diese Menschen eine geradezu exemplarische Gruppe in Bezug auf die Vielfalt persönlicher Geschichten von räumlicher Mobilität, (Mehrfach-) Migration, grenzüberschreitender Beziehungsnetze und komplexer Muster der Identifikation, also Transnationalismus darstellen. Außerdem wurden diese „Inländer“, zum Teil schon deutsche Staatsbürger, in vielen vorhergehenden Studien vernachlässigt (vgl. Keim, 2003, S.88).
Durch mein Praktikum in einem Integrations- und Sprachförderungsprojekt des Deutschen Kinderschutzbundes Augsburg kam ich mit zwei meiner späteren Interviewpartner in Kontakt. Die weiteren Kontakte funktionierten sowohl in Augsburg, als auch während meines Forschungsaufenthalts in Istanbul, nach dem Schneeballverfahren. Über erste Kontaktpersonen lernte ich weitere Interviewpartner kennen, die mir wiederum die Verbindung zu anderen Migranten ermöglichten. Dieses System erleichterte den Zugang zu den Befragten, da eine vertrauensvolle, offene und lockere Atmosphäre geschaffen werden konnte. Auch Witzel empfiehlt die Vermittlung der Probanden durch Personen ihres Vertrauens (vgl. Witzel 2000). Beim Schneeballprinzip besteht jedoch die Kritik einer Unausgewogenheit der Stichprobe (vgl. Lamnek 1995). Da in dieser Erhebung aber nach der Strategie der theoretischen Sättigung (vgl. Glaser/Strauss 1967) vorgegangen wurde, scheint diese Gefahr weitestgehend gebannt.
Befragt wurden schließlich in Augsburg und Istanbul insgesamt 19 Personen, wobei 12 Interviews von (Re-) Migranten und Migrantinnen, im Alter von 19 bis 67 Jahren, protokolliert und ausgewertet wurden. Die anderen Fälle stellten sich für diese Studie (auch im Hinblick auf die theoretische Sättigung), als nicht relevant und inhaltlich verwertbar heraus.
In Augsburg war es mir möglich, sieben Interviewpartner zu finden, die meinen Forschungskriterien entsprachen, Hamdine, Sevda, Yasemin, Özlem, Sevim, Erol und Ali. Während meines Forschungsaufenthalts in Istanbul konnte ich fünf Interviews führen, mit Nurcihan, Leyla, Ceren, Ömid und Süleyman. Die Auswertung einer größeren Zahl von Interviews, war im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten (siehe dazu auch Keim 2003, S.89). Meine Auswahl kann und soll in keiner Weise für die Gruppe der türkischstämmigen Migranten und Migrantinnen repräsentativ sein. Viele Migranten sind nicht in dem Maße integriert, wie die Befragten in dieser Studie. Manche auch trotz, oder sogar wegen ihres guten Bildungshintergrunds. Repräsentativität ist in dieser Untersuchung auch nicht das Ziel, vielmehr geht es darum, in Fallstudien die verschiedenen Lebenswelten der Interviewten herauszuarbeiten.
2.3 Auswahl der Untersuchungsgebiete
Dass ich meine Erhebung in Augsburg durchführen würde, lag, auf Grund meiner Arbeit in einem Augsburger Integrations- und Sprachförderungsprojekt und meines Studiums an der Universität Augsburg, nahe. Da ich mich aber auf oben genannte Untersuchungsgruppe spezialisieren wollte, wurde schnell klar, dass es erkenntnisreicher sein würde, das Untersuchungsgebiet auch auf die Türkei und hier speziell auf Istanbul auszudehnen, um die Lebenswelten dort besser verstehen zu können und um der Frage nachzugehen, wieso, in die deutsche Gesellschaft integrierte Migranten nicht nur beschließen, ihren Lebensmittelpunkt in die Türkei zu verlagern, sondern bereits (zurück-) gegangen sind, bzw. zwischen beiden Ländern pendeln. Im Hinblick auf den theoretischen Bezugsrahmen liegt zudem die Vermutung nahe, dass in Türkei und in Deutschland lebende Türken, trotz gleicher ethnischer Herkunft und Migrationsgeschichte, verschiedene Lebenswelten und Identitätsbilder konstruieren. Daher ist es auch sinnvoll diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die bereits schon einmal in Deutschland gelebt haben, jedoch in die Türkei (zurück-) gezogen sind. Hier sollen auch in Deutschland geborene Migranten dazu zählen, die ja im eigentlichen Sinne nicht remigrieren.
Auch Goebels und Pries meinen dazu: „ Feldforschung im Rahmen von Transmigrationsstudien sollten sich auf mehrere soziale Orte erstrecken “ (Goebels/Pries 2003, S.38). Ganz bewusst wurde die türkische Stadt Istanbul als Erhebungsstandort gewählt, da sie von jeher als Sinnbild der modernen Türkei gilt und dort höchstwahrscheinlich der Zugang zu Menschen mit Bildungshintergrund, die transnational agieren, am ehesten gegeben ist. Zudem bietet die Stadt innerhalb der Türkei wohl am meisten Entfaltungsmöglichkeiten und Anreize für Rückkehrer aus dem Westen.
[...]
[1] In Zusammenhang mit der Kulturkonfliktthese sei auch auf Samuel Huntingtons populäres Werk „Kampf der Kulturen“ (1996) verwiesen.
[2] Eine gute, ausführliche Zusammenfassung der klassischen sowie aktuellen Migrationstheorien findet sich bei Pries „Internationale Migration“ (2001) und Haug „Klassische und neuere Theorien der Migration“ (2000).
[3] Mangels einer adäquaten Bezeichnung, werden in dieser Arbeit die Begriffe Herkunfts- bzw. Ankunftsgesellschaft oder Herkunfts- bzw. Ankunftsland verwendet, obwohl man im Hinblick auf Transmigration genau genommen nicht zwangsläufig von einem „Herkommen“ bzw. „Ankommen“ sprechen kann.
[4] Vgl. hierzu wissenschaftliche Studien gleicher Methodik, z.B. von Keim, S. (2003), „So richtig deutsch wird man nie sein…“, mit fünf Interviews, Straßburger (1992), „Offene Grenzen für Remigranten“, mit acht Interviews und Wolbert, B (1984), „Migrationsbewältigung. Orientierungen und Strategien“, mit drei Interviews.
Details
- Titel
- Transnationale Lebenswelten türkischer Migranten als Folge geographischer Mobilität
- Untertitel
- Eine qualitative Studie in Augsburg und Istanbul
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2008
- Seiten
- 246
- Katalognummer
- V226985
- ISBN (eBook)
- 9783836631891
- Dateigröße
- 1256 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- transnationalismustheorie anwerbeabkommen migrationsmotive türken soziale netzwerke
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2008, Transnationale Lebenswelten türkischer Migranten als Folge geographischer Mobilität, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/226985
- Angelegt am
- 26.6.2009

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.