Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos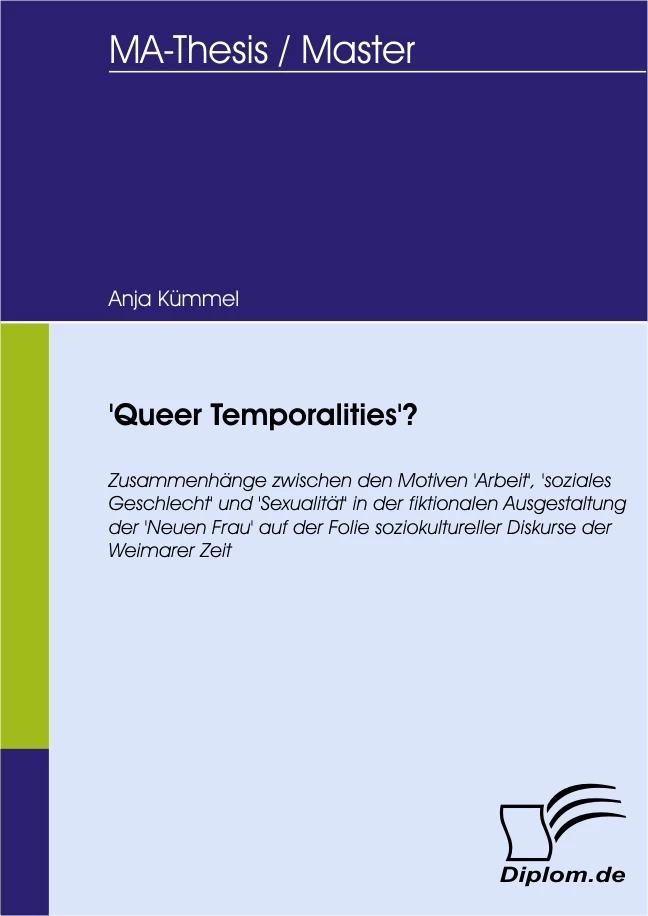
'Queer Temporalities'?
Masterarbeit, 2005, 84 Seiten
Geschichte Europa - and. Länder - Neuzeit, Absolutismus, Industrialisierung
Autor

Kategorie
Masterarbeit
Institution / Hochschule
Universität Hamburg (Wirtschaft und Politik, Gender und Arbeit)
Note
1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Forschungsstand und Forschungsinteresse
1.2. Fragestellungen
2. Begriffsbestimmungen und theoretische Grundlagen
3. Die „Neue Frau“ – Konstruktionen und soziale Realitäten
3.1. Die neue Sexualmoral
3.1.1. Triebsublimation durch Arbeit
3.1.2. Befreite Sexualität?
3.2. Erwerbstätigkeit: Chancen und Grenzen
3.2.1. Weibliche Angestellte
3.2.2. Künstlerinnen
3.3. Der Vorwurf der „Vermännlichung“
4. Homosexuelle Frauen im Diskurs der 1920er Jahre
4.1. „Garçonne“ oder „Drittes Geschlecht“? Zum Selbstverständnis lesbischer Frauen
4.2. „Autonomie“, „Wissen“, „Schöpfen“ – Angelpunkte lesbischer Identität?
4.3. Strange Bedfellows: „Freundinnen“ und „Neue Frauen“
5. Frauenliteratur in der Weimarer Republik
5.1. Erkenntnisinteresse und Herangehensweise
5.2. „Arbeit“, „soziales Geschlecht“ und „Sexualität“ in zwei Romanbeispielen
5.2.1. Grete von Urbanitzky: „Sekretärin Vera“ (1930)
5.2.2. Grete von Urbanitzky: „Der wilde Garten“ (1928)
5.3. Vergleichende Romananalyse
5.3.1. Queer spaces: Utopische Entfaltungsräume
5.3.2. Queer times: Der verlorene Patriarch
5.3.3. Queer professions: Existenzmöglichkeiten jenseits von „Produktion“ und „Reproduktion“
6. Schlussbetrachtung
Literaturliste
Anhang I: Inhaltsangabe zu „Sekretärin Vera“
Anhang II: Inhaltsangabe zu „Der wilde Garten“
1. Einleitung
Die Weimarer Republik als eine Zeit des radikalen kulturellen, sozialen und politischen Wandels stellt ein für die historische Geschlechterforschung nach wie vor höchst relevantes Feld dar. Exemplarisch für den strukturellen Wandel der Geschlechterdynamik sei hier der verstärkte Eintritt von Frauen ins Erwerbsleben, das postulierte „neue Selbstbewusstsein“ der modernen Frau, oder auch die „neue Sexualmoral“ genannt. Gleichzeitig schaffte die relative Liberalität der 1920er Jahre (zumindest in urbanen Räumen) ein Klima, in dem sich Frauen zum ersten Mal als „homosexuell“ konstituieren konnten. Vor allem in der Metropole Berlin blühte eine facettenreiche homosexuelle Subkultur auf; in bestimmten Gesellschaftsschichten wurde das Spiel mit Geschlechterrollen, Homo- und Bisexualität regelrecht „chic“. Ein neues Bewusstsein über Geschlecht und Sexualität, über öffentliches Auftreten und weibliche Autonomie bildete sich heraus. Für den sich vollziehenden Strukturwandel waren die Begriffe „Arbeit“, „soziales Geschlecht“ und „Sexualität“ von zentraler Bedeutung.
Demnach überrascht es nicht, dass sich in der Zeit von 1918-1933 ein Großteil der literarischen Neuerscheinungen mit den im Umbruch begriffenen Geschlechterverhältnissen beschäftigte. So war die „Neue (erwerbstätige) Frau“ ein beliebtes und immer wiederkehrendes Thema im Roman der Weimarer Republik. Parallel dazu entstand erstmals eine signifikante Anzahl von Texten, die sich relativ offen mit dem Thema „lesbische Liebe“ auseinandersetzten.
1.1. Forschungsstand und Forschungsinteresse
Mein Interessenschwerpunkt ist die fiktionale Ausgestaltung der „Neuen Frau“ im Autorinnen-Roman der Weimarer Republik in Bezug auf die identitätsstiftenden Kategorien „Arbeit“, „Geschlecht“ und „Sexualität“. Bislang wurden diese Teilaspekte des Autonomieverständnisses der „Neuen Frau“ zumeist voneinander isoliert betrachtet. Derartige kategoriale Trennungen tendieren nicht nur dazu, Dichotomien zu reproduzieren, sondern ignorieren überdies die Vielfalt sowohl literarischer Inszenierungen als auch unterschiedlicher Lebensrealitäten. Anliegen dieser Arbeit ist es, mittels neuer Erkenntnisse aus der gender-/queer theory die komplexe wechselseitige Beeinflussung der genannten Parameter der Fremd- und Selbsteinordnung anhand literarischer Beispiele genauer zu ergründen.
Zum Thema „Neue Frau“ gibt es eine Reihe von Abhandlungen, die teilweise auch auf die literarische Darstellung weiblicher Erwerbstätigkeit im Zusammenhang mit anderen Aspekten wie Freizeitverhalten, neue Sexualmoral etc. eingehen.[1] Meist wird allerdings ein nach wie vor heteronormativer Blick auf die Protagonistinnen und deren Lebensentwürfe gerichtet.[2] Romane, die lesbisches Begehren thematisieren, werden hingegen isoliert und unter anderen Gesichtspunkten behandelt.[3] Hier wird zumeist die Darstellung von Sexualität, Erotik und Begehren und die Inszenierung von Geschlechterrollen in den Mittelpunkt gestellt.[4] Welche Rolle „Arbeit“ für die Ausbildung einer (lesbischen/ queeren) Identität spielen könnte, welches Gewicht der Erwerbstätigkeit beigemessen wird, welche Betätigungsfelder wie inszeniert werden bzw. warum die soziale Lebensrealität der Protagonistin(nen) eben gerade nicht oder nur am Rande thematisiert wird, wurde bislang nicht untersucht.
Eine zusammenhängende Studie zum Themenkomplex der Arbeit in der Literatur der Weimarer Republik lieferte erstmals Thorsten Unger.[5] Diskussionen über den Typ der „Neuen Frau“ in Relation zu „Arbeit“ sowie Ausführungen zur geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung werden in dieser Untersuchung nur angerissen, ließen sich jedoch nach Ansicht Ungers „ebenfalls leicht zu einer eigenständigen Studie ausbauen.“[6]
Mit der vergleichenden Textanalyse und deren Einbettung in die soziokulturellen Diskurse der 1920er Jahre möchte ich neue Erkenntnisse über die Bedeutung von „Arbeit“ für die Fremd- und Selbstkonstruktion lesbischer/bisexueller/heterosexueller Frauen gewinnen. Nicht zuletzt kann und soll diese Untersuchung als Anstoß verstanden werden, die Kategorien „Sexualität“, „Liebe“ und „Beziehungsformen“ in den Diskurs um „Gender“ und „Arbeit“ – durchaus auch über historisch-literarische Betrachtungen hinaus – verstärkt mitzudenken.
1.2. Fragestellungen
Im Mittelpunkt der Untersuchung wird die übergreifende Frage nach der Funktionalität der Arbeit für die Ausprägung und Inszenierung individueller oder kollektiver Identitäten stehen. Diese Identitäten werden dabei stets als durch geschlechtliche und sexuelle Zuweisungen bestimmte Subjektpositionen gedacht. Zum einen manifestieren sich diese (Selbst-)Positionierungen durch handlungstragende Entscheidungen (Welchen Berufen gehen die Protagonistinnen nach? Wer oder was beeinflusst ihre Berufswahl?), zum anderen in prozesshaften, innerhalb eines gegebenen Bezugsrahmens mehr oder weniger „wiedererkennbaren“ Verhaltensweisen und Handlungsmustern (z.B. Wie verhält sich die Protagonistin gegenüber Chefs/Kollegen?).
Bezüglich der Behauptung einer eigenen Identität ist das Konzept der „Unabhängigkeit“ zentral: Welche Bedeutung haben die Begriffe „Eigenständigkeit“, „Freiheit“, „Unabhängigkeit“ für die Charaktere? Inwieweit werden diese Konzepte mit „Arbeit“ verknüpft? Findet eine starke/schwache Identifikation über „Arbeit“ statt? Ist z.B. die vorrangige Motivation, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, oder sind andere Aspekte – „Selbstverwirklichung“, Verantwortung, kreatives Schaffen etc. – ausschlaggebend?
Weitere Leitfragen beziehen sich auf den Themenkomplex traditioneller/alternativer Lebensentwürfe. Wie wird der „private“, wie der „öffentliche“ Bereich gewichtet? Gibt es Überschneidungen? In welchem Wechselverhältnis (z.B. als gegenseitige Bereicherung/Behinderung oder einander ausschließend) stehen sexuelle/emotionale Bindungen und „Arbeit“? Wo und auf welche Weise werden gängige Wertgefüge im Hinblick auf geschlechtsspezifische Tätigkeiten durchbrochen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen alternativen Wertgefügen bezüglich der Erwerbstätigkeit, queeren Lebensentwürfen/ queerer Sexualität und abweichendem Geschlechtsrollenverständnis?
Es geht mir weniger um die Beschreibung sozialer Realitäten als um die (literarische) Vermittlung bestimmter Bilder, Denkstrukturen und Handlungsmuster.[7] Ebenfalls sei angemerkt, dass diese Arbeit nicht den Anspruch erhebt, eine Bestandsaufnahme fiktionaler Inszenierungen von erwerbstätigen „Neuen Frauen“ und/oder homosexuellen Frauen zu sein. Vielmehr möchte ich mich auf eine qualitative Analyse einiger weniger literarischer Beispiele auf der Folie soziokultureller Diskurse der Weimarer Zeit beschränken.
2. Begriffsbestimmungen und theoretische Grundlagen
An dieser Stelle möchte ich, statt eine begriffliche Eingrenzung vorzunehmen, vielmehr die flexible Sichtweise skizzieren, die meinem Umgang mit den Begriffen „Sexualität“, „soziales Geschlecht“ und „Arbeit“ zugrunde liegt.
Das Prinzip der begrifflichen Offenheit basiert auf dem der queer theory[8] entlehnten Konzept der permanenten Unabgeschlossenheit von Identitätskategorien. Diese Perspektive kann nicht nur auf die klassischerweise mit queer assoziierten Begriffe sex / gender /Begehren angewendet werden, sondern auch auf weitere identitätsstiftende Parameter wie Klasse, Kultur, Ethnizität etc. Demnach kann der „ queere Blick “ als ein Instrument zur Kritik an bruchlosen Kategorien bzw. vermeintlichen Kohärenzen verstanden werden, der weit über das Infragestellen der Dichotomien männlich/weiblich und homo/hetero hinausgeht. Um die Interdependenzen der genannten Motive in den Fokus zu rücken, folge ich Judith Halberstams Verständnis von „queerness as an outcome of strange temporalities, imaginative life schedules, and eccentric economic practices.“[9] D.h., von „ queeren Identitäten“ zu sprechen, bezieht sich nicht unbedingt bzw. nicht ausschließlich auf die „sexuelle Identität.“
Hinsichtlich des Begriffs „Sexualität“ finde ich Heike Schaders Ausdifferenzierung in „Sexualität“, „Begehren“ und „Erotik“ hilfreich, da diese Unterscheidung es ermöglicht, „die unterschiedlichen Ebenen des Handelns im Einzelnen [zu] betrachten.“[10] Schader beschreibt „Sexualität“ als „eine (meist) körperliche Erfahrung, ein körperliches Erleben“[11], ohne sie jedoch auf körperliche Vorgänge zu reduzieren.
Gerade in Bezug auf die Inszenierung weiblicher (insbesondere lesbischer) Sexualität halte ich eine derart weitgefasste Definition, die Aspekte wie „Begehren“, „Sehnsucht“ etc. mit berücksichtigt, für angebracht, da eine zu enge Definition von „Sexualität“ Gefahr läuft, in androzentrisch-heteronormativen Annahmen verhaftet zu bleiben. So galt lesbische Sexualität als quasi nicht-existent, da den herrschenden Auffassungen nach Sexualität ohne männliche Penetration unmöglich war. Doch auch dort, wo lesbische Sexualität thematisiert wurde – z.B. in den Zeitschriften homosexueller Frauen der 1920er Jahre – waren die Beschreibungen zumeist wenig explizit, sondern blieben mehrdeutig bzw. durch für „Eingeweihte“ wiedererkennbare Symbolik chiffriert. Gerade für die literarische Deutung solcher Codes ist es also unerlässlich, verschiedene Aspekte rund um „Begehren“ und „Erotik“ in die Bedeutung von „Sexualität“ mit einzubeziehen.[12]
Was das hier verwendete Konzept von „sexueller Orientierung“ angeht, so fühle ich mich u.a. den Ansätzen von Klein et. al. verpflichtet, die das „Klein Sexual Orientation Grid“ entwarfen. Das KSOG setzt Parameter der Selbstpositionierung in Beziehung zueinander, ohne Kohärenzreihen zu postulieren – u.a. sexuelle Anziehung, sexuelles Handeln, Fantasien, emotionale Präferenz, soziale Präferenz, Selbstidentifikation und Lebensstil. Die Möglichkeit, sich für jede dieser Dimensionen anders zu positionieren – auf einer dehnbaren Skala, die von „other sex only“ bis „same sex only“ reicht – hebt die Binarität homo/hetero auf und eröffnet somit eine Perspektive auf „Sexualität“ und „Begehren“ als multidimensional und über die Lebensspanne hinweg wandelfähig.[13]
„Soziales Geschlecht“ begreife ich im poststrukturalistischen Sinne als kulturelle Konstruktion, die weder zwingend aus dem biologischen Geschlecht folgt, noch eine Geschlechterdichotomie voraussetzt.[14] Alternativ verwendet werden die Termini „Geschlechtsidentität“ oder „ gender “. Für dieses Vorhaben erscheint mir der Begriff „soziales Geschlecht“ besonders treffend, da er am ehesten auf die Fluidität und Prozesshaftigkeit von „Geschlecht“ verweist. „Geschlechtsidentität“ hingegen suggeriert leicht die Fiktion eines starren, ins vordiskursive Feld abgeschobenen Kerns (gender core),[15] ein Konzept, das häufig zur Erklärung von Transgender-Phänomenen herangezogen wird, und von dem ich mich distanzieren möchte. Hier geht es mir v.a. um das „soziale Geschlecht“ im Sinne von Geschlechtsrollenzuweisungen und internalisiertem Geschlechtsrollenverständnis, d.h. um das alltäglich in jeder sozialen Interaktion stattfindende doing gender. „Soziales Geschlecht“ selbst ist ein „Tun“, ohne jedoch der „Tat“ ein intentionales Subjekt vorauszusetzen. Vielmehr verstehe ich Geschlechtsidentität als performativ, d.h. durch repetitive Handlungen und Anweisungen innerhalb des hegemonialen Diskurses[16] hervorgebracht.[17]
Das „konstitutive Wechselverhältnis“ zwischen sozialem Geschlecht und Sexualität, das sich durch „eine Reihe nicht-kausaler und nicht-reduktiver Beziehungen“[18] manifestiert, ist mittlerweile integraler Bestandteil vieler Gender-Diskurse und bedarf somit keiner weiteren Ausführungen. Hier sei lediglich ein für diese Arbeit relevantes Beispiel genannt, nämlich die literarische Darstellung von Erotik, die – unabhängig vom biologischen Geschlecht der agierenden Subjekte – mit geschlechtlich konnotierten Begriffen wie „Verführung“, „Eroberung“ und „Hingabe“ arbeitet.[19] Vereinfacht könnte man sagen, dass die von sexuellen/romantischen Motiven geleitete Interaktion von Personen eine Art Schnittstelle zwischen „Sexualität“ und „sozialem Geschlecht“ darstellt.
Dahingegen erscheint es – zumindest auf den ersten Blick – weitaus erklärungsbedürftiger, „Arbeit“ in Zusammenhang mit „sozialem Geschlecht“, v.a. aber „Sexualität“ zu bringen. Nach der Definition des „Brockhaus“ ist „Arbeit“ „der bewusste und zweckgerichtete Einsatz der körperl., geistigen und seel. Kräfte des Menschen zur Befriedigung seiner materiellen und ideellen Bedürfnisse.“[20] Unter „Arbeit“ wird in der Regel „Erwerbsarbeit“ verstanden, d.h. eine Tätigkeit, die durch Geld entschädigt wird, das den Eigentumserwerb ermöglicht.[21] Sie ist eine historisch gewachsene, durch Ausschlussmechanismen hervorgebrachte Kategorie, die sich am männlichen Arbeiter der Industriegesellschaft orientiert.[22]
Gleichzeitig weist die Erwähnung der „ideellen Bedürfnisse“ des Menschen bereits auf die Bedeutung von „Arbeit“ jenseits rein ökonomischer Zweckdienlichkeit hin. Im Zuge der vorliegenden Untersuchung halte ich es für sinnvoll, „Arbeit“ in dem übergreifenden Sinn zu verwenden, der nicht zwingend an „Erwerb“ gekoppelt ist, um ein möglichst breites Spektrum an (weiblichen/ queeren) Lebensentwürfen fassen zu können. Als Formen von Arbeit, die nicht mit Erwerb verbunden sind, nennt Unger unbezahlte Haushaltstätigkeiten, Sorgearbeit und ehrenamtliches Engagement.[23] Des weiteren fallen m.E. auch z.B. (freiberufliche) künstlerische Tätigkeit oder Forschungstätigkeit – Felder, die in Ungers Auflistung fehlen, die für diese Untersuchung jedoch relevant sind – unter „erwerbsunabhängige Arbeit.“ Dieses weitgefasste Verständnis von „Arbeit“ zielt darauf ab, dem komplexen Wechselspiel von persönlichen Arbeitsmotivationen und gesellschaftlichen (geschlechtsspezifischen) Zuschreibungen ebenso viel Raum zu geben wie ökonomischen Zwängen und Erwägungen.
Um die Interdependenzen von „Arbeit“ und „Geschlecht“ zu verstehen, gilt es zunächst, sich klarzumachen, dass „Arbeit“ zu den maßgeblichen Determinanten des sozialen Status und der Identifikation zählt. Demnach ist „Arbeit“ nicht bloß Berufstätigkeit, sondern „stellt vielmehr den zentralen Bezugsrahmen der Biographie dar, sie ist umfassend als ‚Lebenszusammenhang’ zu begreifen.“[24] Dieser „Lebenszusammenhang“ kann nicht unabhängig von den Strukturkategorien Geschlecht, Klasse, Rasse, Alter etc. gedacht werden. Die auf Geschlechterrollenvorstellungen basierende Zuweisung (und Annahme) bestimmter Aufgabenfelder ist gleichzeitig Ausdruck und konstituierendes Instrument von geschlechtsspezifischen Erwartungen, Deutungsmustern, Erleben eigener Fähigkeiten etc.[25] An diese subjektiven Haltungen der eigenen Tätigkeit gegenüber knüpfen sich oftmals so essentielle Begriffe wie „Freiheit“ und „Autonomie“, die durchaus über das Motiv finanzieller Unabhängigkeit hinausgehen können. Gerade der eng mit „Arbeit“ verbundene und gleichzeitig darüber hinausweisende Freiheitsbegriff[26] kann nicht ohne die Kategorie „Geschlecht“ betrachtet werden, da sowohl die sozialpolitischen Institutionen als auch die gesellschaftlichen Erwartungen bezüglich Erwerbs- und Familienarbeit signifikant von der nationalen Geschlechterordnung abhängen.[27] Eine historische Betrachtungsweise erfordert somit eine Berücksichtigung der in der jeweiligen Epoche vorherrschenden kulturellen Leitbilder zu Familie und geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung.
Im Gegensatz dazu werden „Sexualität“ und „Arbeit“ eher selten in den selben Bezugsrahmen gesetzt. Hauptgrund hierfür dürfte die für westliche Industriegesellschaften charakteristische Dichotomisierung in „privat“ und „öffentlich“[28] sein, wobei „Sexualität“ traditionell der privaten Sphäre, „Arbeit“ hingegen dem öffentlichen Raum zugeordnet wird. So stellt Halberstam fest, dass die meisten neo-marxistischen Texte, die sich mit dem Raum-Zeit-Gefüge der Postmoderne auseinandersetzen, „Sexualität“ als Analysekategorie systematisch ausschließen. Sie beklagt diese „foundational exclusion, which assigned sexuality to body/local/personal and took class/global/political as its proper frame of reference“[29] und führt im Folgenden das Konzept der „queer temporality“ ein, das eine neue Sichtweise auf die Berührungspunkte zwischen „Sexualität“, „Raum“ und „Zeit“ eröffnet.
Hier verweise ich noch einmal auf mein Verständnis von queer als losgelöst von schwul/lesbischer Sexualität. Vielmehr beziehe ich mich auf die Möglichkeit einer queeren Positionierung in Abgrenzung zu den Eckpunkten institutionalisierter Heteronormativität – Familie, Heterosexualität und Reproduktion.[30] Dazu zählt z.B. eine normierte Zeiteinteilung, die sich an bürgerlichen „Familienwerten“ misst.[31] Diesbezüglich lässt sich auf der Mikroebene der normierte (Arbeits-)Alltag unter die Lupe nehmen, auf der Makroebene die – an heterosexuellen Männern und Frauen ausgerichteten – Fixpunkte der jeweils erwarteten (Erwerbs-/Reproduktions-)biographie. „Queer times“ und „queer spaces“ eröffnen sich dadurch, dass „all kinds of people, especially in postmodernity, will and do opt to live outside of reproductive and familial time as well as on the edges of logics of labor and production.“[32] Als beispielhaft für Lebensentwürfe „outside the logic of capital accumulation“[33] sieht sie Menschen, die – bewusst, unbewusst, oder aus materieller Not heraus – zu Zeiten leben und arbeiten, in denen andere schlafen, und sich in (physisch, metaphysisch oder ökonomisch) marginalisierten/verlassenen Räumen bewegen und aufhalten. In eben diesen Subjektpositionen, die nicht notwendigerweise an queere Sexualität gebunden sind, manifestieren sich „queer times“ und „queer spaces“.
Während Halberstam davon ausgeht, dass gerade das postmoderne Zeitalter „a queer time and place“ darstellt, lasse ich mich in dieser Untersuchung von der Frage leiten, inwieweit sich auch in älterem Textmaterial queere Aneignungen von „Zeit“ und „Raum“ verorten lassen.
3. Die „Neue Frau“ – Konstruktionen und soziale Realitäten
Die „Neue Frau“ – dieser Begriff beschwört Bilder jenes Idealtypen herauf, den man aus Filmen, Zeitschriften und Büchern kennt und der im Laufe der Zeit zum Paradigma der 1920er Jahre stilisiert wurde. Unweigerlich denken wir an „das massenhaft existierende Stereotyp der jungen Frau mit Bubikopf, kurzem Rock und Zigarette.“[34] Doch was macht die „Neue Frau“ aus? Wird diese Reduktion auf den Phänotyp dem Begriff tatsächlich gerecht?
Sicherlich stimmt es, dass die „Neue Frau“ zumindest „partiell ein mediales Produkt ist.“[35] Wenn man sich jedoch die untrennbar mit der Frauenbewegung verbundene Entstehungsgeschichte des Begriffs betrachtet, wird man feststellen, dass dem ästhetischen Ideal durchaus ein emanzipatorisches Ideal zugrunde liegt. Immerhin finden sich im Wort selbst ja bereits Anklänge an die Überwindung überkommener Rollenvorstellungen, den Aufbruch in die Moderne. In gewissem Sinn ist die „Neue Frau“ als Produkt einer Zeit zu verstehen, in der die vorrangigen Ziele der Frauenbewegung, zumindest auf dem Papier, erreicht waren. Frauen konnten wählen, Abitur machen, haben Zugang zu den Universitäten und zu den meisten Berufszweigen.[36] Der neue Status als (formal) gleichberechtigte Staatsbürgerin, „die Wandlung der ökonomischen Rolle der Frau und das Beschreiten der Bahn selbstständiger Arbeit“[37] sowie die gelockerte Sexualmoral sind die Hauptcharakteristika der „Neuen Frau“.[38]
Aus diesem gesellschaftlich sichtbaren und viel diskutierten Phänomen kristallisierten sich v.a. zwei populäre Weiblichkeitsentwürfe heraus – das „Girl“ und die „Garçonne“. Im sportlich-mädchenhaften Erscheinungsbild des „Girls“ setzte sich das moderne amerikanische Schönheitsideal durch, während die sachlich-androgyne „Garçonne“ eher als europäisches Nachkriegsphänomen galt.[39]
Darüber hinaus lässt sich jedoch eine Vielfalt an Lebensentwürfen und Lebensrealitäten, an nebeneinander existierenden Diskursen, Bild- und Textformulierungen zur „Neuen Frau“ ausmachen.[40] Die Einordnung in ein binäres Schema – entstanden aus dem ausgeprägten Typologisierungs- und Klassifizierungswahn der Weimarer Zeit – hat stark normierende Tendenzen. Auf sprachlich-visueller Ebene wurde versucht, den Umbruchs- und Auflösungserscheinungen der Nachkriegsgesellschaft mit begrifflichen Fixierungen beizukommen. Dazu gehörte auch, die vielen verschiedenen sich entwickelnden Weiblichkeitsentwürfe zu ikonographischen Idealen zu gerinnen, um sie auf diese Weise leichter fassen und bannen zu können.[41] Die entstehenden Schemata haben eine sowohl normative als auch interpretative Funktion – auf der einen Seite stellen sie eine restriktive Regulation von außen dar, auf der anderen Seite können sie aber auch von Frauen aktiv dazu genutzt werden, sich selbst zu „interpretieren.“[42]
3.1. Die neue Sexualmoral
Inwieweit trug die neue Sexualmoral tatsächlich zur Unabhängigkeit der „Neuen Frau“ bei? Ein Blick auf die Diskurse der 1920er Jahre lässt rasch Zweifel an der vermeintlichen „Freiheit durch befreite Sexualität“ aufkommen. Erstens werde ich mich mit der diskursiven Setzung des Widerspruchs zwischen weiblicher Sexualität und Arbeit auseinandersetzen. Zweitens möchte ich herausfiltern, inwieweit die „neuen“ Moralvorstellungen nach wie vor in differenztheoretischen, auf Zwangsheterosexualität basierenden Überlegungen verhaftet blieben.
3.1.1. Triebsublimation durch Arbeit
Die sexuelle Doppelmoral im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts wird besonders augenfällig, wenn man den herrschenden Diskurs um alleinstehende Frauen betrachtet, sowohl in der zeitgenössischen „Frauenliteratur“ als auch auf soziopolitischer Ebene. Ledigen, geschiedenen und verwitweten Frauen wurde in der Regel kein Sexualleben zugestanden. Zwar diskreditierte man sie nun nicht mehr unbedingt als „alte Jungfern“, denn unverheiratete Berufstätige gehörten mittlerweile zur (urbanen) Normalität, aber die herrschende Auffassung stellte sie vor die Wahl: Entweder Arbeit oder Sexualität.
Gerade in der Weimarer Zeit entstand eine Vielzahl von Verteidigungsschriften zum Zölibat der arbeitenden Frau, die dieses Ausschlussprinzip untermauerten.[43] Der öffentlichen Meinung nach sollten alleinstehende Frauen ihre Triebe in der Arbeit sublimieren, d.h die Energie des „Eros“ ins Abstrakte verschieben. Das schöpferische Moment bezieht sich jedoch nicht auf die Selbstverwirklichung der Frau, sondern soll sich zu einem allumfassenden Altruismus ausdehnen. Frauen, die – bewusst oder umständehalber – diese allumfassende Liebe wählten und dafür auf Sexualität und erotische Bindungen verzichteten, wurden quasi als Heilige stilisiert. Diese Ideologie verlieh dem Dasein alleinstehender Frauen gesellschaftliche Anerkennung und vermutlich auch Selbstwertschätzung. Dennoch läuft diese Kanalisierung der „seelischen Produktivkraft“[44] Alleinstehender auf die differenztheoretische Auffassung hinaus, dass das Wesen der Frau ihre alleinige Erfüllung – wenn nicht in der Mutterschaft – in sozialer Betätigung findet. Das, was sie einem Ehemann nicht sein kann, darf oder will – ein Gegenpol zur „harten Männerwelt“ – soll sie nun der Allgemeinheit sein. Als adäquater Ersatz für Partnerschaft und Sexualität galten demnach v.a. pflegende, heilende und erzieherische Berufe.[45] Abschließend lässt sich feststellen, dass in den Texten, die das Prinzip „Arbeit statt Sexualität“ verfechten, tief verwurzelte Ängste vor der ungezügelten (d.h. keiner männlichen Herrschaft unterstellten) weiblichen Sexualität reproduziert werden.[46]
Einerseits ist „Freiheit“ ohne finanzielle Eigenständigkeit kaum denkbar. Andererseits stellt auch die Beschränkung, Kontrolle und Sanktionierung der eigenen Sexualität eine Beschneidung der persönlichen Freiheit dar. So bedeutete zur damaligen Zeit für (alleinstehende) Frauen der Freiheitsgewinn auf einem Gebiet fast zwangsläufig den Freiheitsverzicht in anderen Bereichen.
3.1.2. Befreite Sexualität?
Zweifellos gingen die gesellschaftlichen Umbrüche, welche die „neue Frau“ hervorbrachten, mit tiefgreifenden Veränderungen der sexuellen Einstellungen und Verhaltensweisen einher.
In den Sexualwissenschaften wie auch im öffentlichen Diskurs wurden erstmals traditionelle ethische Konzepte rund um Enthaltsamkeit, Monogamie und Fortpflanzung in Frage gestellt. Der Jungfräulichkeit und Abstinenz junger Frauen wurde nicht mehr derselbe Stellenwert beigemessen wie noch im vorigen Jahrhundert. Ehelose Verbindungen wurden gebilligt und sogenannte „freie Ehen“ propagiert. Die Sichtweise der Frauenbewegung zur „neuen Sexualmoral“ indes war gespalten. Einerseits gab es seit 1905 den Mutterschutzbund, dessen Gründerin Helene Stöcker eine Entkoppelung von Sexualität und Fortpflanzung forderte. Demgegenüber stand die gemäßigte Liga der bürgerlichen Frauenbewegung, die zwar für die Gleichberechtigung und „Freiheit“ der Frau plädierten, den Zusammenhang zur „freien Liebe“ jedoch nicht herstellen wollten.[47]
Interessanterweise wird von den Befürwortern der „neuen Sexualmoral“ die sexuelle Gleichberechtigung meist in einem Atemzug gedacht mit der ökonomischen Unabhängigkeit und politischen Gleichstellung der Frau. Alternativen zur Sexualität zwischen Mann und Frau hingegen finden in den seltensten Fällen Erwähnung. So bleiben auch fortschrittliche Denkansätze, wie z.B. „die Anerkennung des Geschlechtsverkehrs als physisch und psychisch bedingten und geforderten Selbstzweck der Lustgewinnung und persönlichen Lebensförderung“[48] stets in heteronormativen Konzepten verhaftet.
Die in Filmen und Zeitschriften vermittelten Ratschläge zur modernen Lebensführung verdeutlichen, wie sehr die „Neue Frau“ trotz ihrer neugewonnen „sexuellen Freiheit“ nach wie vor an das Urteil des Mannes gebunden bzw. auf die Befriedigung männlicher Sexualität fixiert wurde. Beispielsweise schreibt „Die Dame“ in dem Artikel „Charakterköpfe“: „...sie ist lebenskundig genug, um zu wissen, dass sie in ihrer neuen Selbständigkeit allenfalls auf die Ehe verzichten kann, aber trotzdem um den Mann kämpfen muss.“[49] Vier Jahre später warnt dieselbe Zeitschrift: „Sie muss im Mittelpunkt sein und Anregungen geben – allerdings dürfen die Männer das nicht merken. Es enterotisiert nämlich, wenn eine Frau zu klug ist...“[50]
Dass dem männlichen Urteil eine derartige Zentralität im Bewusstsein und Verhalten der „Neuen Frau“ eingeräumt wird, leugnet nicht nur die Existenz alternativer Lebens- und Liebesformen, sondern birgt des weiteren die Gefahr, den gewinnbringenden Einsatz von Sexualität als Essenz des neuen weiblichen Selbstbewusstseins zu verstehen.
Besonders dem amerikanischen Typus des „Girls“ wurde nachgesagt, die „weiblichen Reize“ bewusst als Tauschware einzusetzen. Exemplarisch für diesen Typ steht die kapitalistisch kalkulierende „Berufsschönheit“ in Anita Loos’ Roman „Gentlemen prefer blondes“[51], die für viele Leserinnen in Amerika und Europa Vorbildfunktion hatte. Sie wurde als emanzipierte Frau gesehen, die weiß, was sie will, und wie sie es bekommt. Dieser Art von „Unabhängigkeit“ sind jedoch klare Grenzen gesetzt. Dass der berechnende Einsatz der eigenen Sexualität vom Begehren und Wohlwollen des Mannes abhängt, ließen die begeisterten Leserinnen in der Regel wohl geflissentlich außer Acht. Realistisch betrachtet sind Frauen, die sich auf diese Strategie verlassen, darauf angewiesen, einem männlich konstruierten Idealbild zu entsprechen. Überzeichnet ausgedrückt könnte man diesen Umgang mit der eigenen Sexualität als eine abgemilderte Form der Prostitution verstehen.[52]
Zwar scheint der „Girl“-Typus das prüde Ausschlussprinzip „Sexualität oder Arbeit“ überwunden zu haben, dafür gilt nun: Sexualität ist Arbeit. Provokativ könnte man sich die Frage stellen, was so „neu“ an der „neuen Sexualmoral“ ist, die in vielerlei Hinsicht Frauen doch wieder auf Aussehen, Erotik und Sexualität reduziert, und überdies eine universale Heterosexualität postuliert.
3.2. Erwerbstätigkeit: Chancen und Grenzen
Die Ausbruchsphantasien der „Neuen Frauen“ sind ganz wesentlich mit dem Überschreiten der ihnen traditionell zugewiesenen häuslichen Sphäre und den damit verbundenen „weiblichen“ Arbeiten verknüpft. Das Verschwimmen der Grenzen zwischen „privatem (Frauen-)Raum“ und „öffentlichem (Männer-)Raum“ steht in direktem Zusammenhang mit urbanen Lebens- und Arbeitsräumen, denn „für die moderne Metropole ließen sich diese klaren Kategorien von ‚Innen’ und ‚Außen’ nicht mehr durchgängig aufrecht erhalten.“[53] Erstmals konnten sich Frauen in der großstädtischen Öffentlichkeit – auf der Straße, in Cafés und Salons – frei bewegen, ohne als Prostituierte fehlinterpretiert zu werden.[54]
Die neue Sichtbarkeit von Frauen in der Öffentlichkeit war zugleich Wegbereiter und Folge der Zunahme außerhäuslicher Arbeit. Während des ersten Weltkrieges waren viele Frauen ins Erwerbsleben eingetreten, teilweise auch in typische Männerberufe. Zum einen kamen sie damit dem Appell nach, ihren Teil zur Aufrechterhaltung der Kriegswirtschaft beizutragen, zum anderen blieb ihnen schlicht nichts anderes übrig, als in der Abwesenheit der Männer für den Familienunterhalt zu sorgen. Wenn auch aus einer Zwangslage entstanden, so entwickelten sie doch nach und nach ein neues Selbstbewusstsein angesichts ihrer Fähigkeiten, oftmals einhergehend mit dem Unwillen, die einmal gewonnene Eigenständigkeit wieder aufzugeben.[55] Nach dem Krieg kam es allerdings im Zuge der Demobilisierung zu massiven Kampagnen, deren Ziel es war, Frauen vom Arbeitsmarkt zu verdrängen.[56] Sie richteten sich insbesondere gegen sogenannte „Doppelverdienerehen“. Aber auch alleinstehende Frauen und solche, die weitere Personen zu versorgen hatten, waren von den Entlassungen betroffen.[57] Dass viele Frauen auch in der Nachkriegszeit darauf angewiesen blieben, sich und ihre Familien allein zu versorgen, da viele Väter, Ehemänner und Brüder nicht wiedergekehrt waren, wurde weitgehend ignoriert.[58] Vielmehr griffen hier die weit verbreitete Auffassung, Berufstätigkeit und Mutterschaft seien unvereinbar, und die Strategie, erwerbstätige Ehefrauen für die Arbeitslosigkeit der Männer verantwortlich zu machen, auf wirksame Weise ineinander.[59]
Auf der anderen Seite eröffnete die wachsende Bürokratisierung auf allen Sektoren eine Vielzahl von Positionen im Bereich der Büro-, Verwaltungs- und Verkaufstätigkeit. Diese Stellen waren auf junge, ledige Frauen zugeschnitten, meist gering bezahlt und erforderten nur minimale Qualifikationen. So war in den Nachkriegsjahren trotz der Propaganda zur Rückdrängung der Frauen aus dem Arbeitsleben ein sprunghafter Anstieg der weiblichen Erwerbsquote zu verzeichnen.[60]
Wenn man die Erziehung, Berufsvorbereitung und realen Arbeitsverhältnisse junger Frauen in den 1920er Jahren genauer betrachtet, muss man sich jedoch fragen, inwieweit die Zunahme der Erwerbstätigkeit tatsächlich zu mehr Selbständigkeit und Entscheidungsfreiheit führte.
Schon die damalige Ausbildungssituation weist darauf hin, dass die weibliche Berufstätigkeit lediglich als Übergangsstadium zwischen Schule und Ehe aufgefasst wurde. Den meisten jungen Mädchen wurde lediglich eine sehr kurze Ausbildung zuteil, in der sie auf einen „typisch weiblichen“ Beruf vorbereitet wurden. Nebenher opferten sie einen Großteil ihrer Zeit für den Besuch einer Haushaltsschule, wo sie auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter vorbereitet werden sollten.[61] Diese Strukturen lassen erkennen, dass sich weder an den Auffassungen über geschlechtsspezifische Aufgabenverteilung noch an der Ideologie der Zwangsheterosexualität viel geändert hatte.
Eine weitere Hürde zur finanziellen Unabhängigkeit lag in der systematischen Unterbezahlung von Arbeitnehmerinnen. Obwohl ein Großteil der Frauen mehrere Angehörige zu versorgen hatte, wurde weiterhin an der Vorstellung festgehalten, dass Männer einen „Familienlohn“ erhalten sollten, Frauen dagegen nur einen „Individuallohn.“ Überdies wurden Frauen als physisch schwächer und weniger leistungsfähig eingestuft, wobei geflissentlich übersehen wurde, dass es in den typischen Frauenbranchen nicht in erster Linie auf Körperkraft ankam. Des weiteren wurde mit den Schutzgesetzbestimmungen und der daraus resultierenden geringeren Einsatzfähigkeit der Frauen, sowie mit deren geringeren Qualifikationen argumentiert, um die Lohndifferenz zu rechtfertigen.[62] Es zeigt sich also, dass der Mehrheit der auf den großstädtischen Arbeitsmarkt drängenden jungen Frauen die Voraussetzungen nicht gegeben waren, die im Bild der „Neuen Frau“ theoretisch verankerten Unabhängigkeitskonzepte langfristig zu realisieren.[63] So resümiert auch Karin Erkel: „Da das schmale Gehalt sowie fehlende berufliche Aufstiegschancen der weiblichen Angestellten eine selbständige Lebensführung auf Dauer ausschlossen, orientierten sich die meisten berufstätigen Frauen am althergebrachten Muster der Versorgungsehe.“[64]
Trotz der Zunahme weiblicher Erwerbstätigkeit blieb somit für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland das „Hausfrauenmodell der Versorgerehe“ tonangebend.[65] Dieses teilweise bis heute die Arbeitsmarktpolitik und gesellschaftlichen Erwartungen prägende Ernährermodell charakterisiert sich durch „die Vorstellung, der Mann solle durch einen ausreichenden Lohn und entsprechende Ersatzleistungen seine Familie allein unterhalten können.“[66]
In der Weimarer Republik war die Vorherrschaft des „männlichen Ernährer“-Modells sowohl in die kulturellen Leitbilder eingebettet als auch durch den Rechtsstaat gestützt. Aus dieser ideologischen Verwurzelung lassen sich auch die Ambivalenzen des medial verbreiteten Bildes der „Neuen Frau“ hinsichtlich ihrer Erwerbstätigkeit erklären. Einerseits wurde in vielen Filmen das Dasein als Verkäuferin oder Stenotypistin als glanzvoll und erstrebenswert dargestellt, was auch die Berufswahl vieler junger Mädchen beeinflusste.[67] Andererseits wurde der zentrale Stellenwert der Berufstätigkeit, den die Frauenbewegung als unerlässlich für weibliche Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung gesehen hatte, in den Medien der 1920er Jahre eher selten transportiert. Z.B. stellt Gesa Kessemeier bei einer Analyse von Frauenportraits in der Zeitschrift Vogue fest, dass sich nur neun von 71 portraitierten Frauen über selbst erbrachte Leistungen definieren. In den allermeisten Fällen wurden die Dargestellten – die aufschlussreichen Ausnahmen bildeten einige bekannte Sportlerinnen und Künstlerinnen – als Töchter bzw. Gattinnen erfolgreicher Männer vorgestellt.[68]
Zwar mögen sich vielerorts zaghafte Versuche in Richtung einer neuen Selbstständigkeit der Frau und hin zu einem „kameradschaftlichen“ Geschlechterverhältnis abgezeichnet haben, das Ehe- und Familienrecht jedoch blieb auch unter der neuen Reichsverfassung in traditionell patriarchalen Werten verhaftet. So setzte das Bürgerliche Gesetzbuch deutliche Zeichen hinsichtlich der „Entscheidungsfreiheit“ der Ehefrau. Der Ehemann war als alleiniger Entscheidungsträger vorgesehen. Somit bedurfte die Frau weiterhin seiner Zustimmung, wenn sie eine eigenständige Arbeit aufnehmen wollte. Das ging soweit, dass dem Ehemann das Recht zugesprochen wurde, die Arbeitsstelle seiner Frau eigenmächtig zu kündigen, wenn er das Gefühl hatte, ihre Tätigkeit „beeinträchtige die ehelichen Interessen.“[69]
Im folgenden möchte ich auf zwei Tätigkeitsfelder näher eingehen, die in der folgenden Romananalyse eine übergeordnete Rolle spielen.
3.2.1. Weibliche Angestellte
Das wohl am häufigsten literarisch inszenierte Bild der „Neuen Frau“ war das der Büro- bzw. Ladenangestellten. Der Idealtypus der Sekretärin oder Verkäuferin war jung, ledig, tüchtig, ehrgeizig, und allen Widrigkeiten zum Trotz optimistisch.
In der Tat prägte diese Gruppe weiblicher Angestellter das Stadtbild der 1920er Jahre. Weite Teile der bürgerlichen Mittelschicht sahen sich aufgrund der schlechten Wirtschaftslage der Nachkriegszeit gezwungen, ihre Töchter nach einer verkürzten Schulausbildung zum Geldverdienen in ein Büro zu schicken. Ebenfalls drängten viele Mädchen aus der Arbeiterklasse in kaufmännische Berufe, die keine hohen Eingangsqualifikationen erforderten, da sie darin eine Möglichkeit der Statusverbesserung sahen.[70]
Dabei hatte das neue Massenmedium Film und die populäre „Frauenliteratur“ einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Berufswahl vieler Schulabgängerinnen. Oftmals basierten ihre Hoffnungen und Aufstiegsphantasien auf fiktiven Erfolgsgeschichten, die den Eintritt in eine Welt voller Abwechslung, Luxus und rosiger Zukunftsperspektiven zu versprechen schienen.[71]
Die tatsächliche Arbeitssituation weiblicher Angestellter sah jedoch im allgemeinen anders aus. Zumeist wurden den gering qualifizierten Schulabgängerinnen monotone und schematische Arbeiten zugewiesen. Sie waren körperlichem und seelischem Stress ausgesetzt, und mussten unter starkem Zeitdruck fließbandähnliche Tätigkeiten verrichten. Die „Feminisierung“ des Angestelltensektors wurde insofern von den Männern gebilligt, als dieser Bereich extrem schlecht bezahlt war und kaum Aufstiegsmöglichkeiten bot. Frauen stellten also keine Bedrohung für männliche Arbeitsplätze dar, denn – trotz theoretischer Chancengleichheit – verhinderten diskriminierende Praxen in den meisten Fällen ein Vordringen in höhere Positionen.[72]
Zu der Arbeitsroutine kam, dass sich die Frauen oft genug selbst „vermarkten“ mussten. In einer von Rationalisierung und Kommodifizierung geprägten Zeit überrascht es nicht, dass Jugend, repräsentatives Erscheinungsbild, erotische Ausstrahlung und „typisch weibliche Qualitäten“ als Teil der „Ware“ galten. Die „Ausnutzung erotischer Werbekraft“[73] wurde als legitime Verkaufsstrategie betrachtet. Aufschlussreich sind hier die in den 1920er Jahren gehäuft durchgeführten Höflichkeits- und Schönheitswettbewerbe.[74] Sie zeigen, dass gepflegtes Aussehen und Schönheit, aber auch Freundlichkeit und unermüdliche Geduld von weiblichen Angestellten nicht nur erwünscht, sondern selbstverständlich erwartet wurden. Der Anpassungsdruck reichte von der verkaufsfördernden Zurschaustellung „weiblicher Reize“ bis hin zur (mehr oder weniger offenen) sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz. Z.B. fühlten sich viele Frauen gezwungen, auf die sexuellen Avancen ihrer Vorgesetzten einzugehen, weil sie sonst befürchteten, ihre Stelle zu verlieren.[75]
Zwar führt Ute Frevert an, weibliche Angestellte könnten „in der weiblichen Rolle, in Erotik und Mode (...) die demütigenden und deprimierenden Erfahrungen ihres beruflichen Alltags kompensieren und ein Stück Macht zurückgewinnen.“ Auch in einem Arrangement wie dem „Verhältnis mit dem Vorgesetzten“ sieht sie „neben materiellen Vorteilen die reizvolle Illusion eines gleichberechtigten Tausches, in dem die soziale Hierarchie durch Erotik aufgehoben schien.“[76] Dieser „Tauschhandel“ mag in einigen Fällen funktionieren. Nichtsdestotrotz reduziert er Frauen auf ihre Sexualität bzw. traditionell weibliche Verhaltensmuster und bleibt zudem in der Annahme universaler Heterosexualität verhaftet.
[...]
[1] Kerstin Barndt. Sentiment und Sachlichkeit. Der Roman der Neuen Frau in der Weimarer Republik. Köln 2003; Heide Soltau. Trennungs-Spuren. Frauenliteratur der zwanziger Jahre, Frankfurt/M. 1984; Soltau. Die Anstrengungen des Aufbruchs. Romanautorinnen und ihre Heldinnen in der Weimarer Zeit. In: Gisela Brinker-Gabler (Hg.) Deutsche Literatur von Frauen, Bd. 2, München 1988, S. 220-235; Livia Z. Wittmann. Liebe oder Selbstverlust. Die fiktionale Neue Frau im ersten Drittel unseres Jahrhunderts. In: Sylvia Wallinger, Monika Jonas (Hg.) Der Widerspenstigen Zähmung. Studien zur bezwungenen Weiblichkeit in der Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Innsbruck 1986, S. 259-280; Hilke Veth, Literatur von Frauen. In: Bernhard Weyergraf (Hg.) Literatur der Weimarer Republik 1918-1933. München 1995, S. 446-482; Vibeke Rützou Petersen. Women and Modernity in Weimar Germany. Reality and Representation in Popular Fiction. New York, Oxford 2001.
[2] Vgl. Rützou Petersen 2001, S. 15.
[3] Eine Ausnahme bildet Karin Erkels Artikel „Lösungen von Lebenskrisen im Bannkreis gesellschaftlicher Grenzen“ Zum Jungmädchen- und Frauenbild in populären Romanen der zwanziger und dreißiger Jahre. In: Sabina Becker (Hg.) Jahrbuch zur Literatur der Weimarer Republik. Bd.5 1999/2000 „Frauen in der Literatur der Weimarer Republik“ St.Ingbert 2000. S.115-142, die in ihrer vergleichenden Analyse dreier heute in relative Vergessenheit geratenen Romane auch Maximiliane Ackers „Freundinnen“ mit aufnimmt.
[4] Vgl. Heike Schader. Virile, Vamps und wilde Veilchen. Sexualität, Begehren und Erotik in den Zeitschriften homosexueller Frauen im Berlin der 1920er Jahre. Hamburg 2003; Claudia Schoppmann „Der Skorpion“. Frauenliebe in der Weimarer Republik. Hamburg 1985.
[5] Thorsten Unger. Diskontinuitäten im Erwerbsleben. Vergleichende Untersuchungen zu Arbeit und Erwerbslosigkeit in der Literatur der Weimarer Republik. Tübingen 2004.
[6] Ebd., S. 27.
[7] Zu Konzepten der Wirklichkeit als (literarische) Konstruktion vgl. Paul Watzlawick. Die erfundene Wirklichkeit. München 1986.
[8] Zu „ queer “ vgl. Judith Butler. Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Frankfurt/Main 1997, S. 305-332; zur notwendigen Instabilität individueller und kollektiver Identitäten vgl. Dies. Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt/Main1991, S. 15-22.
[9] Judith Halberstam. In a Queer Time and Place. Transgender Bodies, Subcultural Lives. New York/London, S.1.
[10] Schader 2003, S. 22.
[11] Ebd.
[12] Vgl. ebd. 22ff.
[13] Vgl. Paula C. Rust. Finding a sexual identity and community: Therapeutic implications and cultural assumptions in scientific models of coming out. In: E.D.Rothblum, L.A. Bond (Hg.) Preventing heterosexism and homophobia. Thousand Oaks 1996, S.87-123, bes. S. 111.
[14] Vgl. Butler 1991, S. 22f.
[15] Vgl. ebd. 48f.
[16] Unter „hegemonialer Diskurs“ versteht Butler ein komplexes Gebilde von Macht und Sprache, ein mit Konventionen, Normen, Drohungen und Strafmaßnahmen belegtes Regulierungsverfahren, in das jedes Individuum eingebunden ist. (Vgl. Butler 1997, S. 309ff); zum Diskursbegriff vgl. auch Siegfried Jäger. Text- und Diskursanalyse. DISS Duisburg 1994, S.24-32.
[17] Vgl. Butler 1991, S. 200ff.
[18] Butler 1997, S. 329.
[19] Vgl. Schader 2003, S. 24.
[20] Art. „Arbeit“ in: Brockhaus-Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden. Neunzehnte, völlig neu bearbeitete Auflage. Zweiter Band APU-BEC. Mannheim 1987, S.36, zit. nach Unger 2004, S. 14.
[21] Vgl. Unger 2004, S. 16.
[22] Vgl. Karin Hausen. Geschlechterhierarchie und Arbeitsteilung. Zur Geschichte ungleicher Erwerbschancen von Männern und Frauen, Göttingen 1993; dies., Die Polarisierung der „Geschlechtscharaktere“ – Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben. In: Conze 1976, S.363-393.
[23] Vgl. Unger 2004, S. 16.
[24] Elisabeth Beck-Gernsheim: Das halbierte Leben. Männerwelt Beruf – Frauenwelt Familie, Frankfurt 1980, S. 23.
[25] Vgl. ebd., S. 22ff.
[26] Ilona Ostner unterscheidet „Unabhängigkeit“ = „Freiheit, den Lebensunterhalt eigenständig zu verdienen“ von „Individualisierung“ = „Freiheit in der Sorgeverpflichtung gegenüber der eigenen Familie“. Vgl. Ilona Ostner. Arm ohne Ehemann? Sozialpolitische Regulierung von Lebenschancen für Frauen im internationalen Vergleich. In: Politik und Zeitgeschichte B 36-37/1995, S.3-12.
[27] Vgl. Ostner 1995, S. 7f; Pfau-Effinger, Birgit. Arbeitsmarkt und Familiendynamik in Europa – Theoretische Grundlagen der vergleichenden Analyse. In: B.Geissler u.a. (Hg.) FrauenArbeitsMarkt: Der Beitrag der Frauenforschung zur sozioökonomischen Theorieentwicklung 1998, S.177-194, bes. S. 183ff.
[28] Vgl. Beck Gernsheim 1980, S.21-28.
[29] Halberstam 2005, S. 5.
[30] Vgl. Ebd., S. 1.
[31] Vgl. Ebd., S. 5.
[32] Ebd., S. 10.
[33] Ebd., S. 10.
[34] Bettina Götz. Viermal Hilde. In: Katharina Sykora u.a. (Hg.) Die Neue Frau. Herausforderung für die Bildmedien der Zwanziger Jahre. Marburg 1993, S.153-164, hier S. 162.
[35] Katharina Sykora u.a. (Hg.) Die Neue Frau. Herausforderung für die Bildmedien der Zwanziger Jahre. Marburg 1993, S. 15.
[36] Vgl. ebd. 9f; s.a. Heide Soltau. Die Anstrengungen des Aufbruchs. Romanautorinnen und ihre Heldinnen in der Weimarer Republik. In: Gisela Brinker-Gabler (Hg.) Deutsche Literatur von Frauen. Bd.2, München 1988, S.220-235, hier S.220.
[37] Alexandra Kollontai. Die neue Moral und die Arbeiterklasse (1918), Berlin 1920. In: Kristine von Soden, Maruta Schmidt (Hg.) Neue Frauen. Die Zwanziger Jahre. BilderLeseBuch. Berlin 1988, S.6-7, hier S.7.
[38] Vgl. auch Hanna Vollmer-Heitmann. Wir sind von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Die zwanziger Jahre. Hamburg 1993, S.18ff; Erkel 2000, S. 120.
[39] Vgl. Gesa Kessemeier. Sportlich, sachlich, männlich. Das Bild der „Neuen Frau“ in den Zwanziger Jahren. Dortmund 2000, S. 50ff.
[40] Vgl. z.B. Susanne Meyer-Bürstel. Das schönste deutsche Frauenporträt. Berlin 1994 (zum Georg-Schicht-Preis 1928); Friedrich M. Huebner (Hg.) Die Frau, wie wir sie wünschen. Leipzig 1929.
[41] Sykora 1993, S. 23; Lynne Frame. Gretchen, Girl, Garçonne? Auf der Suche nach der idealen Neuen Frau.
In: Katharina von Ankum (Hg.) Frauen in der Großstadt. Herausforderung der Moderne? Dortmund 1999, S.21-58, hier S. 22f.
[42] Frame 1999, S. 23.
[43] Vgl. Soltau 1984, S. 110ff.
[44] Ebd., S.112.
[45] Z.B. galt in der Weimarer Zeit das Zwangszölibat für Lehrerinnen. Vgl. Vollmer-Heitmann 1993, S. 208f.
[46] Vgl. Soltau 1984, S. 110ff.
[47] Vgl. Kristine von Soden. Die Sexualberatungsstellen der Weimarer Republik 1919-1933. Berlin 1988, S. 44ff.
[48] Max Marcuse. Der Präventivverkehr in der medizinischen Lehre und ärztlichen Praxis. Stuttgart 1931, S.15, zit. nach Soden 1988, S. 46.
[49] „Die Dame“ Heft 16/1926, zit. nach Maruta Schmidt/Kristine von Soden (Hg.) Neue Frauen. Die Zwanziger Jahre. BilderLeseBuch. Berlin 1988, S.8.
[50] „Die Dame“ Heft 21/1930, S.18, zit. nach Soden 1988, S. 53.
[51] Anita Loos. Gentlemen prefer blondes. Leipzig 1926.
[52] Vgl. Irmgard Roebling. Haarschnitt ist noch nicht Freiheit. In: Sabina Becker (Hg.) Jahrbuch zur Literatur der Weimarer Republik. Bd.5 1999/2000 „Frauen in der Literatur der Weimarer Republik“ St.Ingbert 2000, S.13-76, hier S. 15ff.
[53] Sykora 1993, S. 22.
[54] Vgl. ebd.
[55] Erkel 2000, S. 117.
[56] Offiziell hieß es, die freigewordenen Arbeitsplätze sollten den heimkehrenden Männern zur Verfügung gestellt werden. In Wirklichkeit jedoch wurden viele Stellen aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen gar nicht mehr besetzt. Vgl. Vollmer-Heitmann 1993, S. 206.
[57] Vgl. ebd., S. 204f.
[58] Vgl. Kessemeier 2000, S. 165.
[59] Vgl. Vollmer-Heitmann 1993, S. 206.
[60] Vgl. Erkel 2000, S. 117f.
[61] Vgl. Kessemeier 2000, S. 168ff.
[62] Vgl. Vollmer-Heitmann 1993, S. 230 ff; Kessemeier 2000, S. 173 u. 186.
[63] Vgl. Ute Frevert. Kunstseidener Glanz. Weibliche Angestellte. In: Kristine von Soden, Maruta Schmidt (Hg.) Neue Frauen. Die Zwanziger Jahre. BilderLeseBuch. Berlin 1988, S. 25-30, hier S. 26f.
[64] Erkel 2000, S. 120.
[65] Vgl. Pfau-Effinger 1998, S. 186f. Eine Ausnahme bildeten Arbeiterinnen. Diese blieben häufig auch nach der Heirat erwerbstätig, schon allein weil der niedrige Lohn des Ehemannes sie dazu zwang. Vgl. Vollmer-Heitmann 1993, S. 234.
[66] Ostner 1995, S. 3.
[67] Vgl. Kessemeier 2000, S. 168; Vollmer-Heitmann 1993, S. 211f.
[68] Vgl. ebd., S. 62f.
[69] Ebd., S. 184.
[70] Vgl. Heinke Schmitz. Lebensentwurf und Realitätskonflikt, dargestellt an ausgewählten Romanen von Autorinnen der Weimarer Republik. Hamburg 1986, S. 77ff.
[71] Vgl. Vollmer-Heitmann 1993, S. 217ff; Frevert 1988; S. 30.
[72] Vgl. Frevert 1988, S. 27ff.
[73] Vollmer-Heitmann 1993, S. 221.
[74] Z.B. der Wettbewerb „Lächle, Berliner!“ (vgl. ebd., S. 223) oder die Kür der „schönsten Warenhausverkäuferin der Hauptstadt“ (vgl. Frevert 1988, S. 25).
[75] Vgl. Frevert 1988, S. 29; Vollmer-Heitmann 1993, S. 224.
[76] Frevert 1988, S. 29.
Details
- Titel
- 'Queer Temporalities'?
- Untertitel
- Zusammenhänge zwischen den Motiven 'Arbeit', 'soziales Geschlecht' und 'Sexualität' in der fiktionalen Ausgestaltung der 'Neuen Frau' auf der Folie soziokultureller Diskurse der Weimarer Zeit
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Seiten
- 84
- Katalognummer
- V226906
- ISBN (eBook)
- 9783836631372
- Dateigröße
- 528 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- queer weimarer republik neue frau roman arbeit
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2005, 'Queer Temporalities'?, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/226906

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.


