Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos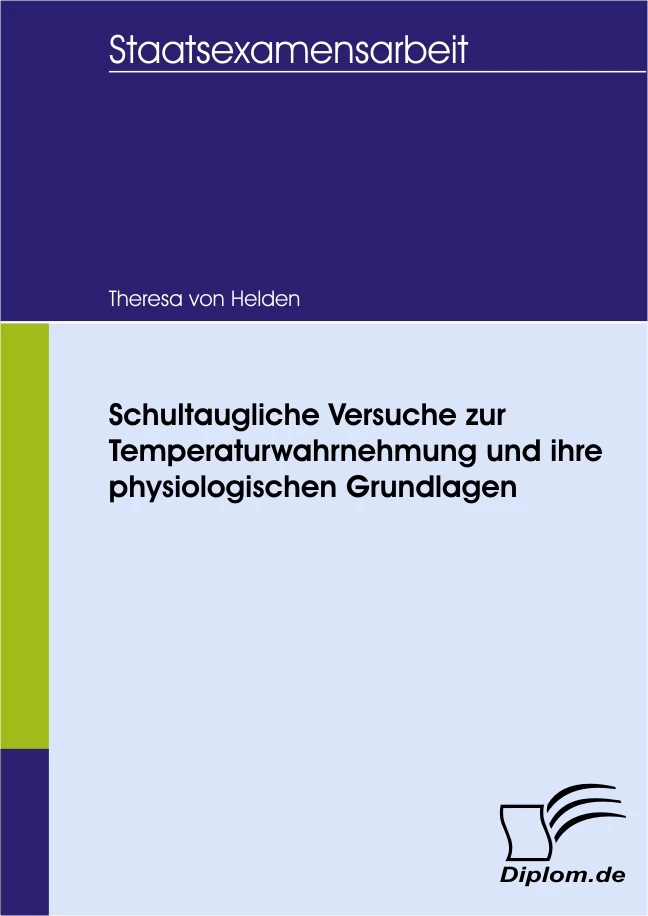
Schultaugliche Versuche zur Temperaturwahrnehmung und ihre physiologischen Grundlagen
Examensarbeit, 2008, 111 Seiten
Kategorie
Examensarbeit
Institution / Hochschule
Note
1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Theoretischer Hintergrund
1. Grundbegriffe der Sinnesphysiologie
1.1 Objektive Sinnesphysiologie
1.2 Psychophysik
2. Die Haut und ihre Sinne
2. 1 Mechanosensoren
2. 2 Nozizeptoren
2. 3 Thermosensoren
3. Thermosensoren als Proportional-Differential-Fühler
3. 1 Entladungsverhalten bei konstanter Hauttemperatur
3. 2 Entladungsverhalten bei Änderungen der Hauttemperatur
4. Molekulare Mechanismen der Temperaturwahrnehmung
5. Zentrale Verarbeitung von Temperatursignalen
6. Psychophysik des Temperatursinns
6. 1 Statische Temperaturempfindungen
6. 2 Dynamische Temperaturempfindungen
6. 3 Konstanzleistung vs. Wahrnehmung von Temperaturänderungen
7. Materialunterscheidung durch den Temperatursinn
7. 1 Wärmeleitung zwischen Festkörpern
7. 2 Materialspezifischer Verlauf von Temperaturänderungen an der Haut
8. Thermoregulation
8. 1 Homoiothermie vs. Poikilothermie
8. 2 Regulation der Körperkerntemperatur
8. 3 Temperaturfühler und zentrale Verarbeitungsprozesse
9. Exkurs: Temperaturwahrnehmung bei ausgewählten Tierarten
II. Schulversuche
1. Verankerung in Lehrplan und Bildungsstandards für das Fach Biologie
2. Schulversuche zur Temperaturwahrnehmung
2. 1 Identifikation von Warm- und Kaltpunkten
2. 2 Die Bedeutung der Größe der Reizfläche
2. 3 Der Drei-Schalen-Versuch
2. 4 Weber’sche Täuschung
2. 5 Materialunterscheidung durch den Temperatursinn
Fazit
Abbildungsnachweis
Tabellennachweis
Literaturverzeichnis
Abbildungen
Teil I:
Abb. 1.1: Der Weg vom Reiz zum Aktionspotential.
Abb. 1.2: Adaptation von Sinneszelltypen.
Abb. 1.3: Der Weber-Quotient und Webers Gesetz.
Abb. 1.4: Verteilung von Spontanaktivität und Antworten auf einen schwellennahen Sinnesreiz.
Abb. 1.5: Beziehung zwischen Reizstärke φ und Empfindungsgröße ψ.
Abb. 1.6: Der Zusammenhang zwischen Empfindungsintensität ψ und Logarithmus der Reizstärke φ.
Abb. 2.1: Der Aufbau der behaarten Haut beim Menschen.
Abb. 2.2: Die durchschnittliche Dichte von Warm-, Kalt-, Druck- und Schmerzpunkten.
Abb. 2.3: Axone der wichtigsten Hautsensoren beim Menschen.
Abb. 2.4: Lage und Struktur der Thermosensoren in der Haut.
Abb. 3.1: Entladungen von Kalt- und Warmsensoren.
Abb. 3.2: Abhängigkeit der dynamischen Antwort von Kältesensoren.
Abb. 3.3: Abhängigkeit der dynamischen Antwort von Wärmesensoren.
Abb. 4.1: Aufbau eines TRP-Kanals.
Abb. 4.2: Aktivierung des TRPV1-Kanals.
Abb. 4.3: Aktivierung des TRPM8-Kanals.
Abb. 4.4: Abkühlung aktiviert TRPM8.
Abb. 4.5: Erwärmung aktiviert TRPV1.
Abb. 5.1: Überlappende sensible Innervation der Haut durch drei Spinalnerven.
Abb. 5.2: Leitung und Verarbeitung somatoviszeraler Signale im ZNS.
Abb. 5.3: Signallaufplan spinaler somatoviszeraler Informationen.
Abb. 5.4: Projektion eines Temperaturreizes auf den Kortex.
Abb. 6.1: Adaptationszeiten der Thermosensoren.
Abb. 6.2: Psychophysik des Temperatursinns.
Abb. 6.3: Verlauf der Temperaturempfindung bei Erwärmung und Abkühlung.
Abb. 6.4: Der Weber-Quotient in Abhängigkeit von der Adaptationstemperatur.
Abb. 6.5: Lage der Warm- und Kaltschwellen bei linearen Temperaturänderungen verschiedener Richtung und Geschwindigkeit.
Abb. 6.6: Mittelwerte der Warm- und Kaltschwellen in Abhängigkeit von der Änderungsgeschwindigkeit dυ/dt und der Absoluttemperatur υ.
Abb. 6.7: Warmschwellen in Abhängigkeit von der Reizfläche.
Abb. 6.8: Unterschiedsschwellen bei der dynamischen Temperaturempfindung in Abhängigkeit von Körperareal und Alter.
Abb. 6.9: Der Drei-Schalen-Versuch.
Abb. 6.10: Drei-Schalen-Versuchsreihe mit variierter Temperatur.
Abb. 6.11: Abgleichsexperiment für die Temperatur.
Abb. 6.12: Prüftemperaturen mit ihren jeweiligen Abgleichstemperaturen.
Abb. 8.1: Temperaturverteilung beim Menschen.
Abb. 8.2: Das Gegenstromprinzip des arteriovenösen Wärmeaustauschs.
Abb. 8.3: Mechanismen der Wärmeabgabe in Ruhe.
Abb. 8.4: Schema zur Thermoregulation des Menschen.
Abb. 8.5: Modell der neuronalen Verschaltung der thermischen Afferenzen.
Abb. 9.1: Schema eines Seitenorgans (Amphiden) mit Temperaturrezeptor.
Abb. 9.2: Schnitt durch ein Antennenglied eines Schmetterlings mit Triade.
Abb. 9.3: Das Grubenorgan der Schlange.
Teil II:
Abb. 2.1: Bauplan für eine Thermode.
Abb. 2.2: Die selbst gebaute Thermode.
Abb. 2.3: Mit Thermoden ermittelte Warmpunkte und Kaltpunkte.
Abb. 2.4: Die „Zauberkiste“ aus dem Drei-Schalen-Versuch.
Abb. 2.5: Versuchsaufbau Drei-Schalen-Versuch mit „Zauberkiste“.
Tabellen
Teil I:
Tab. 2.1: Mittelwerte der Kalt- und Warmpunkte je cm² der Haut.
Tab. 4.1: Übersicht identifizierter thermosensitiver Ionenkanäle.
Tab. 7.1: Wärmeleitzahlen κ einiger Materialien bei 300 K.
Tab. 7.2: An der Hautoberfläche erwarteter Temperatursprung ΔT (in °C).
Teil II:
Tab. 1.1: Auszug aus dem Lehrplan des Landes Rheinland-Pfalz.
Einleitung
Tagtäglich nehmen wir Temperaturen wahr – Lufttemperaturen, Wassertemperaturen, Objekttemperaturen. Dabei merken wir bisweilen, dass unsere Temperaturempfindung beeinflussbar ist. So hat jeder schon einmal erlebt, dass eiskalte Hände gewöhnliches Leitungswasser deutlich warm empfinden und dass ein Löffel aus Metall wesentlich kälter erscheint als ein daneben stehender Kunststoffbecher. Obgleich wir diese und viele andere Erfahrungen mit der Temperatur gemacht haben, denken wir kaum über unsere Temperaturempfindungen und ihr Zustandekommen nach.
Diese Arbeit setzt sich intensiv mit den physiologischen Grundlagen der Temperaturwahrnehmung auseinander. Dabei werden Parallelen und Unterschiede zwischen der objektiven Reizaufnahme und –verarbeitung im Nervensystem und der subjektiven Empfindung aufgezeigt (Teil I). Außerdem werden fünf schultaugliche Versuche vorgestellt, die verschiedene Aspekte der Temperaturwahrnehmung eindrucksvoll demonstrieren. Die Versuche können im Unterricht als Ansatzpunkt für eine vielschichtige Diskussion des Temperatursinns genutzt werden (Teil II).
Der erste Teil meiner Arbeit gliedert sich in neun Kapitel, die den theoretischen Hintergrund für das Verständnis des Temperatursinns liefern. Nach einer allgemeinen Einleitung in die Grundbegriffe der Sinnesphysiologie (I. 1), stelle ich die Haut und ihre Sinne vor (I. 2). Anschließend gehe ich im Rahmen der objektiven Sinnesphysiologie zunächst auf das Entladungsverhalten der Thermosensoren (I. 3) und dann auf die molekulare und zentralnervöse Verarbeitung von thermischen Reizen ein (I. 4 – I. 5). Daraufhin gebe ich einen Einblick in die subjektive Dimension der Sinnesphysiologie, indem ich die Psychophysik des Temperatursinns darlege (I. 6). In diesem Zusammenhang erläutere ich auch die besondere Fähigkeit des Temperatursinns, aus dem Verlauf von Temperaturänderungen auf das Material von Objekten zu schließen (I. 7). In einem weiteren Kapitel diskutiere ich den Beitrag kutaner Thermosensoren zur Thermoregulation (I. 8). Um den Bezug zur Biologie zu vertiefen, gehe ich schließlich auf Spezialisierungen des Temperatursinns bei ausgewählten Tierarten ein (I. 9).
Im zweiten Teil dieser Arbeit stelle ich kurz die Bedeutung von Schulversuchen und ganzheitlichem Lernen heraus. Überdies verorte ich das Thema „Temperaturwahrnehmung“ im Lehrplan des Landes Rheinland-Pfalz und den Bildungsstandards (II. 1). Dann präsentiere ich fünf Versuche, in denen die SchülerInnen ihren Temperatursinn und seine physiologischen Grundlagen kennen lernen können. Die Versuche werden unter Rückbezug auf die theoretischen Grundlagen in Teil I ausgewertet (II. 2).
I. Theoretischer Hintergrund
1. Grundbegriffe der Sinnesphysiologie
Die Sinnesphysiologie hat zwei Dimensionen: Einerseits beschäftigt sie sich mit den physikochemischen Vorgängen bei der Erregung von Sinnesorganen und deren Verarbeitung im Nervensystem (objektive Sinnesphysiologie). Andererseits untersucht sie die subjektiven Empfindungen, die durch Sinnesreize hervorgerufen werden (subjektive Sinnesphysiologie / Psychophysik) (Campenhausen 1993; Schmidt, Thews, Lang 2000).
Meist folgen die bewussten Wahrnehmungen den gleichen Spielregeln wie die Informationsverarbeitung in den Sensoren und sensorischen Neuronen (Schmidt 2001). Allerdings kommt es auch vor, dass eine Empfindung trotz Aktivität der Sensoren ausbleibt. Dies tritt zum Beispiel auf, wenn die Sensoraktivität unterschwellig war oder wenn sie prinzipiell von der Sphäre bewusster Wahrnehmung ausgeschlossen ist (Hick, Hick 2002). Gerade solche Abweichungen zwischen Sensoraktivität und Empfindungsintensität machen eine separate Betrachtung der beiden Ebenen notwendig. Meine Besprechung der Temperaturwahrnehmung wird ebenfalls zwischen den Erkenntnissen der objektiven Sinnesphysiologie und denen der Psychophysik unterscheiden. Daher sollen im Folgenden zunächst einige wichtige Grundbegriffe erläutert werden.
1.1 Objektive Sinnesphysiologie
Die Aufnahme von physikalischen Reizen aus der Umwelt und deren Übersetzung in elektrische Signale erfolgt über die Rezeptoren der Sinnesorgane (Transduktion). Rezeptoren können Membranabschnitte einer Sinneszelle oder rezeptive Nervenendigungen sein. Um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen, spricht man bei den „sinnesphysiologischen Rezeptoren“ auch von Sensoren.[1] Im Laufe der Evolution haben sich spezialisierte Sensoren herausgebildet, die jeweils auf bestimmte physikalische oder chemische Reize optimal reagieren. Die Reizform, für die ein Sensor besonders empfindlich ist, ist sein adäquater Reiz. Dieser bewirkt eine Änderung der Membranleitfähigkeit und somit ein graduiertes Sensorpotential, welches (meist) depolarisierend ist und die Reizstärke kodiert.
Nach dem Bau der Sinneszellen wird zwischen primären und sekundären Sinneszellen unterschieden. Bei den primären Sinneszellen ist die Sensorzone Teil eines afferenten Neurons, so dass ein überschwelliges Sensorpotential bereits am Axonhügel derselben Zelle in Aktionspotentialfolgen unterschiedlicher Frequenz umkodiert wird (Transformation). Im Gegensatz dazu ist bei sekundären Sinneszellen die synaptische Übertragung von der Sinneszelle auf ein nachgeschaltetes afferentes Neuron erforderlich. Erst im afferenten Neuron werden Aktionspotentiale generiert und über dessen Axon fortgeleitet. Im Bereich somatoviszeraler Sensibilität findet man in der Regel primäre Sinneszellen, deren periphere Dendritenendigungen als rezeptive Strukturen fungieren. Solche reizaufnehmenden Endigungen können als nackte Nervenendigungen frei im Gewebe liegen oder in spezialisierte Strukturen, z. B. Korpuskeln, eingebettet sein. (Hick, Hick 2002; Schmidt, Thews, Lang 2000).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1.1: Der Weg vom Reiz zum Aktionspotential in primären (a) und sekundären (b) Sinneszellen. SP = Sensorpotential, AP = Aktionspotential, S = Synapse, EPSP = exzitatorisches postsynaptisches Potential.
Sinneszellen und afferente Neurone lassen sich nach ihrem zeitabhängigen Antwortverhalten charakterisieren. So unterscheidet man zwischen phasischem (= dynamischem, differentialem), tonischem (= statischem, proportionalem) und phasisch-tonischem (= proportional-differentialem) Antwortverhalten.
Bei Sinneszellen mit phasischem Antwortverhalten steigert sich die Entladungsfrequenz gemäß der Geschwindigkeit der Reizänderung und eine Adaptation erfolgt schnell. Die zugehörigen Sensoren nennt man daher auch Geschwindigkeitssensoren oder RA-Sensoren (= R apidly A dapting).
Sinneszellen, die auf einen konstanten Reiz ununterbrochen weiterfeuern, zeigen eine tonische Antwort. Die Entladungsfrequenz solcher Sinneszellen ist direkt proportional zur Intensität des Reizes und eine Adaptation erfolgt nur langsam. Die entsprechenden Sensoren heißen Intensitätssensoren oder SA-Sensoren (= S lowly A dapting).
Die meisten Sinneszellen sind Mischtypen, indem sie phasisch-tonisches Antwortverhalten zeigen. In Form von erhöhten Impulsraten übermitteln sie sowohl Informationen über die Reizgröße (Proportionalantwort) als auch über die Geschwindigkeit der Reizänderung (Differentialantwort). Man bezeichnet die zugehörigen Sensoren als PD-Sensoren (= P roportional- D ifferential) (Hick, Hick 2002; Schmidt, Thews, Lang 2000).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1.2: Adaptation von Sinneszelltypen an einen konstanten Reiz.
1.2 Psychophysik
Die Psychophysik ist eine Wissenschaft, die den physikalischen und neurobiologischen Aspekten der naturgegebenen Wahrnehmungsfähigkeit nachspürt (Campenhausen 1993). Sie hat ihre Ursprünge im 19. Jahrhundert. Da zu dieser Zeit noch recht wenig über die Arbeitsweise der Sinnesorgane bekannt war, beschäftigte sich die Psychophysik ausführlich mit der Beziehung zwischen physikalischen Reizen und subjektiven Empfindungen (Schmidt, Thews, Lang 2000). Um solche subjektiven Empfindungen messen zu können, ist die Psychophysik auf die Mitarbeit von Versuchspersonen angewiesen (Campenhausen 1993; Hick, Hick 2002).
Ein zentrales Konzept der Psychophysik ist das der sensorischen Reizschwelle (= Reizlimen, Absolutschwelle). Man versteht darunter die kleinste Reizintensität, die gerade noch eine Empfindung hervorruft. Sie kann z. B. mit der Grenzmethode oder der Konstantreizmethode ermittelt werden.[2] Bei der Untersuchung überschwelliger Reize lässt sich noch eine weitere Schwelle definieren, die Unterschiedsschwelle (= Differenzlimen). Es handelt sich um den Betrag, um den ein Reiz größer sein muss als ein Vergleichsreiz, damit er gerade eben merklich als stärker empfunden wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dass eine genau definierte Beziehung zwischen Reizzuwachs und Vergleichsreiz besteht, wurde als erstes von E. H. Weber (1834) entdeckt. Er stellte beim Vergleich von Gewichten fest, dass zwei schwere Gewichte sich um einen größeren Betrag unterscheiden müssen als zwei leichte, damit sie unterschieden werden können. Aus dieser Beobachtung entwickelte er folgende Formel, die als Weber-Gesetz bekannt ist:
Δφ / φ = c
Der Weber-Quotient aus nötigem Reizzuwachs und Ausgangsreizgröße ist im Bereich mittlerer Reizstärken konstant. Es muss also immer ein konstanter Bruchteil des Ausgangsreizes hinzugefügt werden, damit die Unterschiedsschwelle überschritten wird (vgl. Abb. 1.3 A). Bei kleinen Reizen nahe der Absolutschwelle ist der Weber-Quotient allerdings nicht mehr konstant. Je näher die Reize an der Schwelle liegen, desto größer muss der relative Reizzuwachs sein, um einen Empfindungsunterschied hervorzurufen (vgl. Abb. 1.3 B). Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass die Rezeption schwacher Reize von der Spontanaktivität der Sinneszellen („Rauschen“) überlagert wird (Schmidt, Thews, Lang 2000).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1.3: Der Weber-Quotient und Webers Gesetz.
A: Beziehung zwischen Ausgangsreizgröße (φ) und Reizzuwachs, der zur Überschreitung der Unterschiedsschwelle benötigt wird (Δφ); hier für den Kraftsinn dargestellt.
B: Abhängigkeit des Weber-Quotienten (Δφ/φ) von der Reizstärke des Ausgangsreizes am Beispiel akustischer Reize. Nur bei Reizen, die mehr als 40dB über der Absolutschwelle liegen, ist der Weber-Quotient eine Konstante.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In der Tat ist es problematisch, dass sich die Häufigkeitsverteilungen der Spontanaktivität der Sinneszellen und ihre Antworten auf einen schwellennahen Reiz überschneiden. Im Überschneidungsfeld kann eine Versuchsperson nicht entscheiden, ob es sich um Spontanaktivität oder eine Reizantwort handelt. Um dieses Problem zu lösen geht die Sensorische Entscheidungstheorie davon aus, dass jede Versuchsperson eine Entscheidung darüber treffen muss, wo sie die Trennlinie zwischen der Annahme einer Spontanaktivität und einer Reizantwort zieht. Diese Trennlinie nennt man auch Kriterium. Abbildung 1.4 zeigt, dass die Festsetzung eines Kriteriums (b) zwangsläufig zu Fehleinschätzungen führt. So werden die im violetten Überschneidungsfeld liegenden Fälle von Spontanaktivität fälschlich für eine Reizantwort gehalten („falscher Alarm“). Im roten Überschneidungsfeld werden Reizantworten nicht als solche erkannt, sondern der Spontanaktivität zugeordnet („Auslasser“).
Bei starken Reizen tritt das Problem der Schwellenerkennung nicht auf, da das von ihnen ausgelöste Antwortverhalten weit getrennt von der Spontanaktivität liegt (Schmidt, Thews, Lang 2000).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1.4: Schematische Darstellung der Verteilung von Spontanaktivität und Antworten auf einen schwellennahen Sinnesreiz. Das Kriterium b ist eine durch Entscheidung festgelegte Trennlinie zwischen einer Interpretation der Sensoraktivität als Spontanaktivität oder Reizantwort. Im Überschneidungsfeld der Häufigkeitsverteilung kommt es notwendigerweise zu Fehlentscheidungen (Auslasser bzw. falscher Alarm).
Als eigentlicher Begründer der Psychophysik gilt Gustav Theodor Fechner (1801-1887). Ausgehend von den Unterschiedsschwellen und Webers Gesetz entwickelte er eine Skala der Empfindungsstärke, indem er die Empfindungsstärke ψ gegen die Reizstärke φ auftrug (vgl. Abb. 1.5). Als Nullpunkt der Abszisse wählte er die Absolutschwelle φ0 (R0). Auf der Ordinate definierte er die Unterschiedsschwellen Δψ als Grundeinheiten der Empfindungsstärke ψ. Damit eine Unterschiedsschwelle überschritten wird, muss der Reizzuwachs Δφ (ΔR) ein stets konstanter Bruchteil des Vergleichsreizes φ (R) sein (Weber-Quotient). Dies impliziert, dass ein größerer Ausgangsreiz einen entsprechend größeren Reizzuwachs erfordert, damit ein Empfindungsunterschied auftritt.[3]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1.5: Schematische Darstellung der Beziehung zwischen Reizstärke (φ) und Empfindungsgröße (ψ) nach Fechners psychophysischer Beziehung. Auf der Ordinate definiert die Unterschiedsschwelle (DL) den kleinstmöglichen Empfindungszuwachs. Da die Unterschiedsschwelle nach Webers Gesetz eine Zunahme der wirkenden Reizgröße um eine Konstante Δφ/φ (ΔR/R) bedeutet, wird bei größeren Ausgangsreizen (Rb) ein größerer Reizzuwachs ΔRb benötigt als bei kleineren Ausgangsreizen (Ra). R0 =Reizstärke zum Erreichen der Empfindungsschwelle; ΔR = nötiger Reizzuwachs zum Überschreiten einer Unterschiedsschwelle; DL = eben merklicher Empfindungszuwachs.
Der von Fechner untersuchte Zusammenhang zwischen Reizstärke φ und Empfindungsintensität ψ lässt sich auch mit einer Logarithmusfunktion beschreiben:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ψ = k · log φ
Da diese Gleichung aus dem Weberschen Gesetz herzuleiten ist, spricht man auch vom Weber-Fechner-Gesetz. Über einen weiten Bereich zeigt sich eine proportionale Beziehung zwischen Empfindungsintensität ψ und Logarithmus der Reizstärke φ. Dennoch wird die Empfindungsintensität nicht beliebig groß. Sie strebt vielmehr einem oberen Sättigungswert zu (vgl. Abb. 1.6) (Campenhausen 1993).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1.6: Der Zusammenhang zwischen Empfindungsintensität ψ und Logarithmus der Reizstärke φ entspricht einer sigmoiden Kurve.
2. Die Haut und ihre Sinne
Die Haut des Menschen dient nicht nur als Schutzhülle des Körpers, sie ist gleichzeitig auch ein hochempfindliches Sinnesorgan. Neben dem Temperatursinn (Thermorezeption) werden über die Haut auch Druck- bzw. Berührung (Mechanorezeption) und Schmerz (Nozizeption) vermittelt.[4] Die Unabhängigkeit dieser drei Hautsinne ist vielfach belegt worden und zeigt sich an neurologischen Erkrankungen, bei denen die Wahrnehmung von Wärme, Kälte, Berührung oder Schmerz selektiv gestört ist (Klinke, Silbernagl 2000; Hick, Hick 2002).
Die Haut besteht aus Epidermis (Oberhaut), Corium (Lederhaut) und Subcutis (Unterhaut) (vgl. Abb. 2.1). Die Epidermis ist ein gefäßloses, vielschichtiges, epitheliales Gewebe. Sie erneuert sich ständig in ihren basalen Anteilen und verhornt in den höher gelegenen. Das Corium wird von vielen Blutgefäßen (rot, blau) sowie von Nervenfasern (gelb) durchzogen. Schweißdrüsen (grün) aus dem Corium haben ihre Ausgänge in Poren an der Hautoberfläche. Weiterhin besitzt jedes Haar einen Aufrichtmuskel und eine Talgdrüse im Corium. Die Subcutis enthält vor allem Fettgewebe (Weitz 1998).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.1: Der Aufbau der behaarten Haut beim Menschen.
Entsprechend der drei Hautsinne befinden sich in der Haut Nozi -, Mechano - und Thermosensoren, die auf ihre jeweiligen adäquaten Reize ansprechen. Es handelt sich bei all diesen Sensoren um die peripheren Endigungen afferenter Nervenfasern; es sind also primäre Sinneszellen (vgl. Kapitel I. 1.1). Grundsätzlich liegen die Nervenendigungen frei im Gewebe. Nur manche Typen von Mechanosensoren sind in Korpuskeln eingebettet. Die Sensoren der Haut sind hauptsächlich im Corium lokalisiert, ragen aber teilweise auch in die basalen Zellen der Epidermis hinein (Klinke, Silbernagl 2000). Schmerz-, Tast- und Temperatursinn sind diskontinuierlich über die Haut verteilt, das heißt die reizempfindlichen Punkte sind von unsensiblen Hautflächen umgeben. Die Dichte der sensiblen Punkte variiert je nach Sensortyp. So sind die Schmerzpunkte wesentlich häufiger als die Tastpunkte (Verhältnis 7:1),[5] welche wiederum öfter vorkommen als die Temperaturpunkte (Hick, Hick 2006).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.2: Die durchschnittliche Dichte von Warm-, Kalt-, Druck- und Schmerzpunkten auf einem Hautfeld mit Durchmesser 2cm.
2. 1 Mechanosensoren
Die Mechanosensoren gliedern sich in vier Grundtypen mit markhaltigen Afferenzen der Gruppe II (Aβ): SA-I-, SA-II-, RA- und PC-Sensoren (vgl. Kapitel I. 1.1). Die einzelnen Typen kodieren unterschiedliche Aspekte eines mechanischen Hautreizes. Bei komplexen Reizen (z. B. beim Tastvorgang) werden sie jedoch gleichzeitig erregt und ihre Entladungen im ZNS integriert.
In der unbehaarten Haut entsprechen die SA-I-Sensoren den Merkel-Zellen, SA-II-Sensoren den Ruffini-Körperchen, RA-Sensoren den Meißner-Körperchen und PC-Sensoren den Vater-Pacini-Körperchen. In der behaarten Haut gibt es keine Meißner-Körperchen und stattdessen sensorisch innervierte Haarwurzeln (Haarfollikelsensoren, RA-Sensoren). Als SA-Sensoren sind die Merkel-Zellen und Ruffini-Körperchen langsam adaptierende Intensitätssensoren, wobei die Merkel-Zellen auf Reize senkrecht zur Hautoberfläche und Ruffini-Körperchen auf Dehnungen der Haut reagieren. Die Meißner-Körperchen und Haarfollikelsensoren registrieren die Geschwindigkeit der Hautdeformation und adaptieren schnell. Die Vater-Pacini-Körperchen kodieren die Beschleunigung eines mechanischen Hautreizes und werden somit als Beschleunigungssensoren (PC-Sensoren) bezeichnet (Schmidt, Thews, Lang 2000; Klinke, Silbernagl 2000).
2. 2 Nozizeptoren
Die meisten Nozizeptoren besitzen marklose Axone der Gruppe IV (C) mit Leitungsgeschwindigkeiten unter 2,5 m/s. Seltener sind Nozizeptoren mit markhaltigen Axonen der Gruppe III (Aδ) und Leitungsgeschwindigkeiten zwischen 2,5 und 20 m/s. Für alle Nozizeptoren gilt, dass sie eine sehr hohe Erregungsschwelle besitzen. Folglich werden sie nur durch gewebeschädigende oder gewebebedrohende Reize („Noxen“) aktiviert. Im Gegensatz zu den Mechano- und Thermosensoren, die auf spezifische Reizmodalitäten reagieren, sind Nozizeptoren polymodal. Das heißt, sie nehmen sowohl mechanische, als auch thermische und chemische Reize wahr, sobald diese in noxischer Intensität auf den Körper wirken. Die Noxen können zu einer direkten Erregung der Nozizeptoren führen. Meist erfolgt die Aktivierung jedoch erst nach einer Kette von Zell- und Gewebereaktionen, an deren Ende erregende Stoffe freigesetzt werden.
Die Reizschwelle der Nozizeptoren hängt erheblich vom Zustand des Gewebes ab. Während Nozizeptoren in gesundem Gewebe hohe Schwellen besitzen bzw. insensitiv sind, werden ihre Schwellen z. B. in entzündetem Gewebe abgesenkt. Zusätzlich werden „stumme“ Sensoren aktiviert. Eine solche Sensibilisierung pathophysiologisch veränderter Gewebe erfolgt vermutlich über Entzündungsmediatoren. Diese werden bei Gewebsläsionen entweder freigesetzt (z. B. Bradykinin, Serotonin) oder vermehrt synthetisiert (z. B. Prostaglandine, Leukotriene) (Schmidt, Thews, Lang 2000).
2. 3 Thermosensoren
Neben Tast- und Schmerzpunkten gibt es in der Haut auch temperaturempfindliche Punkte, welche von unsensiblen Arealen umgeben sind. Ein einzelner Temperaturpunkt hat einen Durchmesser von weniger als 1mm (Pierau 2001). An jedem Punkt lässt sich nur entweder eine Kalt- oder eine Warmempfindung auslösen, so dass man von spezifischen Kalt- und Warmpunkten spricht. Die Zahl der Kaltpunkte überwiegt deutlich: So finden sich z. B. auf der Handfläche 1-5 Kaltpunkte/cm2 aber nur 0,4 Warmpunkte / cm2 (Schmidt, Thews, Lang 2000). Wie die folgende Tabelle zeigt, hängt die Dichte der Temperaturpunkte außerdem stark von der Körperregion ab. Bei Säugetieren und vielen anderen Vertebraten sind die Temperaturpunkte im Gesichtsbereich besonders zahlreich (Pierau 2001).
Tab. 2.1: Mittelwerte der Kalt- und Warmpunkte je cm² der Haut.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die spezifischen Kalt- und Warmpunkte auf der Hautoberfläche deuten bereits auf das Vorhandensein zweier Sensortypen hin. Neurophysiologische Untersuchungen bei Mensch und Tier bestätigen dies.[6] So werden die Kalt- bzw. Warmpunkte tatsächlich von spezifischen Kalt- bzw. Warmsensoren innerviert, deren rezeptive Felder sie sind. Ein doppelter Sensorensatz für die Verarbeitung eines einheitlichen Reizes wie der Temperatur ist insofern sinnvoll, als dass er – ähnlich wie die On- und Off-Bipolarzellen in der Netzhaut des Auges – die Empfindlichkeit und Präzision der Wahrnehmung verbessert (vgl. Kapitel I. 6.2) (Pierau 2001).
Histologisch sind die Kalt- und Warmsensoren nicht von Nozizeptoren zu unterscheiden, da es sich auch bei ihnen um die unmyelinisierten Nervenendigungen afferenter Neurone handelt (Hick, Hick 2002). Alle bisher untersuchten Temperatursensoren gehören zu den primären Sinneszellen (Pierau 2001). Ihre Axone sind marklos (Faserklasse IV (C)) bis auf einen Teil der Kaltfasern, die der markhaltigen Faserklasse III (Aδ) angehört.[7] Die Leitungsgeschwindigkeit beider Faserklassen ist mit weniger als 20m/s relativ langsam. Die folgende Tabelle fasst die Axon-Eigenschaften sämtlicher Hautsensoren zusammen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.3: Durchmesser und Leitungsgeschwindigkeiten der Axone der wichtigsten Hautsensoren beim Menschen. Beschleunigungsdetektoren = PC-Sensoren (Vater-Pacini-Körperchen), Geschwindigkeitsdetektoren = RA-Sensoren (Meißner-Körperchen, Haarfollikelsensoren), Intensitätsdetektoren Typ I = SA-I-Sensoren (Merkel-Zellen), Intensitätsdetektoren Typ II = SA-II-Sensoren (Ruffini-Körperchen).
Die rezeptiven Endstrukturen der Kaltsensoren befinden sich in oder unmittelbar unterhalb der Epidermis. Dies bedeutet, dass sie in behaarter Haut nur etwa 100μm und in unbehaarter Haut etwa 160μm unter der Oberfläche liegen (Pierau 2001). Die Warmsensoren sind im Corium lokalisiert, also tiefer als die Kaltsensoren (Hick, Hick 2002). Bei den Kaltsensoren weiß man außerdem, dass sich die freien Nervenendigungen zu kolbenartigen Endstrukturen erweitern, die eine Vielzahl von Mitochondrien und Glykogenpartikeln enthalten. Details über die rezeptiven Strukturen von Warmsensoren sind noch unbekannt (Pierau 2001).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.4: Lage und Struktur der Thermosensoren in der Haut.
Schon an dieser Stelle soll kurz darauf hingewiesen werden, dass es nicht nur in der Haut, sondern auch im Körperkern spezifische Kalt- und Warmsensoren gibt. Zur besseren Unterscheidung spricht man daher von äußeren und inneren Temperatursensoren. Die inneren Temperatursensoren lassen sich erneut aufgliedern in Sensoren der Peripherie (Eingeweide, Muskeln) und Sensoren des Zentralnervensystems (= ZNS) (Rückenmark, Hirnstamm) (Pierau 2001).
Die äußeren und inneren Temperatursensoren sind nicht nur an verschiedenen Stellen des Körpers lokalisiert, sie haben auch unterschiedliche Funktionen. Während die äußeren Thermosensoren vor allem der bewussten Temperaturwahrnehmung dienen, sind die inneren Thermosensoren für die unbewusst ablaufende Temperaturregulation verantwortlich. Dennoch sind Temperaturwahrnehmung und –regulation physiologisch eng verknüpft: Indem die äußeren Sensoren die Temperatur der Körperschale und ihre Veränderungen registrieren, ermöglichen sie dem thermoregulatorischen Zentrum im hinteren Hypothalamus eine frühzeitige Gegenregulation (vgl. Kapitel I. 8). Die thermoregulatorische Gesamtsituation beeinflusst umgekehrt die affektive Tönung (Behaglichkeit, Unbehaglichkeit) der bewussten Temperaturwahrnehmung (Pierau 2001; Schmidt, Thews, Lang 2000; Klinke, Silbernagl 2000; Schmidt 2001).
3. Thermosensoren als Proportional-Differential-Fühler
Kutane Thermosensoren zeigen eine Aktivität im nichtschmerzhaften Temperaturbereich.[8] Da es sich bei den Thermosensoren um PD-Sensoren handelt, ist ihr Entladungsverhalten gekennzeichnet durch eine temperaturabhängige tonische Ruheaktivität (Proportionalantwort) und eine dynamische Reaktion bei Temperaturänderungen (Differentialantwort) (Pierau 2001).
3. 1 Entladungsverhalten bei konstanter Hauttemperatur
Trägt man in einem Koordinatensystem die Temperatur und die statische Impulsfrequenz der Sensoren gegeneinander auf, so erhält man nicht-lineare glockenförmige Antwortkurven mit einem für den jeweiligen Sensor charakteristischen Maximalwert. Aufgrund der Glockenform der Kurve kann dieselbe Impulsfrequenz (Y-Wert) durch zwei verschiedene Temperaturen (X-Werte) ausgelöst werden (vgl. Abb. 3.1). Die Erregungssignale der einzelnen Sinneszellen sind folglich nicht eindeutig. Die dennoch relativ zuverlässige Information über konstante Temperaturen wird durch eine massive Konvergenz von Temperatursensoren mit unterschiedlichen Kennlinien auf den verschiedenen Ebenen des aszendierenden Signalwegs im ZNS und durch Umformungen (besonders im Hirnstamm) ausgeglichen (vgl. Kapitel I. 5) (Pierau 2001).
Unter stationären Bedingungen antworten Kältesensoren auf Temperaturen zwischen 10°C und 40°C, wobei sie bei 30°C am empfindlichsten sind (Klinke, Silbernagl 2000).[9] Einige Kältesensoren zeigen eine zusätzliche Aktivität zwischen 45°C und 53°C, die als paradoxe Kälteempfindung bezeichnet wird (Pierau 2001). Wärmesensoren werden unter stationären Bedingungen durch Temperaturen zwischen 30°C und 45°C erregt (Klinke, Silbernagl 2000).[10] Sie haben ihre maximale Entladungsfrequenz bei 43°C (vgl. Abb. 3.1) (Schmidt, Thews, Lang 2000).[11] Bei Temperaturen unter 5°C und über 45°C werden die Nozizeptoren gereizt und es kommt zur Schmerzempfindung (Hick, Hick 2002).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3.1: Entladungen von Kalt- und Warmsensoren. Oben: Gemittelte Impulsfrequenzen mehrerer Afferenzen von Kalt- und Warmsensoren in Abhängigkeit von der konstant gehaltenen Hauttemperatur. Nicht dargestellt ist die Tatsache, dass einige Kaltsensoren bei Erhöhung der Temperatur über 45°C erneut aktiv werden. Unten: Antworten von jeweils einem Kalt- und Warmsensor auf vorübergehende Erwärmung und Abkühlung der Haut.
Die spontane Entladungsfrequenz der Kältesensoren variiert unter stationären Temperaturbedingungen zwischen 2 und 10 Impulsen pro Sekunde. Bei Wärmesensoren liegt sie mit 5-20 Impulsen pro Sekunde wesentlich höher (vgl. Abb. 3.1). Die exakte Impulsrate ist bei beiden Sensortypen von Körperareal und Tierart abhängig (Pierau 2001).
3. 2 Entladungsverhalten bei Änderungen der Hauttemperatur
Da die Arbeitsbereiche von Kälte- und Wärmesensoren zwischen 30°C und 40°C eine erhebliche Überlappung zeigen, können sie nicht zuverlässig durch ihre stationäre Kennlinie unterschieden werden. Die Unterscheidung gelingt durch ihre dynamische Antwort bei Temperaturänderungen (Pierau 2001).
Kältesensoren
Die Kältesensoren zeigen eine dynamische Antwort bei schneller Abkühlung: Die Entladungsfrequenz steigt vorübergehend an. Nach einer Adaptationszeit, die länger als eine Minute dauern kann, verringert sich die Frequenz und stabilisiert sich auf einem erhöhten stationären Wert. Eine rasche Erwärmung bewirkt bei Kältesensoren einen kurzfristigen Abfall bzw. eine Hemmung der Entladungsfrequenz. Nach kurzer Zeit steigt die Entladungsfrequenz dann wieder auf einen neuen, niedrigeren adaptiven Wert an (vgl. Abb. 3.1). Die maximale dynamische Antwort der Kältesensoren liegt beim Menschen bei nur etwa 30 Impulsen pro Sekunde. Einzelne Kältesensoren können jedoch bis zu 300 Impulse pro Sekunde abgeben (Pierau 2001).
Die maximale Antwort von Kältesensoren ist sowohl von der Reizamplitude als auch von der Geschwindigkeit der Temperaturänderung abhängig: Je höher die Reizamplitude bzw. die Geschwindigkeit der Reizänderung desto größer ist die maximale Antwort. Die kumulative Zahl der zusätzlich zum proportionalen Anteil auftretenden Impulse nimmt allerdings nur mit steigender Reizamplitude zu. Mit zunehmender Geschwindigkeit wird sie kleiner (vgl. Abb. 3.2) (Pierau 2001).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3.2: Abhängigkeit der dynamischen Antwort von Kältesensoren von Amplitude und Geschwindigkeit der Temperaturänderung. Kumulative Anzahl der zusätzlich zum proportionalen Anteil auftretenden Impulse von kutanen Kältesensoren während linearer Abkühlung mit 0,4°C und 2,0°C pro Sekunde. Das rezeptive Feld wurde jeweils um 1°C, 2°C, 3°C und 5°C abgekühlt.
Wärmesensoren
Der Verlauf der dynamischen Reaktion von Wärmesensoren ist das Spiegelbild der Antwort von Kältesensoren: Schnelle Erwärmung des rezeptiven Feldes führt zu einer vorübergehenden starken Aktivitätssteigerung. Es folgt eine relativ rasche Rückkehr der Entladungsfrequenz auf einen neuen, erhöhten stationären Wert. Umgekehrt bewirkt schnelle Abkühlung eine Abnahme der Entladungsfrequenz oder sogar eine vollständige Hemmung der Aktivität. Nach einer Weile stabilisiert sich die Entladungsrate auf einem konstanten niedrigen Niveau. Die maximale dynamische Entladungsfrequenz der Wärmesensoren liegt im Allgemeinen deutlich höher als die der Kältesensoren. Bei Wärmesensoren der Katzennase sind maximale dynamische Entladungsfrequenzen von 200 Impulsen pro Sekunde beobachtet worden (vgl. Abb. 3.1).
Ähnlich wie bei den Kältesensoren ist die Entladungsfrequenz der Wärmesensoren von der Reizamplitude und der Geschwindigkeit der Temperaturänderung abhängig: Je höher die Reizamplitude bzw. je schneller die Temperaturänderung, desto höher ist die maximale dynamische Antwort. Allerdings wächst bei den Wärmesensoren die kumulative Zahl der zusätzlich ausgelösten APs nicht nur mit zunehmender Reizamplitude, sondern auch mit zunehmender Geschwindigkeit an (vgl. Abb. 3.3) (Pierau 2001).
[...]
[1] Schmidt, Thews und Lang (2000) argumentieren, dass der Begriff „Rezeptor“ in den verschiedenen Fachrichtungen der Biologie und Medizin mehrfach belegt und somit nicht mehr eindeutig ist. Aus diesem Grunde schlagen sie für den „sinnesphysiologischen Rezeptor“ die Bezeichnung „Sensor“ vor.
[2] Bei der Grenzmethode werden abwechselnd auf- und absteigende Serien von Reizintensitäten dargeboten. Man erhält auf diese Weise verschiedene Werte für die Reizschwelle, deren Mittelwerte als Schätzung des Schwellenwertes genommen wird.
Bei der Konstantreizmethode werden verschiedene Reizintensitäten in zufälliger Reihenfolge dargeboten. Dabei wird der Prozentsatz der wahrgenommenen Reize verschiedener Reizstärken gemessen. Man trägt die relative Wahrnehmungshäufigkeit in Abhängigkeit von der Reizstärke in einem Koordinatensystem dar und verbindet die Punkte. Die Schwelle ist der Punkt auf der meist S-förmigen Kurve, bei dem 50% der Reize erkannt werden.
[3] Fechners Skala beruht auf der Annahme, dass das Überschreiten einer Unterschiedsschwelle stets denselben Empfindungszuwachs bedeutet. Dies trifft jedoch nicht immer zu. S. S. Stevens konnte zeigen, dass das Überschreiten einer Unterschiedsschwelle nicht bei allen Ausgangsreizstärken den gleichen Zuwachs an Empfindungsintensität bringt. So wird ein Ton, der um 20 Unterschiedsschwellen über der Absolutschwelle liegt, mehr als doppelt so laut geschätzt wie ein entsprechender Ton, der um 10 Unterschiedsschwellen über dieser Schwelle liegt. Die Unterschiedsschwellen sind also letztlich keine allgemeingültigen Einheiten der Empfindungsstärke wie es in Abbildung 1.5 vorausgesetzt wird. Das Überschreiten einer Unterschiedsschwelle bedeutet lediglich, dass der neue Reiz vom vorigen unterschieden werden kann. Fechners psychophysische Beziehung sollte daher nicht als Skala der Empfindungsstärke, sondern als Skala der Unterscheidbarkeit bezeichnet werden (Schmidt, Thews, Lang 2000).
[4] Erst kürzlich fand Prof. Dr. Dr. Hanns Hatt vom Lehrstuhl für Zellphysiologie an der Ruhr-Universität Bochum heraus, dass die Haut auch Duftrezeptoren besitzt (Irmen 2005).
[5] Schmidt, Thews und Lang (2000) sprechen von einem Verhältnis von 9:1 zwischen Schmerz- und Tastpunkten.
[6] Kälte- und Wärmesensoren lassen sich nicht immer aufgrund ihrer statischen Antwort bei konstanten Temperaturen, wohl aber aufgrund ihrer dynamischen Antwort bei Temperaturänderungen unterscheiden (vgl. Kapitel I.3) (Pierau 2001).
[7] Der genaue Anteil der Kaltsensoren mit markhaltigen Axonen ist umstritten. Laut Klinke und Silbernagl (2000) besitzt nur ein Drittel der Kaltsensoren markhaltige Axone. Hick und Hick (2002) sprechen hingegen davon, dass der „größere Teil“ der Kaltfasern markhaltig ist. Ähnlich findet man bei Schmidt, Thews und Lang (2000), dass Kaltsensoren „meistens“ markhaltige Axone besitzen.
[8] Laut Pierau (2001) antworten Temperatursensoren auch auf moderate mechanische Reize.
[9] Der in der Literatur angegebene Arbeitsbereich der Kältesensoren sowie der Gipfelpunkt ihrer statischen Entladungsfrequenz variiert um einige Grad Celsius. So wird der Arbeitsbereich z. B. bei Pierau (2001) zwischen 5°C und 40°C festgesetzt. Der Gipfelpunkt liegt laut Pierau (2000) zwischen 25°C und 30°C und laut Schmidt, Thews, Lang (2000) bei 33°C.
[10] Der Temperaturbereich, in dem Wärmesensoren spontan aktiv sind, variiert in der Fachliteratur um wenige Grad Celsius. So liegt dieser Bereich z. B. laut Pierau (2001) zwischen 28°C und 48°C.
[11] Auch die Temperatur an der Wärmesensoren ihr Entladungsmaximum haben, ist nicht eindeutig festzulegen. Angaben in der Literatur liegen zwischen 40°C und 45°C (vgl. z. B. Klinke, Silbernagl 2000; Pierau 2001).
Details
- Titel
- Schultaugliche Versuche zur Temperaturwahrnehmung und ihre physiologischen Grundlagen
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2008
- Seiten
- 111
- Katalognummer
- V226774
- ISBN (eBook)
- 9783836629409
- Dateigröße
- 2866 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- thermosensoren ionenkanäle psychophysik temperatursinn thermoregulation
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2008, Schultaugliche Versuche zur Temperaturwahrnehmung und ihre physiologischen Grundlagen, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/226774
- Angelegt am
- 27.4.2009

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.



