Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos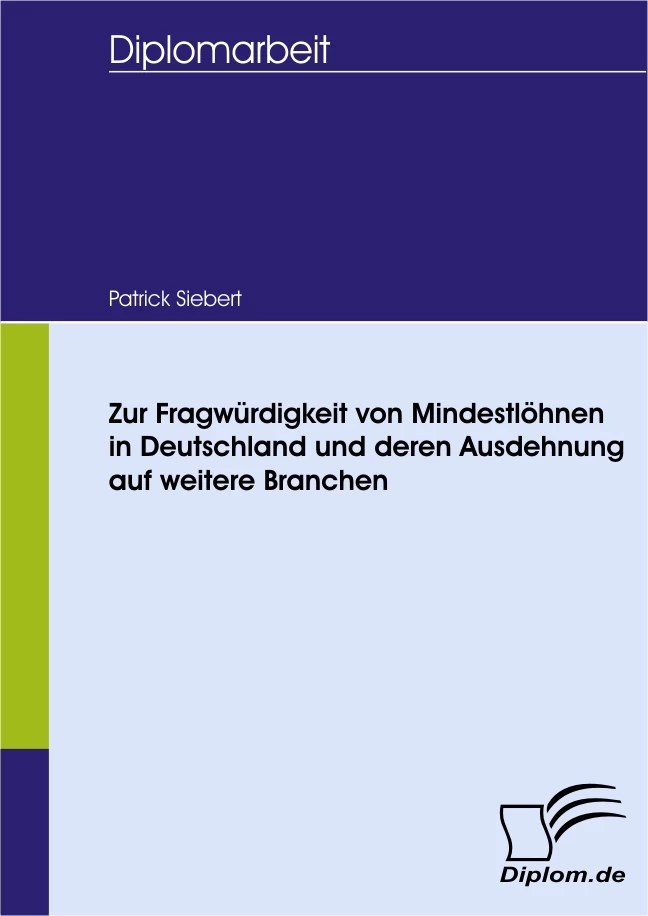
Zur Fragwürdigkeit von Mindestlöhnen in Deutschland und deren Ausdehnung auf weitere Branchen
Diplomarbeit, 2008, 104 Seiten
Autor

Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Universität Augsburg (Juristische Fakultät, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften)
Note
1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Einleitung
- 1 Die Möglichkeiten zur Einrichtung von Mindestlöhnen
I. Die gesetzlichen Grundlagen für Branchenmindestlöhne in Deutschland
1. Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG)
a) Das ursprüngliche AEntG
aa) Allgemeinverbindlicherklärung gem. § 5 TVG
bb) Allgemeinverbindlicherklärung gem. § 1 Abs. 3a AEntG
cc) Die Anwendung beider Formen
b) Das erste Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
c) Das zweite Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
2. Das Mindestarbeitsbedingungengesetz (MindArbBedG)
II. Die geplanten Änderungen für beide Gesetze
1. Die Einbeziehung weiterer Branchen in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz
2. Die Reformierung des Mindestarbeitsbedingungengesetzes
III. Der Stand der Entwicklung bis zum Stichtag 31.3.2008
- 2 Die aktuelle Mindestlohndebatte und ihre Hintergründe
I. Die Meinungen
1. Die Argumente der Mindestlohnbefürworter
a) Die Verhinderung von Lohndumping und ruinösem Wettbewerb
b) Jeder soll von seiner Arbeit ohne staatliche Zuschüsse leben können
c) Eindämmung des Niedriglohnsektors
d) Ausgleich für die abnehmende Relevanz tariflicher Regelungen
e) Stärkung der Kaufkraft
2. Die Argumente der Mindestlohngegner
a) Gefährdung bestehender und Verhinderung neuer Arbeitsplätze
b) Ungeeignetes Mittel zur Armutsbekämpfung
c) Verstoß gegen die Koalitionsfreiheit
II. Niedriglöhne in Deutschland und ihre Ursachen
1. Umfang der Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland
a) Anteil der Niedriglohnbeschäftigten unter den abhängig Beschäftigten
b) Struktur der Niedriglohnbeschäftigung
c) Ergebnis
2. Abnehmende Relevanz tariflicher Regelungen als Ursache von Niedriglöhnen
a) Rückläufige Tarifbindung
b) Mangelnde Wirksamkeit tariflicher Regelungen
c) Zunehmendes Lohndumping in Deutschland
- 3 Mindestlöhne und ihre wirtschaftlichen Folgen
I. Mindestlöhne und Beschäftigung in der Theorie
1. Die neoklassische Arbeitsmarkttheorie
a) Auswirkungen von Mindestlöhnen aus neoklassischer Sicht
b) Annahmen und Probleme der neoklassischen Theorie
2. Die keynesianische Perspektive: Stärkung der Kaufkraft
a) Auswirkungen von Mindestlöhnen nach der Kaufkrafttheorie
b) Auswirkungen von Mindestlöhnen – Eine Simulationsrechnung
c) Probleme der Kaufkrafttheorie
II. Tatsächliche Auswirkungen eines Mindestlohns auf die Beschäftigung
III. Mindestlöhne und Beschäftigung im internationalen Vergleich
1. Mindestlöhne und Beschäftigung in Europa und den USA
a) Der britische Mindestlohn: The National Minimum Wage (NMW)
b) Mindestlöhne im restlichen Europa und den USA
c) Auf die Höhe kommt es an
2. Zwischenfazit
VI. Rückschlüsse für die deutschen Branchenlösungen
- 4 Rechtliche Probleme von Mindestlöhnen
I. Rechtliche Probleme von Branchenmindestlöhnen
1. Rechtliche Fragen bezüglich des AEntG
a) Verletzung der Koalitionsfreiheit aus Art. 9 Abs. 3 GG
aa) Eingriff in die negative Koalitionsfreiheit
bb) Eingriff in die positive Koalitionsfreiheit
aaa) Das unterschiedliche Wortlautverständnis von § 1 Abs. 3a AEntG
bbb) Die Auswahl des richtigen Tarifvertrags
b) Hinreichende Bestimmtheit des § 1 Abs. 3a AEntG?
c) Vereinbarkeit des AEntG mit dem Europarecht
2. Rechtliche Fragen bezüglich des MindArbBedG
II. Rechtliche Probleme einer möglichen branchenübergreifenden Lösung
III. Der Stand der Entwicklung zum 16. 7. 2008
1. Der Regierungsentwurf zur Änderung des AEntG
2. Der Regierungsentwurf zur Änderung des MindArbBedG
Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abb. 1: Möglichkeiten zur Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags Quelle: Hans-Böckler-Stiftung, BöcklerImpuls Nr. 9/2006, S. 2, online verfügbar unter: www.boeckler.de/pdf/impuls_2006_09_2.pdf
Abb. 2: Anteil der Niedriglohnbeschäftigten unter abhängig Beschäftigten in % Quelle: Kalina/Weinkopf, IAQ-Report Nr. 1/2008, S. 4
Abb. 3: Anteil der Beschäftigungsformen am Niedriglohnsektor in % Quelle: Kalina/Weinkopf, IAQ-Report Nr. 1/2008, S. 6
Abb. 4: Anteil der Beschäftigungsformen an der Gesamtbeschäftigung in % Quelle: Kalina/Weinkopf, IAQ-Report Nr. 1/2008, S. 6
Abb. 5: Anteil am Niedriglohnsektor nach Qualifikation Quelle: Kalina/Weinkopf, IAQ-Report Nr. 1/2008, S. 8
Abb. 6: Anteil der Niedriglohnbezieher an allen Beschäftigten im Vergleich Quelle: Kalina/Weinkopf, IAQ-Report Nr. 1/2008, S. 9
Abb. 7: Anteil der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben in % Quelle: IAB, Forschungsbericht Nr. 5/2007, S. 48
Abb. 8: Arbeitslosigkeit durch staatlichen Mindestlohn aus neoklassischer Sicht Quellen: Beck, Auswirkungen von nicht kostenneutralen Lohnänderungen auf Beschäftigung und Preisniveau, S. 16 f.; OECD, Employment Outlook 1998, S. 43; Varian, Grundzüge der Mikroökonomik, S. 448
Abb. 9: Negative Beschäftigungseffekte durch einen Mindestlohn Quelle: Ragnitz/Thum, Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen, S. 19
Abb. 10: Wirkungen einer Lohnerhöhung nach der Kaufkrafttheorie Quelle: Külp, Wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen für den Beitrag der Tarifpart- ner zum Beschäftigungsproblem, S. 205 ff.
Abb. 11:Mindestlöhne und Arbeitslosigkeit im internationalen Vergleich
Quellen: Schulten, Gesetzliche und tarifvertragliche Mindestlöhne in Europa – ein inter-nationaler Überblick, S. 15; Eurostat, Arbeitslosenstatistik für die Eurozone Oktober 2005, STAT/05/153
Tab. 1:Branchen, in denen Mindestlöhne nach dem AEntG gelten
Einleitung
In der politischen Debatte in Deutschland ist man es gewohnt, dass in regelmäßigen Abständen immer mal wieder eine andere Sau durchs Dorf getrieben wird. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund des herannahenden Sommerlochs in der Berliner Republik. Von Dauerbrennern wie dem hohen Ölpreis mit seinen möglichen Ursachen und dem Klimawandel einmal abgesehen, gibt es kaum ein anderes Thema, dass die Gemüter in Politik und Wirtschaft zurzeit derart erhitzt, wie das Thema Mindestlöhne. SPD und Gewerkschaften wollen staatlich festgesetzte Lohnuntergrenzen, Union und Arbeitgeberverbände lehnen jegliche staatliche Einmischung in die Lohngestaltung ab.[1]
Die vorliegende Arbeit wird, vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte über die Notwendigkeit sowie Sinn und Zweck staatlich festgesetzter Mindestlöhne, die wichtigsten wirtschaftswissenschaftlichen und rechtswissenschaftlichen Aspekte staatlich vorgegebener Lohnuntergrenzen durchleuchten. Dabei wird sich die Untersuchung auf die durch Legislative (allgemeiner, branchenübergreifender gesetzlicher Mindestlohn) und Exekutive (Branchenmindestlöhne durch Rechts-verordnung im Wege des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder Mindestarbeits-bedingungengesetzes) vorgegebenen Lohnuntergrenzen beschränken. Die Setzung von Lohnuntergrenzen durch einzelfallbezogene richterliche Entscheidung (sog. richterlicher Mindestlohn) wird somit nicht Gegenstand dieser Arbeit sein, zumal diese Form einer absoluten Lohnuntergrenze auch in der aktuellen Debatte über Mindestlöhne in Deutschland eine untergeordnete Rolle spielt.[2]
Im ersten Teil dieser Arbeit erfolgt zunächst eine Darstellung der derzeit in Deutschland geltenden gesetzlichen Regelungen, welche zur Festsetzung von Mindestlöhnen verwendet werden können. Hierbei handelt es sich zum einen um das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) und zum anderen das Mindestarbeits-bedingungengesetz (MindArbBedG). Beide Gesetze sind in ihrer Anwendung aber darauf beschränkt, dass mit ihnen lediglich Mindestlöhne in bestimmten Branchen festgesetzt werden können. Ein Gesetz, welches einen allgemeinen, branchen-übergreifenden Mindestlohn vorschreibt, gib es bisher noch nicht.[3]Ein solcher branchenunabhängiger Mindestlohn, der eine absolute Lohnuntergrenze für jeden Arbeitnehmer in Deutschland vorsieht, wird aber von den Gewerkschaften und anderen Mindestlohnbefürwortern eindringlich gefordert.[4]
Der zweite Teil dieser Arbeit gibt zunächst einen Überblick über die in der aktuellen Debatte vorgebrachten Argumente pro und contra Mindestlöhne. Anschließend werden Ausmaß und Ursachen der Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland näher untersucht. Denn eine Zunahme der zu Niedriglöhnen Beschäftigten wird als ein Hauptargument für die Notwendigkeit von Mindestlöhnen herangeführt.[5]
Im dritten Teil werden die wirtschaftlichen Folgen von Mindestlöhnen in Theorie und Praxis näher untersucht. Ziel ist es, zunächst anhand verschiedener wirtschaftstheoretischer Modelle aufzuzeigen, inwiefern sich staatlich festgesetzte Mindestlöhne auf die Beschäftigung auswirken und ob etwaige negative Beschäftigungseffekte durch eine gestiegene Kaufkraft eventuell wieder kompensiert werden können. Dabei wird von einem allgemeinen, branchenübergreifenden gesetzlichen Mindestlohn ausgegangen, da dieser in der Reichweite seiner Auswirkungen die gesamte deutsche Volkswirtschaft betreffen würde. Im Anschluss an die theoretische Analyse erfolgt dann eine Darstellung der aktuellen Empirie zu den tatsächlichen Auswirkungen von Mindestlöhnen. Abschließend soll ein Vergleich der Mindestlöhne anderer Staaten, welche sich für einen einheitlichen, branchen-übergreifenden Mindestlohn entschieden haben, einen weiteren Überblick über die Aus-wirkungen von Mindestlöhnen in Abhängigkeit vom allgemeinen Lohnniveau geben.
Der vierte und letzte Teil dieser Arbeit widmet sich schließlich den rechtlichen Problemen von Mindestlöhnen. Hierbei werden sowohl die rechtlichen Fragen bezüglich der bereits vorhandenen gesetzlichen Grundlagen für Branchenmindestlöhne durchleuchtet, als auch die rechtlichen Probleme eines möglichen, per Gesetz angeordneten, allgemeinen branchenübergreifenden Mindestlohns aufgezeigt. Neben europarechtlichen Fragen stehen hier hauptsächlich verfassungsrechtliche Aspekte im Vordergrund. So ist zu klären, inwiefern staatlich festgesetzte Mindestlöhne in die durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützte Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie eingreifen und inwiefern die Regelung des § 1 Abs. 3a AEntG mit dem Bestimmtheitsgrundsatz nach Art. 80 Abs. 1 GG vereinbar ist.
- 1 Die Möglichkeiten zur Einrichtung von Mindestlöhnen
Für die Einrichtung von Mindestlöhnen, also Arbeitsentgelten, welche eine bestimmte Höhe nicht unterschreiten dürfen, gibt es grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten. So können solche Mindestarbeitsbedingungen entweder durch die Tarifvertragsparteien geregelt werden (tarifliche Mindestlöhne), oder durch eine gesetzliche Regelung (gesetzliche Mindestlöhne) sowie durch eine einzelfallbezogene richterliche Entscheidung (richterlicher Mindestlohn).[6]
In Deutschland gibt es bisher noch keinen allgemeinen, branchenübergreifenden gesetzlichen Mindestlohn.[7] Jedoch existieren Mindestlöhne für bestimmte Branchen, welche wiederum auf tariflich vereinbarten (Mindest-)Löhnen beruhen. Dieser Teil der Arbeit wird die in Deutschland bereits vorhandenen gesetzlichen Grundlagen für Branchenmindestlöhne in Deutschland skizzieren. Bei diesen gesetzlichen Grundlagen handelt es sich zum einen um das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) und
zum anderen um das Mindestarbeitsbedingungengesetz (MindArbBedG). Das MindArbBedG wurde seit seinem Inkrafttreten am 11.1.1952[8] zwar noch nie angewendet[9], aber im Zuge der Überlegungen zu branchenbezogenen Mindestlohn-lösungen wiederentdeckt. Eine umfassende Reform dieses Gesetzes soll es so umgestalten, dass es in Zukunft regelmäßig praktiziert werden kann.[10]
I. Die gesetzlichen Grundlagen für Branchenmindestlöhne in Deutschland
Das AEntG und das MindArbBedG sind die zwei bereits bestehenden gesetzlichen Normen, um die sich die aktuelle Diskussion über die Ausweitung von Mindestlöhnen auf verschiedene Branchen dreht.[11]Beide Regelungen werden im Folgenden näher betrachtet. Hierbei werden die bisherige Entwicklung beider gesetzlicher Regelungen, ihr aktueller Stand bzw. die sich aus ihnen ergebende aktuelle rechtliche Lage sowie insbesondere die weiteren geplanten Änderungen dargestellt.
1. Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG)
Die Öffnung der Grenzen in Europa und die im EG-Vertrag geregelte Freizügigkeit der Arbeitnehmer (Art. 39 EG) sowie die Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 EG) ermöglichen sowohl eine einfachere Arbeitsaufnahme für Angehörige eines EU-Mitgliedstaats in anderen Mitgliedsstaaten als auch eine einfachere grenz-überschreitende Entsendung von Arbeitnehmern innerhalb der Mitgliedsstaaten.
Dieser Prozess wird insbesondere durch die unterschiedlichen Lohnhöhen in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gefördert. Dies hat dazu geführt, dass viele Arbeitnehmer aus den sog. Niedriglohnländern zu den Arbeitsbedingungen ihres Herkunftslandes in Deutschland tätig geworden sind.[12] Denn es finden die (arbeitsrechtlichen) Rechtsvorschriften des Staates Anwendung, in dem der Arbeitnehmer gewöhnlich in Erfüllung seines Vertrags seine Arbeit verrichtet,
selbst, wenn er vorübergehend in einen anderen Staat entsandt worden ist
(Art. 30 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB).
Die Entsendung von Arbeitnehmern von einem EU-Mitgliedsstaat in einen anderen ist Ausdruck der in Art. 49 und 50 EG geregelten Dienstleistungsfreiheit und kann als solche auch nicht unterbunden werden. Deshalb gab es vor Einführung des AEntG auch keine Möglichkeit, den sich aus diesen Gegebenheiten für ausländische Unternehmen resultierenden Wettbewerbsvorteil und das sog. Lohndumping[13]in bestimmten Branchen zu verhindern.[14]
a) Das ursprüngliche AEntG
Zweck des ursprünglichen AEntG i.d.F. vom 26.2.1996[15]war die Schaffung zwingender Mindestarbeitsbedingungen, zunächst allein im Bereich der Bauwirtschaft. Diese Mindestarbeitsbedingungen konnten von den Arbeitgebern nicht unterschritten werden, auch wenn diese aus anderen EU-Staaten mit geringeren Arbeitsbedingungen stammten und ihre Arbeitnehmer vorübergehend in Deutschland einsetzten, also im Falle sog. grenzüberschreitender Entsendefälle.[16]Es ging darum, im Bereich des Baugewerbes ein Lohndumping, d.h. eine Unterbietung deutscher Unternehmen beim Arbeitslohn durch ausländische Wettbewerber (die ihre eigenen Arbeitnehmer auf deutschen Baustellen beschäftigen), zu verhindern bzw. zu bekämpfen.[17]
Die Festlegung eines bestimmten Mindestlohns, also das Verbot des Unterschreitens einer festgelegten Lohnuntergrenze, ist eine Variante möglicher zwingender Arbeits-bedingungen nach dem AEntG (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 AEntG). Weiterhin besteht die Möglichkeit zur gesetzlichen Erstreckung von Tarifverträgen, welche Regelungen über die Dauer des Erholungsurlaubs, das Urlaubsentgelt oder ein zusätzliches Urlaubsgeld treffen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 AEntG). Zudem können gem. § 1 Abs. 3 AEntG auch Regelungen über „gemeinsame Einrichtungen“, die sog. Urlaubskassen, zu zwingenden Bedingungen gemacht werden. Die Normen eines nach § 5 TVG für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrags erfassen in seinem Geltungsbereich auch die bisher nicht an ihn gebundenen inländischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.[18] Durch die Aufnahme einer Branche in das AEntG gelten diese Normen gem.
§ 1 Abs. 1 Satz 1 AEntG dann auch für die Arbeitsverhältnisse zwischen ausländischen Arbeitgebern und ihrer im räumlichen Geltungsbereich des betreffenden Tarifvertrags beschäftigten Arbeitnehmer. Die Möglichkeit, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Tarifverträge auch einfach per Rechtsverordnung für allgemeinverbindlich erklären kann, ohne dass es hierfür der Anforderungen nach § 5 TVG bedarf, wurde über § 1 Abs. 3a AEntG erst mit dem Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte vom 19.12.1998[19] eingeführt.
aa) Allgemeinverbindlicherklärung gem. § 5 TVG
Die ursprüngliche Fassung des AEntG vom 26.2.1996[20]sah zunächst nur die Möglichkeit des nach § 5 TVG für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrags vor. Danach legen die Tarifvertragsparteien (§ 2 TVG) zunächst bestimmte Mindestarbeits-bedingungen i.S.d. § 1 AEntG fest. Die Allgemeinverbindlicherklärung erfolgt dann auf Antrag einer der Tarifvertragsparteien durch den Bundesminister für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit einem aus je drei Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-vertretern bestehenden Ausschuss (§ 5 Abs. 1 Satz 1 TVG).
Voraussetzung für die Allgemeinverbindlicherklärung ist gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 TVG, dass die bereits tarifgebundenen Arbeitgeber mindestens 50 % der in den Geltungsbereich des Tarifvertrags fallenden Arbeitnehmer beschäftigen und die Allgemeinverbindlicherklärung im öffentlichen Interesse geboten erscheint.
bb) Allgemeinverbindlicherklärung gem. § 1 Abs. 3a AEntG
Durch das Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte vom 19.12.1998[21] hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die zusätzliche Möglichkeit bekommen, die Allgemeinverbindlichkeit eines Tarifvertrags per Rechtsverordnung herbeizuführen. Nach § 1 Abs. 3a AEntG gilt demnach Folgendes: Wurde ein Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags gestellt, so kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ohne Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass die Rechtsnormen des betreffenden Tarifvertrags auf alle unter dessen Geltungsbereich fallenden und auch nicht tarifgebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Anwendung finden. Für den Erlass einer solchen Rechtsverordnung reicht der Antrag nur einer der Tarifvertragsparteien aus.[22] Die in § 5 TVG genannten Voraussetzungen für die Allgemeinverbindlich-erklärung müssen hier nicht vorliegen.[23] Dies bedeutet, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beim Erlass der Verordnung weder an das 50 %-Quorum, noch an einen Tarifausschuss nach § 5 Abs. 1 Satz 1 TVG gebunden ist. Nach dem Wortlaut des § 1 Abs. 3a AEntG muss noch nicht einmal ein öffentliches Interesse vorliegen.[24] Dieser verlangt lediglich, dass den von der Verordnung betroffenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie den Tarifvertragsparteien die Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme gegeben wird.[25] Auch das BVerfG verlangt die Erfüllung der materiellen Voraussetzungen nach § 5 TVG nicht und hält eine Beteiligung der Betroffenen i.S.d.
§ 1 Abs. 3a Satz 2 AEntG für ausreichend.[26] § 1 Abs. 1 Satz 1, Satz 4 und Abs. 3a
Satz 1 AEntG machen aber deutlich, dass die Aufnahme einer Branche in das AEntG formale Voraussetzung dafür ist, dass das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales bestimmte tariflich vereinbarte Mindestarbeitsbedingungen überhaupt per Rechtsverordnung nach § 1 Abs. 3a AEntG für alle in der Branche tätigen Unternehmen verpflichtend machen kann.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Möglichkeiten zur Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags
cc) Die Anwendung beider Formen
Zur Erstreckung der Tarifnormwirkung auf alle Arbeitsverhältnisse, unabhängig davon, ob die in den jeweiligen Geltungsbereich fallenden Arbeitnehmer und Arbeitgeber tarifgebunden sind oder nicht, gibt es nach dem AEntG also zwei Rechtsmittel: Einerseits die Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags im Wege des § 5 TVG, welcher nach § 1 Abs. 1 AEntG dann auch für ausländische Arbeitskräfte gilt, sowie andererseits die Rechtsverordnung nach § 1 Abs. 3a AEntG. Beide Rechtsmittel sollen gleichberechtigt nebeneinander stehen.[27]Seit der Einführung des § 1 Abs. 3a AEntG durch das Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte vom 19.12.1998[28]wurde aber vornehmlich die Variante der Rechtsverordnung angewendet.[29]Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Branchen in denen Mindestlöhne gelten, die per Rechtsverordnung nach § 1 Abs. 3a AEntG eingeführt wurden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Branchen, in denen Mindestlöhne nach dem AEntG gelten
b) Das erste Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
Mit dem ersten Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 25.4.2007[38]wurde zusätzlich zum Bauhaupt- und Baunebengewerbe[39]das Gebäude-reinigerhandwerk in das AEntG aufgenommen. § 1 Abs. 1 Satz 4 lautete danach wie folgt:„Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend auch für einen Tarifvertrag, der die Erbringung von Montageleistungen auf Baustellen außerhalb des Betriebssitzes zum Gegenstand hat, sowie für Tarifverträge des Gebäudereinigerhandwerks“. Gewollt war, dass auch diese Branche einen Zugang zum Instrument der Mindestlohnverordnung erhält. Begründet wurde die Aufnahme des Gebäudereinigerhandwerks in das AEntG u.a damit, dass es ebenso wie das Baugewerbe lohnkostenintensiv sei und damit in besonderer Weise im Wettbewerb mit Anbietern aus Ländern mit deutlich niedrigerem Lohnniveau stünde.[40]Die Rechtsverordnung nach § 1 Abs. 3a AEntG, mit der dann die zwingenden Arbeitsbedingungen für alle Arbeitsverhältnisse dieser Branche festgelegt wurden, trat zum 1.3.2008 in Kraft.[41]
c) Das zweite Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
Durch das zweite Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 21.12.2007[42]wurde der zuvor unter b) zitierte § 1 Abs. 1 Satz 4 AEntG am Ende um folgende Worte ergänzt:„[…] und für Tarifverträge für Briefdienstleistungen, wenn der Betrieb oder die selbständige Betriebsabteilung überwiegend gewerbs- oder geschäfts-mäßig Briefsendungen für Dritte befördert“. Somit war der Weg für den umstrittenen[43]Postmindestlohn geebnet. Grund für diese Regelung war diesmal das am 1.1.2008 auslaufende Postmonopol. Dadurch hätten Wettbewerber der Deutschen Post, wie z.B. die PIN Group oder der niederländische Postdienst TNT, gegebenenfalls Beschäftigte einsetzen können, die keinen tarifvertraglichen Arbeitsbedingungen unterliegen.[44]Somit bestand auch in dieser Branche theoretisch die Gefahr des Lohndumpings, die wieder über den Weg des AEntG gebannt werden sollte.
Die inzwischen vomVG Berlinangezweifelte[45]Rechtsverordnung zur Allgemein-verbindlicherklärung des zwischen dem Arbeitgeberverband Postdienste und ver.di ausgehandelten Mindestlohn-Tarifvertrags trat zum 1.1.2008 in Kraft.[46]Die Verordnung hat trotz der Entscheidung des Gerichts nach wie vor Bestand, da das Bundes-ministerium für Arbeit und Soziales Berufung eingelegt hat und das Urteil somit nicht rechtskräftig ist.[47]
2. Das Mindestarbeitsbedingungengesetz (MindArbBedG)
Die zweite gesetzliche Grundlage, nach der der Staat zwingende Vorgaben bezüglich der Arbeitsbedingungen machen kann, ist das Mindestarbeitsbedingungen-gesetz vom 11.1.1952[48]. § 1 Abs. 2 MindArbBedG legt die Voraussetzungen fest, unter denen der Staat Mindestarbeitsbedingungen, wie z.B. einen bestimmten Mindestlohn, festlegen darf. So ist dies u.a. nur dann möglich, wenn nur eine geringe oder
sogar gar keine Tarifbindung in einem bestimmten Bereich besteht
(§ 1 Abs. 2 lit. a MindArbBedG).
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt im Einvernehmen mit einem aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern paritätisch besetzten Haupt-ausschuss (§ 2 MindArbBedG) die Wirtschaftszweige oder Beschäftigungsarten, für die Mindestarbeitsbedingungen zu erlassen sind (§ 3 MindArbBedG). Für diese Wirtschaftszweige und Beschäftigungsarten werden dann vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales Fachausschüsse gem. den §§ 4-6 MindArbBedG errichtet. Der jeweilige Fachausschuss setzt die Mindestarbeitsbedingungen nach § 4 Abs. 2 MindArbBedG durch Beschluss fest. Die so festgelegten Bedingungen bedürfen dann wiederum der Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Stimmt das Ministerium zu, so erlässt es dann die festgelegten Bestimmungen per Rechtsverordnung (§ 4 Abs. 3 MindArbBedG). Die auf diesem Weg erlassene Verordnung fällt nicht unter Art. 80 GG, da sie verfassungsrechtlich wie die Allgemein-verbindlicherklärung nach § 5 TVG zu beurteilen ist. Sie wird als Vertrags- und nicht als Gesetzessurrogat verstanden, da der Inhalt der Mindestarbeitsbedingungen durch einen Fachausschuss festgelegt wird, welcher paritätisch aus den Kreisen der beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern besetzt ist.[49]Die praktische Relevanz dieses MindArbBedG war, nicht zuletzt in Anbetracht seiner Hürden[50], bisher gleich Null.[51]Im Zuge der aktuellen Diskussion über die Einführung von staatlich vorgegebenen Lohnuntegrenzen wurde das MindArbBedG aber „wiederentdeckt“. Es soll umfassend reformiert (siehe hierzu die nachfolgenden Erläuterungen) und dann auch regelmäßig praktiziert werden.[52]
II. Die geplanten Änderungen für beide Gesetze
Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz und das Mindestarbeitsbedingungengesetz sind also zwei gesetzliche Grundlagen, mit denen der Staat zwingende bzw. minimale Arbeitsbedingungen festlegen kann. Teil solcher Arbeitsbedingungen sind in erster Linie die Löhne, was auch aus den Regelungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AEntG und § 1 Abs. 2 MindArbBedG deutlich hervorgeht. Wenn also von zwingenden Arbeitsbedingungen oder Mindestarbeitsbedingungen gesprochen wird, so sind damit hauptsächlich Mindestlöhne gemeint.
Entscheidend für eine Änderung des AEntG und eine Modernisierung des MindArbBedG und somit wiederum für die Ausweitung von branchenbezogenen Mindestlohnregelungen ist eine Vereinbarung der Großen Koalition vom 18.6.2007.[53]Nach dieser Vereinbarung sollen einerseits weitere Branchen in das AEntG einbezogen und andererseits das derzeitige MindArbBedG zu einem Gesetz für Mindestlöhne in bestimmten Bereichen reformiert werden.
1. Die Einbeziehung weiterer Branchen in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz
Zunächst erhalten Branchen mit einer Tarifbindung von mindestens 50% das Angebot, in das AEntG aufgenommen zu werden. Voraussetzung für eine Aufnahme ist ein gemeinsamer Antrag von Tarifvertragsparteien der betreffenden Branche bis zum Stichtag 31.3.2008.[54]Wobei aber eine spätere Aufnahme in das AEntG dadurch nicht ausgeschlossen sein soll.[55]Der § 4 des geplanten überarbeiteten AEntG zählt dann alle Branchen auf, für die zwingende Arbeitsbedingungen entweder durch einen für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag i.S.d. § 5 TVG oder durch Rechtsverordnung nach § 1 Abs. 3a AEntG erlassen werden können.
Die wesentliche Änderung ist bei der Variante der Rechtsverordnung geplant. Wenn von einer Branche erstmals ein Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags gestellt wird, so entscheidet nicht mehr das Bundesministerium für Arbeit und Soziales allein über die mögliche Allgemeinverbindlicherklärung. Nach der geplanten Neuregelung muss sich zunächst ein Tarifausschuss, der wie bei § 5 TVG mit jeweils drei Vertretern der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite besetzt ist, mit dem gestellten Antrag befassen. Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung des Antrags im Bundesanzeiger hat der Tarifausschuss dann sein Votum abzugeben. Stimmt der Ausschuss der Allgemeinverbindlicherklärung zu, so können die zwingenden Arbeitsbedingungen, also z.B. ein Mindestentgelt, per Rechtsverordnung erlassen werden und gelten dann für alle in dieser Branche Beschäftigten.[56]Auf den ersten Blick mag der Eindruck entstehen, dass Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter in derselben Weise wie beim Verfahren nach § 5 TVG beteiligt werden und eine Allgemein-verbindlicherklärung per Rechtsverordnung nur dann möglich ist, wenn der Tarif-ausschuss mit der Mehrheit seiner Mitglieder für die Allgemeinverbindlicherklärung stimmt.[57]Jedoch soll nach § 6 Abs. 3 des Referentenentwurfs zur Änderung des AEntG Folgendes gelten: Gibt der Tarifausschuss innerhalb der Frist von drei Monaten keine Stellungnahme ab oder stimmt mindestens ein Drittel seiner Mitglieder für den Antrag, so kann vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Rechtsverordnung zur Allgemeinverbindlicherklärung erlassen werden. Stimmen die Hälfte oder zwei Drittel der Mitglieder des Tarifausschusses gegen den Antrag, so kann die Rechtsverordnung immer noch erlassen werden, wenn auch nur noch von der Bundesregierung.[58]Das bedeutet konkret, dass nach dem Referentenentwurf ein Mindestlohn per Rechts-verordnung sogar auch noch dann erlassen werden kann, wenn im Tarifausschuss eine Patt-Situation vorliegt oder sich die Mehrheit gegen eine Allgemeinverbindlich-erklärung des entsprechenden Tarifvertrags ausspricht.
2. Die Reformierung des Mindestarbeitsbedingungengesetzes
Nach dem Beschluss des Koalitionsausschusses vom 18.6.2007 soll eine Modernisierung des MindArbBedG es erleichtern, in einzelnen Wirtschaftszweigen oder Regionen, in denen es entweder keine Tarifverträge gibt oder eine Tarifbindung nur für eine Minderheit der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber besteht, den sog. weißen Flecken, Mindestarbeitsbedingungen festzulegen.[59]
Der Diskussionsentwurf zur Änderung des MindArbBedG vom 10.1.2008 sieht vor, dass die Festlegung von Mindestarbeitsbedingungen nur noch an die Voraussetzung geknüpft sein soll, dass „in einem Wirtschaftszweig bundesweit oder regional die an Tarifverträge gebundenen Arbeitgeber weniger als 50 vom Hundert der unter den Geltungsbereich dieser Tarifverträge fallenden Arbeitnehmer beschäftigen“.[60] Die Voraussetzung nach § 1 Abs. 2 lit. b MindArbBedG, wonach die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen zur Befriedigung sozialer und wirtschaftlicher Bedürfnisse von Arbeitnehmern erforderlich sein muss, entfällt. Gleiches gilt für die Voraussetzung nach § 1 Abs. 2 lit. c MindArbBedG, die die Festsetzung von Mindestarbeits-bedingungen nur dann zulässt, wenn dies nicht schon bereits vorher durch einen für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag erfolgt ist. Auch die Voraussetzung nach
§ 1 Abs. 2 lit. a MindArbBedG, wonach keine oder zumindest keine repräsentativen Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbände für die in Frage kommenden Branchen oder Beschäftigungsarten vorhanden sein dürfen, entfällt. Danach durfte das MindArbBedG bisher nicht angewendet werden, sobald entsprechend repräsentative Tarifvertrags-parteien existierten, die eine Regelung treffen konnten.[61] Durch die neue, konkrete Regelung wird klar, dass das MindArbBedG sofort dann zum Tragen kommen soll, wenn das 50 % Quorum, welches nach der Koalitionsvereinbarung für die Aufnahme einer Branche in das AEntG notwendig ist[62], nicht erfüllt wird.
Die weiteren Änderungen beziehen sich auf die Zusammensetzung des Hauptausschusses und der Nebenausschüsse sowie auf das Verfahren zum Erlass von Mindestarbeitsbedingungen. Der Hauptausschuss nach § 2 MindArbBedG soll nunmehr aus einem unparteiischen[63]Vorsitzenden, der von den Ausschussmitgliedern vorgeschlagen und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales berufen wird,[64]sowie aus sechs weiteren, ständigen Mitgliedern bestehen, statt wie bisher aus dem Bundesarbeitsminister, einem Vorsitzenden und jeweils fünf Vertretern von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite.[65]Die Mitglieder des Hauptausschusses können zwar von den jeweiligen Spitzenorganisationen vorgeschlagen werden, dürfen aber„nicht Repräsentant eines Wirtschaftsverbandes oder einer Organisation der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sein oder zu diesen in einem ständigen Dienst- oder Geschäftsbesorgungsverhältnis stehen oder im letzten Jahr vor ihrer Berufung zum Mitglied des Hauptausschusses eine derartige Stellung innegehabt haben“.[66]Weiterhin müssen die Mitglieder alle"über besondere soziale und ökonomische Kenntnisse verfügen."[67]Diese Anforderung an die Kompetenz der Mitglieder ist notwendig, weil der Hauptausschuss gem. § 3 des Diskussionsentwurfs zur Änderung des MindArbBedG unter umfassender Berücksichtigung der sozialen und ökonomischen Auswirkungen beschließen soll,obfür bestimmte Wirtschaftszweige bzw. Branchen bundesweit oder regional Mindestarbeitsbedingungen festgesetzt, geändert oder aufgehoben werden sollen.[68]Der Hauptausschuss wird dauerhaft eingerichtet. Nach § 4 MindArbBedG wird für die jeweils betroffene Branche zusätzlich ein Fachausschuss gebildet, der festlegt,wiedie Mindestarbeitsbedingung ausgestaltet, bzw. wie hoch der Mindestlohn im konkreten Fall sein soll.[69]Die Fachausschüsse sollen in Zukunft so zusammengesetzt sein, dass sich divergierende Einzelinteressen nicht blockieren und die Beratungen zu einem guten Ergebnis führen.[70]Geplant ist, dass jeder Fachausschuss aus sechs Mitgliedern besteht, die je zur Hälfte den Kreisen der betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitgeber angehören.[71]Hinzu kommt wiederum ein unparteiischer Vorsitzender, für dessen Bestellung die gleichen Regelungen gelten sollen, wie für den Vorsitzenden des Hauptausschusses.[72]
Viel Streit wird künftig wohl die Neufassung des § 8 MindArbBedG verursachen, sollte das Gesetz wie geplant geändert werden. Nach der bisherigen Fassung des
§ 8 Abs. 2 MindArbBedG gehen tarifliche Bestimmungen den Mindestarbeits-bedingungen vor. Künftig aber sollen die im Wege des MindArbBedG festgelegten Arbeitsbedingungen für alle Arbeitgeber zwingend gelten, die einen Arbeitnehmer im Geltungsbereich einer solchen Mindestarbeitsbedingung beschäftigen.[73] Dies bedeutet konkret, dass die geschaffene Mindestarbeitsbedingung sowohl für Tarifungebundene gilt, als auch für Arbeitsverhältnisse, welche anderen Tarifverträgen unterliegen. Zwar will man den festgelegten Mindestarbeitsbedingungen keinen generellen Vorrang vor Tarifverträgen geben, sondern zu bestehenden Tarifverträgen per Gesetz Kriterien für eine Vorrangentscheidung festlegen[74], aber allein die Möglichkeit, dass bestehende Tarifverträge verdrängt werden könnten, ist ein häufig genannter Kritikpunkt.[75] So hätte laut Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt ein solches Aushebeln der Tarifautonomie „schwerwiegende Folgen für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität insgesamt“. [76]
III. Der Stand der Entwicklung bis zum Stichtag 31.3.2008
Wie bereits erwähnt, hatte die Große Koalition am 18.6.2007 beschlossen, dass Branchen mit einer Tarifbindung vom mindestens 50 % das Angebot erhalten sollen, in das AEntG aufgenommen zu werden. Voraussetzung hierfür ist ein gemeinsamer Antrag von Tarifvertragsparteien der betreffenden Branche bis zum 31.3.2008.[77]Die Aufnahme einer Branche in das AEntG ist wiederum die formale Voraussetzung dafür, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales einen tariflich vereinbarten Mindestlohn per Rechtsverordnung für allgemeinverbindlich erklären kann.[78]
Die SPD hoffte in der Folge auf eine „Antragsflut für Mindestlöhne“.[79] Sie forderte die Arbeitgeber und Gewerkschaften in ihrer Hamburger Erklärung[80] auf,
„[…] die vereinbarten gesetzlichen Grundlagen des Entsendegesetzes und des Mindestarbeitsbedingungengesetzes zu nutzen und so gemeinsam ihre Branchen vor Lohndumping zu schützen“. Arbeitgeber und Gewerkschaften aller in Betracht kommenden Branchen wurden also aufgerufen, schnellstmöglich einen gemeinsamen Antrag auf Aufnahme in das überarbeitete AEntG zu stellen.
Es wurde erwartet, dass zusammen mit den zwei aussichtsreichsten Kandidaten, dem Wach- und Sicherheitsgewerbe mit über 170.000 Beschäftigten[81]und der Zeit-arbeitsbranche[82]mit rund 646.000 Beschäftigten[83], bis zu zehn Branchen mit zusammen 4,4 Millionen Beschäftigten in das AEntG aufgenommen werden könnten. Jedoch blieb die erhoffte Antragswelle aus.[84]Neben der Zeitarbeitsbranche[85], den Pflegediensten mit rund 565.000 Beschäftigten[86]und den Abfallentsorgern mit rund 140.000 Beschäftigten[87], haben lediglich vier weitere, jedoch kleinere Branchen (die private Forstwirtschaft, die Textil-Dienstleister, die Weiterbildungsbranche und die Branche der sog. Bergbauspezialarbeiten) einen entsprechenden Antrag bis zum 31.3.2008 gestellt. Die vier zuletzt genannten Branchen beschäftigen derzeit zusammen ca. 65.500 Arbeitnehmer.[88]
Was das Wach- und Sicherheitsgewerbe anbetrifft, so waren zunächst die Verhandlungen zwischen dem Bundesverband Deutscher Wach- und Sicherheits-unternehmen (BDWS) und der Gewerkschaft ver.di über einen tariflichen Mindestlohn gescheitert. Ver.di war ein Mindestlohn von sechs Euro in Ostdeutschland zu niedrig. Dieser sollte mindestens 7,50 € betragen.[89]Es fehlte in dieser Branche also bisher sogar noch die tarifvertragliche Basis für eine Allgemeinverbindlicherklärung nach dem AEntG.[90]Jedoch führte die Verweigerungshaltung von ver.di dazu, dass der Arbeitgeberverband BDWS schlicht den Verhandlungspartner wechselte und mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen (GÖD), welche wiederum dem christlichen Gewerkschaftsbund angehört, am 27.3.2008 Tarifverhandlungen aufge-nommen hat.[91]Auch wenn somit zum Stichtag 31.3.2008 noch kein konkreter Mindestlohn-Tarifvertrag vorlag, so haben beide Parteien dennoch am 27.3.2008 zugleich die Aufnahme des Wach- und Sicherheitsgewerbes in das AEntG beantragt und sind zuversichtlich, schon bald zu einer tariflichen Einigung zu kommen.[92]Somit haben bis zum Stichtag insgesamt acht Branchen mit zusammen ca. 1,57 Millionen Beschäftigen einen Antrag auf Aufnahme in das AEntG gestellt. Auch wenn in der Presse von einer„lediglich bescheidenen Zwischenbilanz“[93]oder gar von einer„Schlappe für Olaf Scholz“[94]die Rede war, sprichtOlaf Scholzselbst von einem„gigantischen politischen Erfolg“[95]Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte zudem klar, dass sie an den zwischen CDU/CSU und SPD vereinbarten Mindestlohnplänen festhalten will.[96]
- 2 Die aktuelle Mindestlohndebatte und ihre Hintergründe
Vor einer eingehenden Untersuchung der wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte von Mindestlöhnen in den §§ 3 und 4 dieser Arbeit, werden in diesem Abschnitt zunächst die gewichtigsten Argumente, die in der aktuellen Mindestlohndebatte in Deutschland vorgebracht werden, dargestellt. An dieser Stelle sollen die kontrovers laufenden Meinungen sowie die Hintergründe für die Forderung nach Mindestlöhnen wiedergegeben werden. Dabei werden aktuelle Studien und Analysen einbezogen, welche unter Umständen eine Notwendigkeit von Mindestlöhnen in Deutschland indizieren könnten.
I. Die Meinungen
Das Thema Mindestlohn ist seit dem Beschluss der Großen Koalition vom 18.6.2007[97]ein fester Bestandteil der politischen und gesellschaftlichen Debatte. Es gibt reichlich Argumente pro Mindestlohn seitens der Mindestlohnbefürworter, insbesondere der Gewerkschaften und der SPD, aber mindestens auch ebenso viele Argumente contra Mindestlohn von den Mindestlohngegnern, zu denen die meisten Arbeitgeberverbände und große Teile der Unionsanhänger gehören. Während die meisten Wirtschaftsforscher zu den Mindestlohngegnern gehören und die Arbeitgeber im „Kampf“ gegen Mindestlöhne unterstützen[98], gibt es überraschenderweise auch Arbeitgeberverbände, die die Existenz eines Mindestlohns für sinnvoll erachten.[99]Die Gewerkschaften Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und ver.di haben dem Mindestlohn in einem gemeinsamen Projekt sogar einen eigenen Internetauftritt gewidmet.[100]Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat eigens für den Mindestlohn eine Internetseite geschaffen.[101]Auf Arbeitgeberseite enthält der Internetauftritt der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) ebenfalls eine eigene, feste Rubrik zum Thema Mindestlohn.[102]Die folgenden Ausführungen sollen einen Überblick über die am häufigsten vorgebrachten Argumente pro und contra Mindestlöhne geben. Hierbei werden sowohl die wirtschaftlichen, als auch die juristischen Bedenken bzw. Probleme, die ein staatlich festgesetzter Mindestlohn mit sich bringt, skizziert.
1. Die Argumente der Mindestlohnbefürworter
Von den Mindestlohnbefürwortern werden als Argumente für einen Mindestlohn hauptsächlich die seit Jahren steigende Zahl der Niedriglohnempfänger[103]bzw. das stetige Wachsen eines sog. Niedriglohnsektors in Deutschland sowie die Gefahr des Lohndumpings, u.a. durch die Öffnung des Arbeitsmarkts für osteuropäische Arbeitnehmer (als eine der Ursachen für das Wachsen des Niedriglohnsektors), herangeführt. Insbesondere die Tatsache, dass wohl immer mehr in Vollzeit beschäftigte Arbeitnehmer so wenig verdienen, dass sie auf zusätzliche staatliche Unterstützung angewiesen sind, ist für Mindestlohnbefürworter ein völlig untragbarer Zustand, dem mit einem Mindestlohn abgeholfen werden soll. Insgesamt laufen die verschiedenen Argumente immer darauf hinaus, dass zunehmend Löhne bezahlt werden, die nicht den eigentlichen Wert der Arbeit widerspiegeln und dass tarifliche Regelungen allein kein geeignetes Mittel mehr sind, um dieser Entwicklung entgegenzutreten.
a) Die Verhinderung von Lohndumping und ruinösem Wettbewerb
Ein Argument, welches für Mindestlöhne spricht, ist die Bekämpfung des Lohndumpings in Deutschland. Die Verhinderung dieses Lohndumpings, verursacht durch ausländische Arbeitnehmer, war ja schließlich auch der ursprüngliche Sinn und Zweck des im Jahr 1996 eingeführten AEntG.[104]Durch den verstärkten Zustrom ausländischer Arbeitskräfte ist das Lohndumping eine reale Bedrohung für die bisherigen deutschen Einkommens- und Sozialstandards geworden.[105]Es besteht die Gefahr, dass die Niedriglohnkonkurrenten aus dem Ausland die inländischen Beschäftigten verdrängen, welche wegen ihres höheren Lebenshaltungsniveaus mit den niedrigen Löhnen einfach nicht mithalten können.[106]Daher sollen nach Ansicht der Mindestlohnbefürworter die einheimischen Beschäftigten mittels eines Mindestlohns vor einer Verdrängung durch ausländische Beschäftigte bewahrt werden. Denn durch den Mindestlohn würde der Lohndruck, der auf die Beschäftigten ausgeübt wird, ausgebremst.[107]Man erhofft sich dadurch, dass es für die Unternehmen dann keinen Sinn mehr macht, die regulären Beschäftigten durch – dann ja nicht mehr billigere – ausländische Werkvertragnehmer auszutauschen.[108]Die Zeitarbeit ist ein aktuelles Beispiel für eine Branche, in der man die ausländische Niedriglohnkonkurrenz fürchtet und deshalb einen Mindestlohn anstrebt. Hier soll es in Zukunft eine durch das AEntG festgelegte Lohnuntergrenze geben.[109]Thomas Reitz,Deutschland-Chef der Zeitarbeitsfirma „Manpower“, befürwortet die Einführung eines Mindestlohns, um damit die Zeitarbeitsbranche in Deutschland gegen die Öffnung des Arbeitsmarkts für die osteuropäischen EU-Staaten im kommenden Jahr abzusichern. Neben dem Schutz der Arbeitnehmer vor einer Lohnspirale nach unten haben die Zeitarbeitsfirmen auch ein gar nicht so geringes Eigeninteresse an einem Mindestlohn für ihre Branche. Die Öffnung des Arbeitsmarkts würde lautReitzzwangsweise„einen Wettbewerb mit Niedriglöhnen entfachen, die die Zeitarbeitsfirmen mit ihrer Tarifbindung nicht bezahlen dürfen und auch nicht wollen.“[110]Insofern wird befürchtet, dass die osteuropäischen Konkurrenten mit niedrigen Löhnen und somit mit einem Preisvorteil die deutschen Wettbewerber vom Markt drängen könnten.
b) Jeder soll von seiner Arbeit ohne staatliche Zuschüsse leben können
An das Argument des Lohndumpings knüpft die Forderung an, dass ein Arbeitnehmer, der in Vollzeit arbeitet, von seiner geleisteten Arbeit auch ohne staatliche Zuschüsse leben soll. Die Zahl der Erwerbstätigen, die ihr Erwerbseinkommen durch Arbeitslosengeld II aufstocken müssen, hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Im September 2005 hatten über 900.000 Beschäftigte einen Anspruch auf ergänzendes Arbeitslosengeld II[111]. Genau zwei Jahre später waren es schon knapp 1,3 Millionen.[112]Dabei handelte es sich keineswegs nur um Personen, die in Minijobs orientiert an den Freigrenzen einen zusätzlichen Verdienst erzielten, sondern häufig auch um Vollzeitbeschäftigte, deren Erwerbseinkommen einfach nicht ausreichte, um ihren Bedarf im Haushaltskontext abzusichern.[113]Das Problem dabei ist, dass Niedriglohn-bezieher, insbesondere wenn sie in Vollzeit arbeiten, wie andere eine Arbeitsleistung erbringen und sich denselben Belastungen aussetzen, sich aber mit einem Lebensstandard begnügen müssen, der das Niveau der Sozialhilfe kaum übersteigt. Zudem sind auch die Aussichten auf einen Aufstieg in einen Job mit einem höheren Verdienst meist minimal.[114]
Nach Ansicht der SPD kann es nicht sein, dass Unternehmen Menschen in die Bedürftigkeit drängen und dann der Staat dauerhaft einen Teil der Löhne bezahlt. Man könne sich nicht damit abfinden, dass Löhne nicht zum Leben reichten und Dumpinglöhne aus Steuergeldern aufgestockt werden müssten. Zudem würden auch die Unternehmen von Mindestlöhnen profitieren, weil diese sog. Schmutzlöhne verhinderten.[115]Reitzist ebenfalls der Ansicht, dass eine Vollzeitkraft in Deutschland soviel verdienen soll, dass sie ohne staatliche Zuschüsse auskommt.[116]
Die Gewerkschaften sprechen hier von „Armut trotz Arbeit“ und fordern:„Alle Beschäftigten sollen sich von der Arbeit ihrer Hände und ihres Kopfes selbst ernähren und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Dazu gehören Fußballstadion- und Theaterbesuche, Musikunterricht für die Kinder und Urlaubsreisen. Bei Vollzeittätigkeit nicht auf zusätzliche Almosen und Unterstützung angewiesen zu sein, ist Grundlage des Selbstwertgefühls eines jeden Menschen.“[117]
c) Eindämmung des Niedriglohnsektors
Von den Mindestlohnbefürwortern wird zudem auch immer wieder die Existenz eines stetig wachsenden Niedrig-lohnsektors herangeführt, zu dessen Eindämmung man Mindestlöhne braucht.[118] Schon allein die Tat-sache, dass immer mehr Vollzeit-beschäftigte neben ihrem regulären Arbeitsentgelt auf zusätzliche Zahlungen aus Arbeitslosengeld II angewiesen sind[119], ist ein Indiz für das Bestehen und stetige Wachsen eines solchen Niedriglohnsektors. Nach einer OECD-Definition zählt zu den Niedriglohnlohnempfängern derjenige, der weniger als zwei Drittel des sog. Medianlohns erhält.[120] Wenn von Armutslöhnen die Sprache ist[121], dann ist damit ein Lohn von sogar weniger als 50 % des nationalen Durchschnittseinkommens gemeint.[122] Einer Berechnung aus dem Jahr 2006 zufolge, lag die bundeseinheitliche Niedriglohnschwelle in Deutschland demnach bei 9,13 €.[123] Ausgehend von der Niedriglohndefinition der OECD erhielten im Jahr 2006 6,5 Mio. Beschäftigte bzw. 22,2 % aller Beschäftigten einen Lohn unterhalb dieser Schwelle.[124] Ein Blick auf die zurückliegenden Jahre zeigt, dass der Anteil der Beschäftigten, die unter diese Definition fallen, stetig zugenommen hat (Abbildung 2). Im Jahr 1995 waren es zunächst 15 % aller abhängig Beschäftigten, im Jahr 2000 17,5 % und im 2004 dann schon 20,1 %. Im Jahr 2006 lag der Anteil dann schließlich bei 22,2 %. Damit hat Deutschland inzwischen den höchsten Niedriglohnanteil unter den kontinental-europäischen Ländern.[125] In Anbetracht der Existenz eines solchen Niedriglohnsektors in Deutschland sollen Mindestlöhne ein geeignetes und auch notwendiges Mittel sein, um diesen einzudämmen.[126]
d) Ausgleich für die abnehmende Relevanz tariflicher Regelungen
Von den Mindestlohnbefürwortern werden noch zwei weitere Gründe für Mindestlöhne ins Feld geführt. So wird zum einen argumentiert, dass durch die zurückgehende Tarifbindung die Einhaltung von Mindeststandards im Entgeltbereich nicht mehr flächendeckend gewährleistet sei und es daher flankierender gesetzlicher Maßnahmen bedürfe.[127]NachHubertus Schmoldtvon der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) seien Mindestlöhne eine bedauerliche, aber nötige Reaktion auf die Beschädigung der Tarifautonomie durch die Arbeitgeber.[128]Zum anderen wird herangeführt, dass selbst vorhandene tarifliche Vergütungsregelungen keinesfalls ein sicheres Instrument zur Vermeidung von Niedriglöhnen seien.[129]Denn es bestünden zahlreiche tarifliche Grundvergütungen, die deutlich unterhalb der aktuell diskutierten Höhe von 7,50 €[130]pro Stunde für einen möglichen gesetzlichen Mindestlohn sowie unter der nach OECD-Definition geltenden Niedriglohngrenze lägen.[131]Daher erziele auch das AEntG nur eine begrenzte Wirkung, wenn die tariflichen Grundvergütungen der Mindestlohntarifverträge nur sehr gering ausfielen.[132]Schließlich schreibt das AEntG ja nicht vor, wie hoch das in dem Mindestlohn-Tarifvertrag geregelte Entgelt sein soll. So kann es passieren, dass sich die Arbeitgeberseite einen Tarifpartner sucht, der zu geringeren Lohnabschlüssen bereit ist als ein anderer Verhandlungspartner und dann zusammen mit diesem Tarifpartner die Aufnahme in das AEntG beantragt. Somit würde dann der zwischen diesen beiden Parteien ausgehandelte (für den Arbeitgeber günstigere) Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt. Ein aktuelles, praktisches Beispiel ist das Wachgewerbe. Hier wollte der Arbeitgeberverband BDWS die von ver.di geforderte Lohnhöhe von 7,50 € nicht akzeptieren und hat daraufhin den Verhandlungspartner (dieser ist jetzt die christliche Gewerkschaft GÖD) gewechselt. Hier soll die unterste Lohnstufe nun 5,75 € betragen.[133]BDWS und GÖD hatten zusammen am 27.3.2008 den Antrag auf Aufnahme in das AEntG gestellt.[134]Die Folge wird sein, dass der zwischen BDWS und GÖD ausgehandelte Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt wird und somit ein geringerer Mindestlohn gilt, als er ursprünglich von ver.di geplant war. Somit hat die Arbeitgeberseite aus Sicht der Mindestlohnbefürworter im Rahmen des AEntG eine zu starke Veto-Position, die es ihnen ermöglicht, durch die Verweigerung eines (angemessenen) Mindestlohn-Tarifvertrags das gesamte Regelungssystem zu unterlaufen. Auch vom zukünftig reformierten MindArbBedG ist man wenig überzeugt. Es wird befürchtet, dass nicht alle tariflosen Branchen abgedeckt und die Verfahren gerade am Anfang lange dauern werden, eine kurzfristige Anpassung der Mindeststandards nicht möglich sein wird und ein Flickenteppich von sektoral und regional unterschiedlichen Mindestlohnniveaus entsteht.[135]Daher sind die Mindestlohnbefürworter der Ansicht, dass weder das AEntG noch das MindArbBedG das Kernproblem unzureichender Vergütung wirklich lösen können und sprechen sich überwiegend für einen allgemeinen, branchenübergreifenden gesetzlichen Mindestlohn aus.[136]Dieser gesetzliche Mindestlohn soll dann Niedriglöhne dort bekämpfen, wo Arbeitnehmer- und Arbeitgeber keiner Tarifbindung unterliegen bzw. Gewerkschaften Tarifverträge überhaupt nicht durchsetzen konnten oder die gewerkschaftliche Tarifmacht bisher aus verschiedenen Gründen nur relativ niedrige unterste Tarifentgelte durchsetzen konnte.[137]
e) Stärkung der Kaufkraft
Konträr zu der Auffassung der Arbeitgeber, welche den Verlust von Arbeitsplätzen als eine unmittelbare Folge von Mindestlöhnen sehen[138], läuft das Argument der Mindestlohnbefürworter, dass sich ein Mindestlohn positiv auf die Binnennachfrage auswirkt und somit also einen positiven statt negativen gesamtwirtschaftlichen Effekt hat. So würde die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns z.B. i.H.v. 7,50 € zu einer spürbaren Verbesserung des Lebens von ca. 2,4 Mio. Beschäftigten führen, die bis dahin Löhne unterhalb dieser Schwelle bekommen haben. Da gerade Niedrigverdiener ihr gesamtes Einkommen für Güter des täglichen und mittelfristigen Bedarfs ausgeben, würde die Einführung eines Mindestlohns zu einer gestiegenen Binnennachfrage führen.[139]Durch die mit der Einführung eines Mindestlohns verbundene Erhöhung der Konsumnachfrage würden sich sogar positive Beschäftigungseffekte mit bis zu 100.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen einstellen.[140]Die Gewerkschaft ver.di argumentiert:„Autos kaufen keine Autos. Auch Brötchen kaufen keine Brötchen. Nur Menschen kaufen ein. […] Wenn das Einkommen nicht ausreicht, wird weniger gekauft und weniger produziert. Die Beschäftigung wird heruntergefahren und die Arbeitslosigkeit steigt.“[141]Als Musterbeispiel für positive Effekte eines Mindestlohns wird Großbritannien herangeführt. Dort habe der Mindestlohn der Beschäftigung nicht nachweislich geschadet und die verstärkte Nachfrage zu einem verminderten Kostenwettbewerb unter den Unternehmen geführt.[142]
2. Die Argumente der Mindestlohngegner
Aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive werden, insbesondere von Arbeit-geberseite, als Hauptargumente gegen staatlich festgesetzte Mindestlöhne immer wieder die drohende Vernichtung bestehender sowie die ausbleibende Schaffung neuer Arbeitsplätze herangeführt[143]Weiterhin wird vorgebracht, dass ein Mindestlohn kein geeignetes sozialpolitisches Instrument sei, mit dem man ein Mehr an Gerechtigkeit herbeiführen und Armut bekämpfen könne.[144]
[...]
[1]Zur Diskussion siehe ausführlich unten, § 2.
[2]Zum richterlichen Mindestlohn siehe z.B.:Bayreuther, NJW 2007, 2022 ff.; Münchener Hdb. zum Arbeitsrecht/Hanau, § 63, Rn. 3 ff.
[3]Bispinck/Schulten, WSI Mitteilungen 2008, 151 ff.; Personalhdb./Griese, 36, Rn. 23.
[4]Bispinck/Schulten, WSI Mitteilungen 2008, 151, 154 f.;Bosch/Weinkopf/Kalina, Gesetzliche Mindestlöhne auch in Deutschland?, S. 6 f.;NGG/ver.di, Arm trotz Arbeit?, S. 16 f.
[5]So z.B.:Bispinck/Schulten, WSI Mitteilungen 2008, 151 ff.;Bispinck/Schäfer/Schulten,
WSI Mitteilungen 2004, 575 ff.;Bosch/Weinkopf/Kalina, Gesetzliche Mindestlöhne auch in Deutschland?, S. 4 ff.;NGG/ver.di, Arm trotz Arbeit?, S. 6 ff.;Rhein/Gartner/Krug, Niedriglohnsektor: Aufstiegschancen für Geringverdiener verschlechtert, S. 1 ff.
[6]Münchener Hdb. zum Arbeitsrecht/Hanau, § 63, Rn. 2.
[7]Bispinck/Schulten, WSI Mitteilungen 2008, 151; Personalhdb./Griese, 36, Rn. 23.
[8]BGBl. 1952 I S. 17.
[9] Bispinck/Schulten, WSI Mitteilungen 2008, 151, 154; Münchener Hdb. zum Arbeitsrecht/Hanau,
§ 63, Rn. 2.; Personalhdb./Griese, 36, Rn. 23.
[10]Fachanwaltskommentar Arbeitsrecht/Löwisch, Vorbem. zum MindArbG, Rn. 1.
[11]NJW-Spezial 2007, S. 374.
[12]Junker, JZ 2005, 481.
[13]Zur Gefahr des Lohndumpings durch ausländische Arbeitnehmer siehe ausführlich: § 2 I. 1. a).
[14]BeckOK/Gussen, § 1 AEntG, Rn. 1.
[15]BGBl. 1996 I S. 227.
[16]BT-Drs. 13/2414, A. “Zielsetzung”.
[17]Münchener Hdb. zum Arbeitsrecht/Richardi, § 240, Rn. 54.
[18]Löwisch/Rieble, Tarifvertragsgesetz, § 5, Rn. 30, 75, 107.
[19]BGBl. 1998 I S. 3843.
[20]BGBl. 1996 I S. 227.
[21]BGBl. 1998 I S. 3843.
[22]Münchener Hdb. zum Arbeitsrecht/Löwisch/Rieble, § 268, Rn. 110.
[23]Bieback, RdA 2000, 207, 211.
[24]Münchener Hdb. zum Arbeitsrecht/Löwisch/Rieble, § 268, Rn. 111.
[25]ErfK/Schlachter, § 1 AEntG, Rn. 13.
[26]BVerfG, Beschluss vom 18.7.2000, NZA 2000, 948, 949.
[27]Münchener Hdb. zum Arbeitsrecht/Löwisch/Rieble, § 268, Rn. 111.
[28]BGBl. 1998 I S. 3843.
[29]ErfK/Schlachter, § 1 AEntG, Rn. 13.
[30]VO über zwingende Arbeitsbedingungen im Baugewerbe, BGBl. 1999 I S. 1894.
[31]BAnz. 2005 Nr. 164 S. 13199.
[32]VO über zwingende Arbeitsbedingungen im Maler- und Lackiererhandwerk, BGBl. 2003 I S. 2279.
[33]BAnz. 2005 Nr. 178 S. 14035.
[34]VO über zwingende Arbeitsbedingungen im Dachdeckerhandwerk, BGBl. 2001 I S. 2260.
[35]BAnz. 2006 Nr. 245 S. 7461.
[36]BAnz. 2008 Nr. 34 S. 762.
[37]BAnz. 2007 Nr. 242 S. 8410.
[38]BGBl. 2007 I S. 576.
[39]Das Bauhauptgewerbe beschäftigt sich überwiegend mit der Ausführung des Rohbaus im Hoch- und Tiefbau sowie Straßen- und Landschaftsbau, während sich das Baunebengewerbe (wie z.B. Dachdecker, Maler, Tapezierer, Bauschlosser und Schreiner) mit dem Ausbau von Bauwerken beschäftigt.
[40]BeckOK/Gussen, AEntG § 1, Rn. 2.
[41] Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Gebäudereinigerhandwerk,
BAnz. 2008 Nr. 34 S. 762.
[42]BGBl. 2007 I S. 3140.
[43] Zur Diskussion siehe z.B.: BDA, Presse-Information Nr. 74/2007; ver.di, Wirtschaftspolitik aktuell
Nr. 23/2007.
[44]NJW-Spezial 2007, S. 548.
[45]VG Berlin, Urteil vom 7.3.2008, NZA 2008, 482 ff.
[46] Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Branche Briefdienstleistungen,
BAnz. 2007 Nr. 242 S. 8410.
[47]BMAS, Pressemitteilung vom 7.3.2008.
[48]BGBl. 1952 I S. 17.
[49]Staudingers Kommentar zum BGB/Richardi, Vorbem. zu §§ 611 ff., Rn. 787.
[50]Hans-Böckler-Stiftung, Gesetz ohne Anwendungsmöglichkeiten, S. 6.
[51]Bispinck/Schulten, WSI Mitteilungen 2008, 151, 154; Personalhdb./Griese, 36, Rn. 23.
[52]Fachanwaltskommentar Arbeitsrecht/Löwisch, Vorbem. zum MindArbG, Rn. 1.
[53]BMAS, Online-Artikel vom 20.6.2007.
[54]Referentenentwurf zur Änderung des AEntG vom 11.1.2008, dort A., online verfügbar unter:
www.sozialpolitik-aktuell.de/docs/Referentenentwurf_AEntG_BMAS.pdf, Abrufdatum: 15.4.2008.
[55]BMAS, Online-Artikel vom 20.6.2007, dort I. 1.
[56]BMAS, Online-Artikel vom 20.6.2007, dort I. 2.
[57]ErfK/Franzen, § 5 TVG, Rn. 22.
[58]Referentenentwurf zur Änderung des AEntG vom 11.1.2008, dort § 6.
[59]BMAS, Online-Artikel vom 20.6.2007, dort II. 1.
[60]Diskussionsentwurf zum ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen vom 10.1.2008, dort Art. 1 Nr. 1; online verfügbar unter: www.sozialpolitik-aktuell.de/docs/MiA_Diskussionsentwurf_BMAS.pdf, Abrufdatum: 15.4.2008.
[61]Hans-Böckler-Stiftung, Gesetz ohne Anwendungsmöglichkeiten, S. 6.
[62]BMAS, Online-Artikel vom 20.6.2007, dort I. 1.
[63]BMAS, Online-Artikel vom 20.6.2007, dort II. 4.
[64]Diskussionsentwurf zum ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen vom 10.1.2008, dort Art. 1 Nr. 2 lit. d.
[65]Diskussionsentwurf zum ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen vom 10.1.2008, dort Art. 1 Nr. 2 lit. b.
[66]Diskussionsentwurf zum ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen vom 10.1.2008, dort Art. 1 Nr. 2 lit. c.
[67]Diskussionsentwurf zum ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen vom 10.1.2008, dort Art. 1 Nr. 2 a-b.
[68]Diskussionsentwurf zum ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen vom 10.1.2008, dort Art. 1 Nr. 3.
[69]Artikel des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 20.6.2007, dort II. 3.
[70]Artikel des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 20.6.2007, dort II. 4.
[71]Diskussionsentwurf zum ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen vom 10.1.2008, dort Art. 1 Nr. 5 lit. a.
[72]Diskussionsentwurf zum ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen vom 10.1.2008, dort Art. 1 Nr. 5 lit. b.
[73]Diskussionsentwurf zum ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen vom 10.1.2008, dort Art. 1 Nr. 7 lit. a.
[74]Artikel des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 20.6.2007, dort II. 6.
[75] IW, Das Ende der Koalitionsfreiheit, S. 2; Handelsblatt Nr. 43 vom 29.2.2008, S.3, Titel: Wirtschaft macht Druck auf Merkel: Mindestlohnpläne „in den Schredder“; Handelsblatt Nr. 52 vom 13.3.2008,
S. 2, Titel: Angriff auf die Soziale Marktwirtschaft.
[76]HandelsblattNr. 43 vom 29.2.2008, S.3, Titel: Wirtschaft macht Druck auf Merkel: Mindestlohnpläne „in den Schredder“.
[77]BMAS, Online-Artikel vom 20.6.2007, dort I. 1.
[78]Siehe hierzu oben, § 1 I. 1. a) bb).
[79]HandelsblattNr. 35 vom 19.2.2008, S.3, Titel: SPD hofft auf Antragsflut für Mindestlöhne.
[80]SPD, „Hamburger Erklärung“ vom 18.2.2008.
[81]Waschulewski, Sicherheitsgewerbe und Entlohnung, S. 3f.
[82]BZA, Erklärung zur Aufnahme in das AEntG vom 11.8.2006.
[83]BZA, Zeitarbeitsindex vom 28.3.2008.
[84]HandelsblattNr. 60 vom 27.3.2008, S. 3, Titel: Nur wenige Branchen wollen Mindestlöhne.
[85]BZA/iGZ, Antrag auf Aufnahme der Arbeitnehmerüberlassung in das AEntG vom 27.3.2008.
[86]HandelsblattNr. 62 vom 31.3.2008, S. 4, Titel: Auch Pflegeverbände beantragen Mindestlohn.
[87]HandelsblattNr. 64 vom 2.4.2008, S. 4, Titel: Kommunen beantragen Mindestlöhne für zwei Branchen.
[88]BMAS, Material zur Information: Entsendegesetz und Mindestarbeitsbedingungengesetz, S.1.
[89]HandelsblattNr. 36 vom 20.2.2008, S. 5, Titel: Ver.di lässt Mindestlohn für Wachleute scheitern.
[90]Waschulewski, Sicherheitsgewerbe und Entlohnung, S. 4.
[91]HandelsblattNr. 31 vom 28.3.2008, S. 4, Titel: Wachgewerbe bringt ver.di gegen sich auf.
[92]BDWS, Presse Info Nr. 7/2008, S. 1.
[93]HandelsblattNr. 60 vom 27.3.2008, Titel: Nur wenige Branchen wollen Mindestlöhne.
[94]F.A.Z.Nr. 76 vom 1.4.2008, S. 11, Titel: Schwarze Flecken.
[95]F.A.Z.Nr. 76 vom 1.4.2008, S. 3, Titel: Der Frust der Reformer.
[96]HandelsblattNr. 63 vom 1.4.2008, S. 3, Titel: Merkel hält an Plänen für Mindestlohn fest.
[97]BMAS, Online-Artikel vom 20.6.2007.
[98]HandelsblattNr. 52 vom 13.3.2008, S. 2, Titel: Angriff auf die Soziale Marktwirtschaft.
[99]BZA, Erklärung zur Aufnahme in das AEntG vom 11.8.2006;Waschulewski, Sicherheitsgewerbe und Entlohnung, S. 3f.
[100]www.initiative-mindestlohn.de.
[101]www.mindestlohn.de.
[102]www.bda-online.de/www/bdaonline.nsf/ID/home.
[103]Zur Definition von Niedriglöhnen siehe unten, § 2 I. 1. c).
[104]Münchener Hdb. zum Arbeitsrecht/Richardi, § 240, Rn. 54.
[105] Bispinck/Schäfer, Niedriglöhne und Mindesteinkommen: Daten und Diskussionen in Deutschland,
S. 269.
[106]Blanke, Mindestlohn und Tarifautonomie, S. 187.
[107]NGG/ver.di, Arm trotz Arbeit?, S. 2.
[108]Bosch/Weinkopf/Kalina, Gesetzliche Mindestlöhne auch in Deutschland?, S. 48.
[109]Siehe hierzu oben, § 1 III.
[110]WirtschaftswocheNr. 10 vom 3.3.2008, S. 16, Titel: Lohndumping schadet.
[111]Bundesagentur für Arbeit, Grundsicherung für Arbeitssuchende: Anrechenbare Einkommen und Erwerbstätigkeit, S. 9.
[112]Bundesagentur für Arbeit, Analyse der Grundsicherung für Arbeitssuchende, S. 19.
[113]Bosch/Weinkopf/Kalina, Gesetzliche Mindestlöhne auch in Deutschland?, S. 49.
[114]Peter, Mindestlohn ohne Gesetz?, S. 241.
[115]SPD, „Hamburger Erklärung“ vom 18.2.2008, Titel: Hamburg – stark und Sozial.
[116]WirtschaftswocheNr. 10 vom 3.3.2008, S. 16, Titel: Lohndumping schadet.
[117]NGG/ver.di, Arm trotz Arbeit?, S. 2.
[118]So z.B.:Bispinck/Schulten, WSI Mitteilungen 2008, 151 ff.;Bispinck/Schäfer/Schulten,
WSI Mitteilungen 2004, 575 ff.;Bosch/Weinkopf/Kalina, Gesetzliche Mindestlöhne auch in Deutschland?, S. 4 ff.;NGG/ver.di, Arm trotz Arbeit?, S. 6 ff.;Rhein/Gartner/Krug, Niedriglohnsektor: Aufstiegschancen für Geringverdiener verschlechtert, S. 1 ff.
[119]Siehe hierzu oben, § 2 I. 1. b).
[120]Bispinck/Schulten, WSI Mitteilungen 2008, 151; Median (oder Zentralwert) bezeichnet eine Grenze zwischen zwei Hälften. Bei einem Medianlohn (nicht zu verwechseln mit dem Durchschnittslohn) verdient die eine Hälfte aller Beschäftigten mehr, die andere Hälfte weniger als diesen Lohn.
[121]so z.B.:NGG/ver.di, Arm trotz Arbeit?, S. 6.
[122]Schäfer, WSI Mitteilungen 2003, 420 f.
[123]Kalina/Weinkopf, IAQ-Report Nr. 1/2008, S. 2.
[124]Kalina/Weinkopf, IAQ-Report Nr. 1/2008, S. 1.
[125]Kalina/Weinkopf, IAQ-Report Nr. 1/2008, S. 4 u. 9.
[126]Bispinck/Schäfer/Schulten, WSI Mitteilungen 2004, 575.
[127]Referentenentwurf zur Änderung des AEntG vom 11.1.2008, dort A.
[128]HandelsblattNr. 44 vom 3.3.2008, S. 3, Titel: Schmoldt gibt Hundt Schuld am Mindestlohn. Hier sei angemerkt, dass Schmoldt im Gewerkschaftslager eigentlich zu den Mindestlohnskeptikern gehört.
[129]Bispinck/Schulten, WSI Mitteilungen 2008, 151 ff.;Bosch/Weinkopf/Kalina, Gesetzliche Mindestlöhne auch in Deutschland?, S. 6.
[130]NGG/ver.di, Arm trotz Arbeit?, S. 1;IW, Argumente zu Unternehmensfragen Nr. 2/2008, S.2;IW, Das Ende der Koalitionsfreiheit, S. 2.
[131]Bispinck/Schulten, WSI Mitteilungen 2008, 151;Bosch/Weinkopf/Kalina, Gesetzliche Mindestlöhne auch in Deutschland?, S. 6.
[132]Bispinck/Schulten, WSI Mitteilungen 2008, 151.
[133]HandelsblattNr. 61 vom 28.3.2008, S. 4, Titel: Wachgewerbe bringt ver.di gegen sich auf.
[134]BDWS, Presse Info Nr. 7/2008, S. 1.
[135]Bispinck/Schulten, WSI Mitteilungen 2008, 151, 154.
[136]Bispinck/Schulten, WSI Mitteilungen 2008, 151, 154 f.;Bosch/Weinkopf/Kalina, Gesetzliche Mindestlöhne auch in Deutschland?, S. 6 f.;NGG/ver.di, Arm trotz Arbeit?, S. 16 f.
[137]Bispinck/Schäfer/Schulten, WSI Mitteilungen 2004, 575.
[138]Siehe hierzu unten, § 2 I. 2. a).
[139]NGG/ver.di, Arm trotz Arbeit?, S. 3.
[140]Bartsch, WSI Mitteilungen 2007, 589, 594;NGG/ver.di, Arm trotz Arbeit?, S. 3.
[141]NGG/ver.di, Arm trotz Arbeit?, S. 22.
[142]Bosch/Weinkopf/Kalina, Gesetzliche Mindestlöhne auch in Deutschland?, S. 44.
[143] So zB.: BDA, Presseinformation Nr. 25/2008; IW, Argumente zu Unternehmensfragen Nr. 2/2008, S. 1 f.; IW, Das Ende der Koalitionsfreiheit, S. 2; Raddatz/Wolf, Irrglaube Mindestlöhne, S. 6; vbw, Broschüre: Arbeitsplatz statt Mindestlohn!, S. 2 f.
[144]Raddatz/Wolf, Irrglaube Mindestlöhne, S. 6.
Details
- Titel
- Zur Fragwürdigkeit von Mindestlöhnen in Deutschland und deren Ausdehnung auf weitere Branchen
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2008
- Seiten
- 104
- Katalognummer
- V226319
- ISBN (eBook)
- 9783836621793
- Dateigröße
- 1126 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- mindestlohn arbeitnehmer entsendegesetz mindestarbeitsbedingung lohnuntergrenze
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2008, Zur Fragwürdigkeit von Mindestlöhnen in Deutschland und deren Ausdehnung auf weitere Branchen, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/226319

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.


