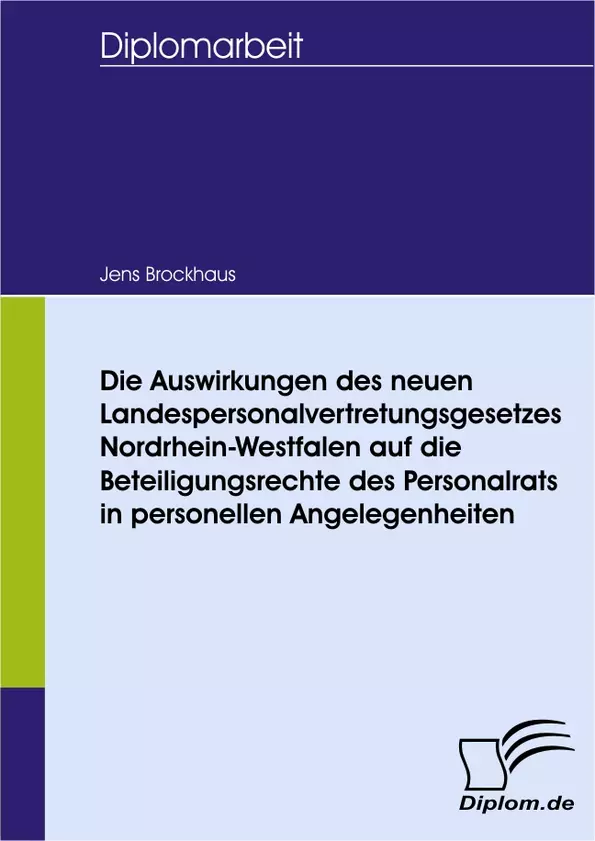Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos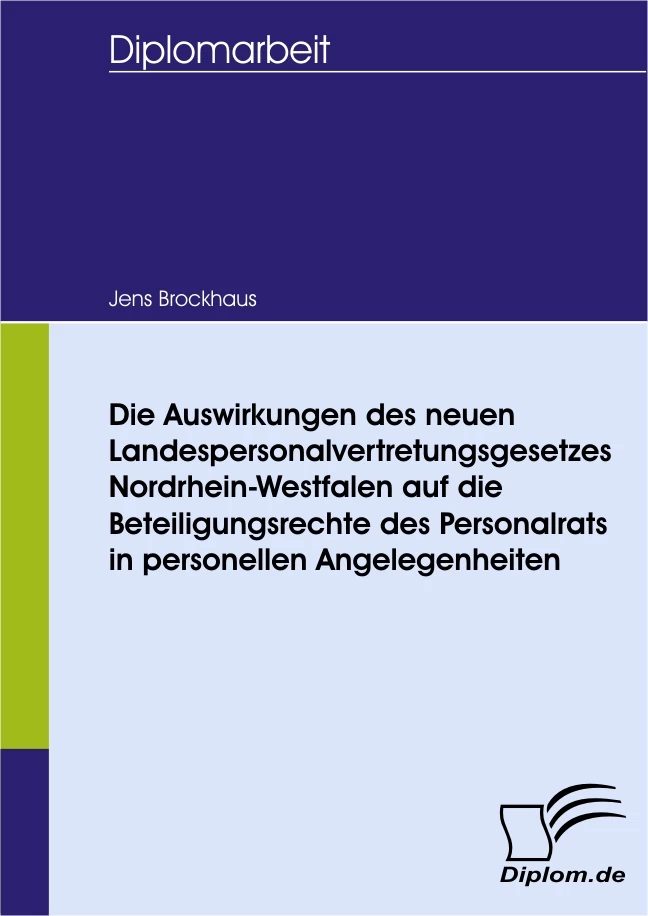
Die Auswirkungen des neuen Landespersonalvertretungsgesetzes Nordrhein-Westfalen auf die Beteiligungsrechte des Personalrats in personellen Angelegenheiten
Diplomarbeit, 2008, 159 Seiten
Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Note
2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
II. Abkürzungsverzeichnis
1 Einführung
2 Begriffsbestimmungen und allgemeine Informationen
2.1 Personalrat und Personalvertretung
2.2 Dienststelle und Dienststellenleiter
2.3 Beschäftigte
2.4 Beteiligungsrechte des Personalrats
2.4.1 Mitbestimmung
2.4.2 Mitwirkung
2.4.3 Anhörung
2.4.4 Sonstige Rechte
2.5 Der Märkische Kreis
2.6 Allgemeine Informationen zum neuen LPVG
3 Die Beteiligungstatbestände im Einzelnen
3.1 Mitbestimmungstatbestände
3.1.1 Nebenabreden
3.1.1.1 Änderung und Begründung
3.1.1.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
3.1.1.3 Empfehlung
3.1.2 Erneute Zuweisung des Arbeitsplatzes
3.1.2.1 Änderung und Begründung
3.1.2.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
3.1.2.3 Empfehlung
3.1.3 Verlängerung der Probezeit
3.1.3.1 Änderung und Begründung
3.1.3.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
3.1.3.3 Empfehlung
3.1.4 Anstellung eines Beamten
3.1.5 Umwandlung des Beamtenverhältnisses in ein solches anderer Art
3.1.5.1 Änderung und Begründung
3.1.5.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
3.1.5.3 Empfehlung
3.1.6 Befristung von Arbeitsverhältnissen
3.1.6.1 Änderung und Begründung
3.1.6.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
3.1.6.3 Empfehlung
3.1.7 Zulassung zum Aufstieg
3.1.7.1 Änderung und Begründung
3.1.7.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
3.1.7.3 Empfehlung
3.1.8 Übertragung eines anderen Amtes mit niedrigerem Endgrundgehalt
3.1.9 Wechsel des Dienstzweiges
3.1.10 Herabgruppierung
3.1.11 Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit
3.1.12 Bestimmung der Fallgruppe oder des Abschnitts innerhalb einer Vergütungs- oder Lohngruppe
3.1.13 Wesentliche Änderungen des Arbeitsvertrages
3.1.14 Umsetzung innerhalb der Dienststelle ohne Dienstortwechsel
3.1.14.1 Änderung und Begründung
3.1.14.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
3.1.14.3 Empfehlung
3.1.15 Umsetzung innerhalb der Dienststelle mit Dienstortwechsel
3.1.15.1 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
3.1.15.2 Empfehlung
3.1.16 Abordnung und Zuweisung von Beamten für eine Dauer von mehr als drei Monaten und ihre Aufhebung
3.1.17 Zuweisung von Arbeitnehmern gem. tarifrechtlicher Vorschriften für eine Dauer von mehr als drei Monaten und ihre Aufhebung
3.1.18 Kürzung der Anwärterbezüge oder der Unterhaltsbeihilfe
3.1.19 Entlassung eines Beamten auf Probe oder auf Widerruf oder Entlassung aus einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis, wenn der Beschäftigte die Maßnahme nicht selbst beantragt hat
3.1.20 Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, wenn der Beamte die Maßnahme nicht selbst beantragt hat
3.1.21 Feststellung der begrenzten Dienstfähigkeit, wenn der Beamte die Maßnahme nicht selbst beantragt hat
3.1.22 Weiterbeschäftigung von Arbeitnehmern über die Altersgrenze hinaus
3.1.23 Untersagung einer Nebentätigkeit
3.1.24 Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub ohne Fortzahlung der Vergütung mit entsprechender Arbeitsvertragsänderung bei Tariflich Beschäftigten
3.1.24.1 Änderung und Begründung
3.1.24.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
3.1.24.3 Empfehlung
3.1.25 Ausschluss der Mitbestimmungsrechte i. S. d. § Abs. 1 Satz 1 LPVG für Beamtenstellen von der Besoldungsgruppe A 16 an aufwärts sowie für Arbeitnehmer, die ein außertarifliches Entgelt erhalten
3.1.26 Einführung, Ausgestaltung und Aufhebung der gleitenden Arbeitszeit
3.1.27 Allgemeine Regelungen des Ausgleichs von Mehrarbeit
3.1.28 Fragen der Gestaltung des Arbeitsentgelt
3.1.29 Bestellung und Abberufung von Sicherheitsfachkräften
3.1.30 Abberufung von Vertrauens- und Betriebsärzten
3.1.31 Grundsätze über die Durchführung der Berufsausbildung der Arbeitnehmer
3.1.32 Maßnahmen, die der Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern dienen
3.2 Gründe für die Verweigerung der Zustimmung des Personalrats in Personalangelegenheiten i. S. d. § 72 Abs. 1 LPVG
3.2.1 Verstoß gegen geltende Regelungen
3.2.2 Besorgnis der ungerechtfertigten Benachteiligung von Beschäftigten
3.2.3 Besorgnis der Störung des Friedens in der Dienststelle
3.3 Mitwirkungstatbestände
3.3.1 Aufstellung von Frauenförderplänen
3.3.2 Behördliche oder betriebliche Grundsätze der Personalplanung
3.3.3 Grundsätze über die Durchführung der Berufsausbildung der Beamten
3.3.3.1 Änderung und Begründung
3.3.3.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
3.3.3.3 Empfehlung
3.3.4 Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach dem Arbeitsförderungsgesetz
3.3.5 Wesentliche Änderungen des Arbeitsvertrages
3.3.6 Stellenausschreibung, soweit die Personalmaßnahme der Mitbestimmung unterliegt
3.3.7 Erhebung der Disziplinarklage gegen einen Beamten
3.4 Anhörungstatbestände
3.4.1 Behördliche oder betriebliche Grundsätze der Personalplanung
3.4.2 Mitteilung an Auszubildende, deren Einstellung nach beendeter Ausbildung nicht beabsichtigt ist
3.4.3 Anordnung von amts- oder vertrauensärztlichen Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits- oder Dienstfähigkeit
3.5 Beteiligung des Personalrats bei der Beendigung des Arbeits- oder Beamtenverhältnisses sowie bei der Abmahnung
3.5.1 Ordentliche Kündigung
3.5.2 Außerordentliche Kündigung
3.5.3 Kündigung in der Probezeit
3.5.4 Aufhebung- oder Beendigungsverträge
3.5.5 Wirksamkeit der Kündigung
3.5.6 Anhördung des Arbeitnehmers
3.5.7 Abschrift der Stellungnahme des Personalrats an den Arbeitnehmer
3.5.8 Weiterbeschäftigungsanspruch bei ordentlicher Kündigung
3.5.9 Abmahnung
3.5.10 Fristlose Entlassung
3.5.11 Entlassung von Beamten auf Probe oder auf Widerruf sowie vorzeitige Versetzung in den Ruhestand
4 Zusammenfassung
III. Literaturverzeichnis
IV. Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einführung
Die Personalvertretung im öffentlichen Dienst hat die Aufgabe, die Interessen der Beschäftigten im Rahmen der ihm zustehenden Rechte wahrzunehmen.[1] Um die Wahrung der Menschenwürde und der Persönlichkeitsentfaltung[2] zu sichern, sollen die Beschäftigten durch den von ihnen gewählten Personalrat in die Lage versetzt werden, auf die für sie relevanten Entscheidungen der Dienststelle Einfluss zu nehmen.[3] Die Regelungen der Personalvertretungsgesetze des Bundes und der Länder geben den Rahmen vor, in dem die Interessenskonflikte zwischen der Dienststelle und den Beschäftigten ausgetragen werden können.[4]
Das Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LPVG) galt bisher im Vergleich zu anderen Landespersonalvertretungsgesetzen insbesondere seit der Novellierung im Jahre 1984 als ein sehr mitbestimmungsfreundliches Personalvertretungsgesetz.[5] Am 17.10.2007 sind durch das nordrhein-westfälische Gesetz zur Änderung des Personalvertretungsrechts und schulrechtlicher Vorschriften[6] wesentliche Änderungen des LPVG in Kraft getreten. Die damit einhergehende Beschränkung der bisherigen Beteiligungsrechte der Personalräte hat bereits während des Gesetzgebungsverfahrens zu Demonstrationen tausender Beschäftigter des öffentlichen Dienstes sowie zu massiven Protesten seitens diverser Gewerkschaften geführt.[7]
Die Landesregierung NRW will durch die Novellierung u. a. unter dem Blickwinkel der Verwaltungsmodernisierung den Handlungsspielraum der Dienststellenleiter bei Personalmaßnahmen erweitern und eine Annäherung zum Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) herbeiführen.[8] Die Gewerkschaften kritisieren die Reduzierung der Beteiligungsrechte des Personalrats insbesondere in personellen Angelegenheiten.[9]
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die wesentlichen Änderungen bei Beteiligungsrechten des Personalrats in personellen Angelegenheiten. Dabei wird konkret auf die besonderen Gegebenheiten des Märkischen Kreises[10] Bezug genommen und eine Empfehlung gegeben, wie die Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalrat im Hinblick auf die eingeschränkten oder weggefallenen Beteiligungsrechte gestaltet werden kann.
Zunächst werden diverse Begriffsbestimmungen vorgenommen und allgemeine Informationen zum neuen LPVG aufgeführt.
Anschließend werden die von der Novellierung betroffenen Beteiligungsvorschriften in personellen Angelegenheiten untersucht. Im Einzelnen werden § 66 Abs. 3, § 72 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 13 und Nr. 18, § 73 Nr. 2 und Nr. 4, § 74, § 75 Abs. 1 Nr. 4 LPVG sowie im Zuge der Novellierung weggefallene Beteiligungsrechte betrachtet. Die Reihenfolge richtet sich dabei nach den Vorschriften des LPVG in seiner alten Fassung mit der Ausnahme, dass im Anschluss an die zunächst im Rahmen des § 72 LPVG behandelten Mitbestimmungsrechte § 66 Abs. 3 LPVG und zuletzt die Beteiligungsrechte bei Kündigung und Entlassung gem. § 74 LPVG untersucht werden. Zu den jeweiligen Änderungen werden jeweils – wenn möglich – Empfehlungen für den Umgang mit der neuen Situation für den Märkischen Kreis ausgesprochen.
In der Zusammenfassung werden die sich aus der Novellierung ergebenden Änderungen des LPVG im Hinblick auf die künftige Zusammenarbeit zwischen der Dienststelle und dem Personalrat des Märkischen Kreises unter der Voraussetzung bewertet, dass die erarbeiteten Empfehlungen umgesetzt werden.
2 Begriffsbestimmungen und allgemeine Informationen
2.1 Personalrat und Personalvertretung
Die Personalvertretung wird im gesamten Text dieser Arbeit auch als Personalrat bezeichnet, da für den Märkischen Kreis als Gemeindeverband gem. § 1 Abs. 2 KrO ohne weitere Dienststelle i. S. d. § 1 Abs. 3 LPVG weder eine Stufenvertretung nach § 50 Abs. 1 LPVG noch ein Gesamtpersonalrat nach § 52 LPVG besteht.
2.2 Dienststelle und Dienststellenleiter
Die Begriffe Dienststelle und Dienststellenleiter werden im Rahmen dieser Diplomarbeit synonym verwandt. Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 2 LPVG und § 25 Abs. 2 Satz 1 sowie § 42 lit. a und g KrO ist beim Märkischen Kreis als Gemeindeverband i. S. d. § 1 Abs. 2 KrO der Landrat Leiter der Dienststelle.[11]
Da der Landrat gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LBG i. V. m. § 49 Abs. 1 Satz 1 KrO Dienstvorgesetzter der Bediensteten, also der Beamten und Arbeitnehmer[12] ist, werden im Folgenden alternativ zur Dienststelle auch die Begriffe Dienstherr und Arbeitgeber sowie Märkischer Kreis verwandt.
2.3 Beschäftigte
Als Beschäftigte im Rahmen dieser Diplomarbeit gelten alle Beschäftigten i. S. d. § 5 Abs. 1 bis 4 LPVG. Hiervon dem Wortlaut nach zu unterscheiden sind die sog. Tariflich Beschäftigten, die in Anlehnung an § 1 Abs. 1 TVöD lediglich die bisherigen Angestellten und Arbeiter umfassen.
2.4 Beteiligungsrechte des Personalrats
2.4.1 Mitbestimmung
Die Mitbestimmung stellt die größte Einflussmöglichkeit des Personalrats dar.[13] Bei den mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten sollen die Personalvertretung und die Dienststelle gleichberechtigt an der Willensbildung beteiligt sein.[14] Das Mitbestimmungsverfahren ist § 66 LPVG zu entnehmen. Zu beachten ist dabei, dass unter den Voraussetzungen des § 66 Abs. 4 Satz 1 LPVG in sämtlichen mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten ein Initiativrecht seitens des Personalrats besteht.
Sofern der Personalrat einer beabsichtigten Maßnahme der Dienststelle nicht zustimmt, erfolgt gem. § 66 Abs. 2 Satz 5 2. Halbsatz LPVG zunächst eine Erörterung mit dem Dienststellenleiter. Bestehen im Anschluss an die Erörterung noch immer Unstimmigkeiten, kann die Dienststelle nach § 66 Abs. 7 Satz 1 lit. b LPVG die Einigungsstelle anrufen. Diese entscheidet jedoch nicht in sämtlichen Angelegenheiten abschließend, sondern kann gem. § 66 Abs. 7 Satz 3 LPVG in einigen Fällen (§ 72 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 4 Nr. 2, 6, 11, 12 und 14 bis 17 LPVG) nur eine Empfehlung an die endgültig entscheidende Stelle abgeben. In diesen Fällen entscheidet nach § 68 Satz 1 Nr. 2 LPVG das verfassungsmäßig zuständige oberste Organ oder der von ihm bestimmte Ausschuss endgültig. Umstritten ist allerdings, wer als oberstes Organ des Märkischen Kreises anzusehen ist. Laut § 26 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 42 lit. a und § 49 Abs. 1 KrO sowie § 15 Abs. 3 der Hauptsatzung des Märkischen Kreises[15] ist der Kreistag, der Kreisausschuss oder der Landrat das oberste Organ.[16] Derzeit ist zu dieser Problematik beim Märkischen Kreis ein Gerichtsverfahren anhängig, bei der die Dienststelle die Auffassung vertritt, dass der Landrat das oberste Organ darstellt.
Die Letztentscheidungsrechte der Einigungsstelle sind durch die Novellierung des LPVG aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1995[17] eingeschränkt worden. Bisher wurden von der Einigungsstelle lediglich in personellen Angelegenheiten, die nur Beamte betrafen, Empfehlungen an die endgültig entscheidende Stelle ausgesprochen (§ 66 Abs. 7 Satz 4 LPVG a. F.). Der Empfehlungscharakter trifft nun auf alle personellen Maßnahmen zu. Außerdem ist das sog. Evokationsrecht des obersten Organs gem. § 66 Abs. 7 Satz 4 LPVG eingeführt worden.[18]
2.4.2 Mitwirkung
Im Gegensatz zur Mitbestimmung kann die Mitwirkung auch als Einspruchsrecht des Personalrats bezeichnet werden.[19]
Der Personalrat ist gem. § 69 Abs. 6 Satz 1 LPVG berechtigt, nach erfolgloser Erörterung die endgültige Entscheidung durch das zuständige oberste Organ oder den von ihm bestimmten Ausschuss[20] zu beantragen.
2.4.3 Anhörung
Die Anhörung unterliegt keiner speziellen Verfahrensregelung. Grundsätzlich gilt, dass bei anhörungspflichtigen Angelegenheiten dem Personalrat gem. § 75 Abs. 2 LPVG rechtzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden muss, damit diese die endgültige Entscheidung über die beabsichtigte Maßnahme noch beeinflussen kann. Der Personalrat hat allerdings keine Möglichkeit, die Letztentscheidung bei einer anhörungspflichtigen Maßnahme durch das oberste Organ herbeizuführen.[21]
2.4.4 Sonstige Rechte
Weitere Beteiligungsrechte und Aufgaben des Personalrats ergeben sich aus den §§ 46, 62 bis 65, 76 und 77 LPVG.[22] Im Rahmen dieser Arbeit wird z. B. auf das Überwachungsrecht nach § 64 Nr. 2 LPVG näher eingegangen.
2.5 Der Märkische Kreis
Auf einer Fläche von mehr als 1.000 Quadratkilometern leben im Märkischen Kreis mehr als 440.000 Einwohner.[23] Damit zählt der Märkische Kreis zu den 25 bevölkerungsreichsten Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland.[24] Die vielfältigen Aufgaben erfordern einen Personalbestand von 1.250 Beschäftigten bei 976,6 Stellen.[25]
In nahezu allen Städten und Gemeinden des Kreisgebietes befinden sich Dienstgebäude.[26] Die meisten Beschäftigten arbeiten an den Dienstorten Lüdenscheid (Sitz des Märkischen Kreises[27] ), Iserlohn und Altena.
Durch die Mitgliedschaft beim KAV NW als größtem Mitgliedverband der VKA[28] ist der Märkische Kreis tarifgebunden. Maßgeblicher Tarifvertrag ist der TVöD.
Beim Märkischen Kreis sind 3 Mitglieder des Personalrats freigestellt. Dies entspricht inhaltlich sowohl den bisherigen als auch den neuen Regelungen des § 42 Abs. 4 Satz 4 LPVG n. F.
2.6 Allgemeine Informationen zum neuen LPVG
Die Novellierung des LPVG hat nicht nur im Bereich der personellen, sondern auch in einigen anderen Angelegenheiten zu Änderungen geführt.
Zum einen wurden die Verfahrensabläufe bei der Mitbestimmung und Mitwirkung des Personalrats z. T. neu geregelt (§§ 66 bis 69 LPVG). Zum anderen sind einige redaktionelle Anpassungen erfolgt, z. B. die Aufgabe der Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern aufgrund der Änderungen des TVöD, vgl. u. a. § 5 Abs. 1 Satz 1 LPVG.
Darüber hinaus sind verschiedene Regelungen aus dem BPersVG, die bisher unmittelbar für die Länder galten, in das LPVG übernommen worden. Dazu gehört u. a. das Benachteiligungs- bzw. Begünstigungsverbot bei Personalratsmitgliedern nach § 7 Abs. 1 LPVG. Hintergrund für die Übernahme solcher Regelungen aus dem BPersVG ist der Wegfall der Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes im Dienstrecht, wonach die §§ 107 bis 109 BPersVG lediglich gem. Art. 125a GG weiter gegolten hätten.
Aufgrund der teilweisen Anpassung des LPVG an die Formulierung des BPersVG und der damit automatisch verbundenen inhaltlichen Angleichung an verschiedene Landespersonalvertretungsgesetze wird im Rahmen dieser Arbeit auch die Literatur zum entsprechenden Bundes- oder Landesrecht zitiert.
3 Die Beteiligungstatbestände im Einzelnen
3.1 Mitbestimmungstatbestände
3.1.1 Nebenabreden
3.1.1.1 Änderung und Begründung
Die Mitbestimmung des Personalrats bei Nebenabreden war bisher in § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPVG a. F. geregelt und ist weggefallen. Dies soll die Vertragsfreiheit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer stärken.[29]
Zu den Nebenabreden zählen z. B. Fahrtkostenzuschüsse, Verpflegungszuschüsse, Aufwandspauschalen, die Überlassung einer Dienstmietwohnung, die Verpflichtung zur Rückzahlung von Aus- und Fortbildungskosten, die Abkürzung der Probezeit sowie Vereinbarungen über die Anrechnung von Zeiten als Beschäftigungs- oder Dienstzeit.[30] Charakteristisch für Nebenabreden ist, dass sie sich nicht direkt auf die Hauptleistungspflichten des eigentlichen Arbeitsvertrages beziehen.[31]
3.1.1.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
Der Märkische Kreis hat bisher in Einzelfällen Nebenabreden mit den Beschäftigten in Abstimmung mit dem Personalrat vereinbart.
3.1.1.3 Empfehlung
Trotz der eher geringen Bedeutung im Allgemeinen[32] und insbesondere beim Märkischen Kreis ist zu überlegen, ob der Personalrat über die Vereinbarung von Nebenabreden informiert werden kann.
Im Rahmen der Überwachung der Gleichbehandlung aller Beschäftigten durch die Dienststelle und den Personalrat gem. § 62 LPVG bzw. der Überwachung der Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten geltenden Regelungen durch die Personalvertretung gem. § 64 Nr. 2 LPVG erscheint es notwendig, eine Information über beabsichtigte Nebenabreden an den Personalrat zu geben. Dieser hat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben grundsätzlich einen Unterrichtungsanspruch nach § 65 Abs. 1 LPVG.[33] Der Märkische Kreis und der Personalrat sind daran interessiert, einheitliche Regelungen zu treffen, um Ungleichbehandlungen zu vermeiden. Dabei muss die Dienststelle alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandeln, d. h. neben sämtlichen Vorschriften und dem Gewohnheitsrecht auch das Rechtsgefühl, den Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB und billigem Ermessen nach § 315 BGB sowie die menschlichen und sozialen Belange aller Beteiligten und die Besonderheit des Einzelfalls beachten.[34]
In diesem Zusammenhang stellt sich jedoch zum einen die Frage, ob die Dienststelle dem Anspruch, den beabsichtigten Abschluss einer Nebenabrede nach § 65 Abs. 1 LPVG rechtzeitig[35] dem Personalrat mitzuteilen, gerecht werden kann, wenn die Nebenabrede noch nicht endgültig verhandelt worden ist. Die Vereinbarung kommt nur durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen[36] der Dienststelle und des Arbeitnehmers zustande. Die endgültige Version der Nebenabrede steht folglich erst zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Vereinbarung fest. Demnach wäre allenfalls eine nachträgliche Information an den Personalrat möglich.
Zum anderen ist zu beachten, dass die Persönlichkeitsrechte und die personenbezogenen Daten der Beschäftigten geschützt werden müssen.[37] Die Nebenabrede wird nach ihrer Vereinbarung Bestandteil der Personalakte. Ihre Offenbarung gegenüber dem Personalrat käme dessen Einsichtnahme in die Personalakte gleich. Dies ist jedoch gem. § 65 Abs. 3 Satz 1 LPVG nur mit Zustimmung des Beschäftigten möglich, da es sich nicht um listenmäßig aufgeführte Personaldaten, die regelmäßig Entscheidungsgrundlage in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten sind, handelt.
Daher dürfen Nebenabreden nur noch mit dem ausdrücklichen Einverständnis des Beschäftigten dem Personalrat mitgeteilt werden.
Außerdem können sich der Betroffene oder andere Beschäftigte, die Kenntnis über eine bestimmte Nebenabrede erlangt haben, beim Personalrat gem. § 64 Nr. 5 LPVG über den Inhalt der Regelungen beschweren, wenn sie sich benachteiligt fühlen. In diesem Fall kann die Personalvertretung eine vollständige Unterrichtung verlangen und ggf. ihre Bedenken vortragen.[38]
Die hier gewonnenen Erkenntnisse gelten uneingeschränkt auch für die Änderung bereits bestehender Nebenabreden. Es ist unerheblich, ob eine Nebenabrede als Teil eines Arbeitsvertrages oder als rechtlich eigenständige – kündbare – Ergänzung hierzu[39] anzusehen ist. Ihr Regelungsinhalt kann sich nicht auf die für den eigentlichen Arbeitsvertrag maßgeblichen Hauptleistungspflichten beziehen, so dass eine Mitwirkung des Personalrats im Rahmen wesentlicher Änderungen des Arbeitsvertrages nach § 73 Nr. 2 LPVG bei der Änderung von – unwesentlichen – Nebenabreden nicht in Betracht kommt.
3.1.2 Erneute Zuweisung des Arbeitsplatzes
3.1.2.1 Änderung und Begründung
Die erneute Zuweisung des Arbeitsplatzes gem. Arbeitsplatzsicherungsvorschriften – hierzu zählen die zurückkehrenden Wehr- oder Zivildienstleistenden sowie die Rückkehrwilligen aus der Elternzeit[40] – bzw. nach Beendigung eines unbezahlten Urlaubs nach § 78 b oder § 85 a des LBG sowie nach den entsprechenden Regelungen für Tariflich Beschäftigte unterliegt aufgrund der Änderung des § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPVG a. F. nicht mehr der Mitbestimmung des Personalrats.
Durch diese Maßnahme soll das Direktionsrecht des Dienststellenleiters gestärkt werden.[41]
3.1.2.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
Nach § 1 Satz 1 der Dienstvereinbarung über die Ausschreibung von freien Stellen bei der Verwaltung des Märkischen Kreises (DV Ausschreibung) wurden bisher grundsätzlich sämtliche freien Stellen ausgeschrieben. In Ausnahmefällen konnten sich Dienststelle und Personalrat gem. § 2 Satz 2 der DV Ausschreibung auf einen Verzicht der Ausschreibung einigen, wobei das einer Mitbestimmung des Personalrats gleichkommt. Sämtliche Stellenausschreibungen unterlagen im Übrigen nach § 73 Nr. 6 LPVG a. F. der Mitwirkung der Personalvertretung. Bei den darauf folgenden Maßnahmen, z. B. der erneuten Zuweisung des Arbeitsplatzes nach Beendigung eines Urlaubs ohne Dienstbezüge, der Umsetzung für eine Dauer von mehr als drei Monaten, der Übertragung höherwertiger Aufgaben oder der Beförderung bzw. Höhergruppierung des Beschäftigten (§ 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 4 und 5 LPVG a. F.) hatte der Personalrat wiederum ein Mitbestimmungsrecht. Wenn sich die Dienststelle entschieden hat, eine Stelle nicht auszuschreiben, da ein rückkehrwilliges Elternteil diese Stelle besetzen sollte, so hat die Zustimmung des Personalrats zu dieser Personalmaßnahme gleichzeitig das Einverständnis zum mitwirkungspflichtigen Verzicht der Ausschreibung vorausgesetzt. Insofern war die Verpflichtung zur Ausschreibung von Stellen auch in jedem Fall gerechtfertigt.[42]
In der Vergangenheit hat es bei der Anwendung des § 2 Satz 2 der DV Ausschreibung in Einzelfällen unterschiedliche Auffassungen über die Zuweisung eines festen Arbeitsplatzes insbesondere von rückkehrwilligen Elternteilen aus der Elternzeit oder aus dem unbezahlten Urlaub gegeben, so dass aufgrund fehlender Einigung Stellen ausgeschrieben worden sind, obwohl diese Stellen direkt mit diesen Beschäftigten hätten besetzt werden können. Verliefen die Bewerbungen nicht erfolgreich, wurden die betroffenen Beschäftigten, sofern eine Verlängerung der Elternzeit oder des unbezahlten Urlaubs nicht mehr möglich oder seitens der Betroffenen nicht mehr gewünscht war, aufgrund ihres Weiterbeschäftigungsanspruchs häufig überhängig in anderen Bereichen eingesetzt. Dies wiederum führte zu erhöhten Personalkosten, wobei darüber hinaus die erfolgreichen Bewerber i. d. R. höhergruppiert bzw. befördert wurden.
3.1.2.3 Empfehlung
Da die Mitbestimmung des Personalrats bei erneuter Zuweisung des Arbeitsplatzes ersatzlos weggefallen ist, muss der Dienststelle nunmehr auch die Möglichkeit gegeben sein, solche Maßnahmen eigenständig durchzuführen. Allerdings ist zu beachten, dass die Mitwirkung des Personalrats bei Stellenausschreibungen auch nach der Novellierung des LPVG grundsätzlich bestehen geblieben ist. Das bedeutet, dass die Personalvertretung nach wie vor gegen die Entscheidung, eine Stelle nicht auszuschreiben, Einwendungen erheben kann.
Wie bereits ausgeführt spricht zudem die DV Ausschreibung gegen einen Verzicht auf Ausschreibung einer Stelle ohne Beteiligung des Personalrats.[43] Das hier eingeräumte Recht der Personalvertretung ist als Mitbestimmungstatbestand zu werten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Regelung eine unzulässige Ausweitung der im LPVG abschließend geregelten Beteiligungsrechte[44] darstellt, da gem. § 4 LPVG das Personalvertretungsrecht nicht durch Dienstvereinbarung abweichend vom LPVG geregelt werden darf.[45] § 2 Satz 2 der DV Ausschreibung ist daher unwirksam.[46]
Zur weitestgehenden Wahrung der Rechte des Personalrats und der Dienststelle ist eine Änderung der DV Ausschreibung notwendig. § 2 Satz 2 dieser Dienstvereinbarung könnte wie folgt formuliert werden:
„Die Dienststelle behält sich vor, freiwerdende oder neu geschaffene Stellen ohne Ausschreibungsverfahren mit Beamten bzw. Tariflich Beschäftigten zu besetzen, die gem. Arbeitsplatzsicherungsvorschriften oder nach Ablauf eines Urlaubs ohne Dienstbezüge gem. § 78 b oder § 85 a LBG oder nach entsprechenden Regelungen für Tariflich Beschäftigte einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung haben. Dies gilt jedoch nur dann, wenn mit der Maßnahme keine Umsetzung mit Dienstortwechsel i. S. d. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 LPVG und keine Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit gem. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LPVG verbunden ist. Der Personalrat wirkt bei der Entscheidung, eine freiwerdende oder neu geschaffene Stelle nicht auszuschreiben, nach Maßgabe des § 73 Nr. 2 LPVG mit.“
3.1.3 Verlängerung der Probezeit
3.1.3.1 Änderung und Begründung
Der Personalrat kann bei einer Verlängerung der Probezeit durch die Streichung dieses Tatbestandes aus dem § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPVG a. F. nicht mehr mitbestimmen. Der Dienststellenleiter soll dadurch in die Lage versetzt werden, im Einzelfall entsprechende Verlängerungen der Probezeit aufgrund einer individuellen Beurteilung im Rahmen seines Ermessensspielraums auszusprechen.[47]
Zu unterscheiden ist dabei zwischen einer Verlängerung der Probezeit bei Tariflich Beschäftigten und bei Beamten.
Im Bereich der Tariflich Beschäftigten ist die Verlängerung der Probezeit – trotz fehlender spezieller Regelung in § 2 Abs. 4 Satz 1 TVöD – grundsätzlich zulässig.[48] Allerdings hätte eine Verlängerung der Probezeit über 6 Monate hinaus keine Auswirkung auf die dann greifende reguläre Kündigungsfrist nach § 34 Abs. 1 TVöD bzw. auf die Anwendung des § 1 Abs. 1 KSchG gehabt. Die Probezeitverlängerung geht in dieser Hinsicht ins Leere[49] und hat schon aus diesem Grunde eine untergeordnete praktische Bedeutung.
Bei Beamten kann gem. § 23 Abs. 6 LBG die Probezeit verlängert werden, wenn die Bewährung eines Beamten bis zum Ablauf der aktuellen Probezeit nicht festgestellt werden kann. Im Gegensatz zu den Tariflich Beschäftigten sind Probezeitverlängerungen im Beamtenbereich daher von größerer praktischer Bedeutung.
3.1.3.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
Die Verlängerung von Probezeiten bei Tariflich Beschäftigten sind beim Märkischen Kreis bisher nur sehr selten in Erwägung gezogen worden.
Verlängerungen von Probezeiten bei Beamten sind allerdings im Vorfeld rechtzeitig und im Einvernehmen mit dem Personalrat besprochen worden. In der Regel wurden bereits vor den beabsichtigten Verlängerungen Maßnahmen ergriffen (z. B. Umsetzungen oder Schulungen), um den betroffenen Beamten das erfolgreiche Ableisten der Probezeit zu ermöglichen. In manchen Fällen ist dadurch eine Verlängerung der Probezeit entfallen.
3.1.3.3 Empfehlung
Der Personalrat hat nach § 64 Nr. 2 LPVG darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze und sonstigen Regelungen durchgeführt werden und somit vorliegend auch § 23 Abs. 6 LBG korrekt angewandt wird. Er wäre daher gem. § 65 Abs. 1 Satz 1 LPVG rechtzeitig und umfassend über die Verlängerung der Probezeit zu unterrichten.[50] Allerdings ist der Personalrat nur mit Zustimmung des Beamten in der Lage, die in der Personalakte enthaltene Probezeitverlängerung einzusehen (§ 65 Abs. 3 Satz 1 LPVG).[51] Insbesondere die dienstliche Beurteilung des Beamten, die ebenfalls Grundlage für die Entscheidung der Verlängerung der Probezeit sein dürfte[52], kann lediglich auf Verlangen des Beamten dem Personalrat zur Kenntnis gebracht werden (§ 65 Abs. 3 Satz 2 LPVG). In beiden Fällen müsste die Initiative auf jeden Fall vom Beamten selbst ausgehen. Fühlt sich der Beamte durch die Verlängerung der Probezeit ungerecht behandelt, so hat er das Recht, sich über diese Maßnahme gem. § 64 Nr. 5 LPVG beim Personalrat zu beschweren. In diesem Fall wird er auch dem Personalrat Einblick in die Akte und die dienstliche Beurteilung gewähren.
Um das Verfahren zu vereinfachen und den Personalrat bereits frühzeitig über die Problematik zu informieren, wird empfohlen, die Verlängerung der – im gehobenen Dienst gem. § 29 Abs. 2 LVO i. d. R. immerhin 2 Jahre und 6 Monate andauernden – Probezeit zu veranlassen und gleichzeitig dem Personalrat eine Vorlage mit der Bitte um Mitwirkung gem. § 74 Abs. 3 LPVG zukommen zu lassen, aus der hervorgeht, dass im Falle einer nicht erfolgreich verlaufenden Probezeit die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf Probe beabsichtigt ist. Fehlt es an einer solchen Vorlage und dem damit verbundenen Vorhaben der Dienststelle, könnte ein Mitglied des Personalrats auch nicht auf Wunsch des Beamten gem. § 65 Abs. 3 Satz 3 LPVG an Gesprächen mit entscheidungsbefugten Personen der Dienststelle teilnehmen, da die reine Probezeitverlängerung keine beteiligungspflichtige Angelegenheit mehr darstellt.
Zwar ist es auch möglich, beide Angelegenheiten (Probezeitverlängerung und Entlassung) getrennt voneinander zu betrachten und die eventuelle Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf Probe erst kurzfristig anzukündigen, allerdings muss der Personalrat im Hinblick auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle der Beschäftigten (§ 2 Abs. 1 1. Halbsatz LPVG) rechtzeitig und umfassend über solche Maßnahmen unterrichtet werden.[53] Da bei einer Verlängerung der Probezeit stets die anschließende Entlassung aus dem Beamtenverhältnis droht, sollte die Unterrichtung des Personalrats aus Gründen der vertrauensvollen Zusammenarbeit gem. § 2 Abs. 1 LPVG so früh wie möglich – also bereits im Rahmen der Probezeitverlängerung – erfolgen.
Eine Empfehlung für die Vorgehensweise bei der Verlängerung der Probezeit von Tariflich Beschäftigten ist aufgrund fehlender Praxisrelevanz entbehrlich.
3.1.4 Anstellung eines Beamten
Unter der Anstellung eines Beamten versteht man nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 LBG die erste Verleihung eines Amtes im statusrechtlichen Sinne.[54] Die Anstellung wird nach dem noch nicht verabschiedeten neuen Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) des Bundes komplett entfallen[55], so dass auch kein Regelungsbedarf mehr hinsichtlich der Beteiligungsrechte des Personalrats besteht. Die entsprechende Regelung in § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPVG a. F. ist daher bereits gestrichen worden. Mit Problemen in der Praxis ist bis zur Verabschiedung des BeamtStG nicht zu rechnen. Die noch durchzuführenden Anstellungen dürften dem Personalrat ohnehin durch die vorangegangenen Ernennungen bekannt sein, da es sich hierbei um der Mitbestimmung unterliegende Einstellungen i. S. d. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPVG handelt.[56]
3.1.5 Umwandlung des Beamtenverhältnisses in ein solches anderer Art
3.1.5.1 Änderung und Begründung
Die Umwandlung des Beamtenverhältnisses in ein solches anderer Art fällt durch die Streichung des Tatbestands aus § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPVG a. F. nicht mehr in die Mitbestimmung des Personalrats, da die praktische Bedeutung laut Gesetzgeber zu gering ist.[57]
3.1.5.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
Gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 5 Abs. 1 LBG sind folgende Umwandlungen von Beamtenverhältnissen denkbar: die Ernennung eines Beamten auf Widerruf zum Beamten auf Probe oder auf Zeit, die Ernennung eines Beamten auf Probe zum Beamten auf Zeit oder auf Lebenszeit, die Ernennung eines Beamten auf Zeit zum Beamten auf Lebenszeit sowie die Ernennung eines Beamten auf Lebenszeit zum Beamten auf Zeit.[58]
Da jedoch mit dem Bestehen der Laufbahnprüfung des gehobenen Dienstes gem. § 16 LBG i. V. m. § 27 a Nr. 1 VAPgD das Beamtenverhältnis auf Widerruf endet[59] und die anschließende Ernennung zum Beamten auf Probe eine Einstellung i. S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 1 LBG darstellt, wäre dieser Fall nach § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPVG ohnehin mitbestimmungspflichtig.
Alle anderen genannten Fälle sind nach dem Beamtenrecht als reine Umwandlungen der Beamtenverhältnisse zu bezeichnen. Die Mitbestimmung des Personalrats verlief in allen genannten Fällen problemlos, insbesondere weil i. d. R. sämtliche ausgebildeten Beamtenanwärter nach Abschnitt II Ziff. 3 der Dienstvereinbarung über den Umgang mit Beschäftigten bei der Durchführung von Aufgabenkritik sowie der Einführung eines Neuen Steuerungsmodells beim Märkischen Kreis (DV Aufgabenkritik) grundsätzlich übernommen bzw. eingestellt werden.
3.1.5.3 Empfehlung
Die Umwandlung eines Beamtenverhältnisses in ein solches anderer Art darf nicht mehr dem Personalrat zur Mitbestimmung vorgelegt werden. Eine Ausnahme bildet beim Märkischen Kreis jedoch die Ernennung eines Beamten auf Widerruf zum Beamten auf Probe im mittleren nichttechnischen Dienst.
Der Märkische Kreis bildet neben den Beamten im gehobenen nichttechnischen Dienst auch solche im mittleren nichttechnischen Dienst aus. Bei ihnen endet allerdings das Beamtenverhältnis auf Widerruf nach dem Vorbereitungsdienst laut VAPmD-Gem nicht, so dass in diesen Fällen das Beamtenverhältnis auf Widerruf lediglich in ein solches auf Probe umgewandelt wird. Durch den Wegfall der Mitbestimmung würden die Beamten des mittleren und gehobenen nichttechnischen Dienstes unterschiedlich behandelt, obwohl die Kriterien des Dienstherrn, einen Beamten auf Widerruf in ein Beamtenverhältnis auf Probe einstellen bzw. übernehmen zu wollen, die gleichen sein dürften. Denn die Entscheidung der Einstellung bzw. Übernahme liegt gem. § 22 Abs. 1 und § 29 Abs. 1 lit. a LVO im Ermessen des Dienstherrn. Er hat folglich nach Beendigung des Vorbereitungsdienstes nach § 7 Abs. 1 und 2 LBG nochmals die Eignung, Befähigung und fachliche Leistung sowie die besondere geistige und charakterliche Eignung zu prüfen.
Infolgedessen muss die Ernennung zum Beamten auf Probe im mittleren nichttechnischen Dienst als Einstellung i. S. d. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPVG ausgelegt und dem Personalrat zwecks Mitbestimmung vorgelegt werden. Diese grundlegende Personalentscheidung soll dem Sinn und Zweck des LPVG nach von der Personalvertretung kontrolliert werden können.[60] Daher kommt es auch nicht darauf an, dass der Gesetzgeber die Mitbestimmung des Personalrats bei der Umwandlung eines Beamtenverhältnisses grundsätzlich nicht mehr ausdrücklich vorsieht.[61]
3.1.6 Befristung von Arbeitsverhältnissen
3.1.6.1 Änderung und Begründung
Der Arbeitgeber wird durch den Wegfall der Mitbestimmung des Personalrats bei der Befristung von Arbeitsverhältnissen (vgl. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPVG a. F.) in die Lage versetzt, allein über diese Maßnahmen unter Beachtung des TzBfG im Einvernehmen mit dem Tariflich Beschäftigten zu entscheiden. Der Gesetzgeber geht allerdings davon aus, dass die Mitbestimmung bei Einstellungen gem. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPVG auch den Aspekt der Befristung des Arbeitsverhältnisses umfasst. Bei bereits bestehenden Verträgen soll eine Änderung der Befristung eine mitwirkungspflichtige wesentliche Änderung des Arbeitsvertrages gem. § 73 Nr. 2 LPVG sein. Insofern hält der Gesetzgeber die konkrete Nennung dieses Mitbestimmungstatbestands für entbehrlich.[62]
3.1.6.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
Beim Märkischen Kreis sind bisher lediglich befristete Einstellungen vorgenommen worden, wenn die zu besetzenden Stellen ebenfalls zunächst befristet eingerichtet worden sind. In diesem Zusammenhang sind bei Bedarf auch befristete Verträge verlängert bzw. in unbefristete Verträge umgewandelt worden. An diesen Vorgängen wurde der Personalrat im Rahmen der Mitbestimmung stets beteiligt.
3.1.6.3 Empfehlung
Bei befristet eingerichteten Stellen dürfte die Befristung des Arbeitsvertrages aus Sicht des Personalrats unproblematisch sein, da dieser an der Stellenausschreibung gem. § 73 Nr. 2 LPVG bereits mitgewirkt hat und den Befristungsgrund und
-zeitraum daher schon kennt. In diesen Fällen ist eine erneute Beteiligung des Personalrats bei der konkreten Einstellung hinsichtlich der Befristung des Arbeitsverhältnisses schon aus diesem Grunde entbehrlich.
Sofern eine Stelle unbefristet eingerichtet worden ist, kommt die Befristung eines Arbeitsverhältnisses nur dann in Betracht, wenn ein sachlicher Grund vorliegt (z. B. zur Erprobung der Person oder wenn durch in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen; vgl. § 14 Abs.1 TzBfG) oder der Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund für eine Dauer von bis zu 2 Jahren abgeschlossen wird (vgl. § 14 Abs. 2 TzBfG). Die Prüfung dieser Voraussetzungen liegt nun allein beim Arbeitgeber. Entgegen der Auffassung des Gesetzgebers erstreckt sich laut Rechtsprechung die Mitbestimmung bei Einstellungen ohnehin nicht auf den Aspekt der Befristung des konkreten Vertrages.[63] Allerdings müssen dem Personalrat bei einer Einstellung gem. § 65 Abs. 1 Satz 1 LPVG alle wesentlichen Tatsachen bekannt gegeben werden, so dass die Dienststelle auch die Befristung mitzuteilen hat. Sollte der Personalrat im Einzelnen Bedenken gegen die Einstellung haben, könnte er diese aufgrund der Befristung des Arbeitsverhältnisses möglicherweise zurückstellen.[64]
Bei der Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen bzw. bei deren Umwandlung in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse handelt es sich entgegen der Auffassung des Gesetzgebers laut Rechtsprechung um erneute Einstellungen i. S. d. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPVG, da sich die Zustimmung des Personalrats bei der ursprünglichen Einstellung des Beschäftigten lediglich auf den ersten Befristungszeitraum bezogen hat.[65] Die Absicht der Verlängerung oder Aufhebung der Befristung der entsprechenden Arbeitsverträge unterliegt daher insofern automatisch der Mitbestimmung des Personalrats, es sei denn, dass diesem bereits bei einer befristeten Einstellung zur Erprobung des Beschäftigten mitgeteilt worden ist, ihn bei erfolgreichem Verlauf der Erprobungsphase unbefristet übernehmen zu wollen.[66]
3.1.7 Zulassung zum Aufstieg
3.1.7.1 Änderung und Begründung
Die Mitbestimmung des Personalrats bei der Zulassung zum Aufstieg – bisher in
§ 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LPVG a. F. geregelt – ist ersatzlos gestrichen worden. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass dieser Tatbestand wegfallen kann, weil der Aufstieg mit einer Ernennung bzw. Beförderung verbunden ist. und die Entscheidung über die Zulassung zum Aufstieg allein der Beurteilung des Dienstherrn unterliegt.[67]
3.1.7.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
Der Märkische Kreis hat bisher mit Zustimmung des Personalrats regelmäßig bei Bedarf Beamte zum Aufstieg zugelassen.
3.1.7.3 Empfehlung
Zunächst muss klargestellt werden, dass mit der Zulassung zum Aufstieg nur der beamtenrechtliche Begriff gemeint ist. Der Aufstieg bei Tariflich Beschäftigten (Angestelltenlehrgänge I und II) stellt eine Fortbildungsveranstaltung i. S. d. § 72 Abs. 4 Satz 1 Nr. 16 LPVG a. F. dar.[68]
Die Zustimmung des Personalrats soll nach dem Willen des Gesetzgebers erst nach dem erfolgreichen Abschluss des Aufstiegs des Beamten im Zuge der Beförderung
i. S. d. § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 4 LBG gem. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LPVG erfolgen. Dieser Ansatz greift jedoch zu kurz. Es wird verkannt, dass mit der Entscheidung, bestimmte Beamte zum Aufstieg zuzulassen, bereits die später normalerweise erfolgende Beförderung dieser Beamten eingeleitet und die Personalvertretung zu spät in den Entscheidungsprozess eingebunden wird. Außerdem wird der Beamte mit der Zulassung zum Aufstieg auf die Wahrnehmung höherwertiger Tätigkeiten vorbereitet. Unter Berücksichtigung dieses Aspekts ist die Zulassung zum Aufstieg als Einführung in höher zu bewertende Tätigkeiten zu verstehen und folglich nach § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der Mitbestimmung des Personalrats zu unterwerfen.[69]
3.1.8 Übertragung eines anderen Amtes mit niedrigerem Endgrundgehalt
Von der bisher in § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LPVG a. F. geregelten und nun entfallenen Mitbestimmung bei der Übertragung eines anderen Amtes mit niedrigerem Endgrundgehalt waren nur Fälle i. S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 4 LBG erfasst, in denen der Beamte bei der Auflösung, einer wesentlichen Änderung des Aufbaues oder der Aufgaben einer Behörde oder der Verschmelzung von Behörden bei seinem jetzigen Dienstherrn nicht amtsangemessen beschäftigt werden kann (§ 130 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 18 Abs. 2 Satz 2 BRRG[70], § 28 Abs. 2 Satz 2 LBG) oder in denen der Beamte die Rangherabsetzung selbst beantragt (§ 28 Abs. 1 Satz 1 LBG).[71] Die Herabsetzung des Beamten im Rahmen des Disziplinarverfahrens blieb hiervon unberührt, da diese nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 9 Abs. 1 LDG durch das Urteil des Gerichts erfolgt.[72]
Insofern hatte dieser Mitbestimmungstatbestand ohnehin kaum eine praktische Bedeutung für den Märkischen Kreis.
Da mit der von der Dienststelle beabsichtigten Rangherabsetzung die Wahrnehmung niedriger zu bewertender Tätigkeiten verbunden ist, muss der Personalrat gem. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LPVG bei einer solchen Maßnahme automatisch mitbestimmen.[73]
3.1.9 Wechsel des Dienstzweiges
Die bisher in § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LPVG a. F. geregelte Mitbestimmung des Personalrats beim Wechsel des Dienstzweiges galt lediglich für den Polizeidienst[74] und wird hier nicht näher betrachtet.
3.1.10 Herabgruppierung
Das Wort Rückgruppierung in § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LPVG a. F. wurde durch das Wort Herabgruppierung ersetzt. Damit erfolgte eine Anpassung an den Wortlaut des neuen Tarifrechts, ohne den Sinn und Zweck der Vorschrift inhaltlich zu ändern.[75]
3.1.11 Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit
Durch den Wegfall des bisher im § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LPVG a. F. enthaltenen Bezugszeitraums entsteht der Eindruck, dass auch bei der nur vorübergehenden Übertragung anders bewerteter Tätigkeiten bei Krankheit, Urlaub sowie sonstiger zeitlich begrenzter Abwesenheit, desjenigen, der die Tätigkeit bisher wahrgenommen hat, und bei dienstlichem Bedarf aufgrund einer befristet wahrzunehmenden neuen Aufgabe, der Personalrat immer mitbestimmen muss. Dies ist jedoch nicht ganz unstrittig.
Im Bereich der Tariflich Beschäftigten sind laut Rechtsprechung tatsächlich auch vorübergehende Übertragungen höher bewerteter Tätigkeiten mitbestimmungspflichtig, da sich solche Übertragungen günstig auf die Aufstiegschancen der Betroffenen auswirken können.[76] Allerdings gilt dies nur dann, wenn es sich bei der Übertragung um eine außerordentliche Maßnahme und nicht um die Befolgung des bereits bestehenden Vertretungsplans handelt[77] und wenn damit eine Änderung der Lohn- oder Vergütungsgruppe verbunden wäre.[78]
Strittig ist, ob die vorübergehende Übertragung höher bewerteter Tätigkeiten bei Beamten der Mitbestimmung des Personalrats unterliegt.[79] Zwar handelt es sich bei solchen Übertragungen aufgrund ihrer fehlenden Dauerhaftigkeit nicht um Maßnahmen, die automatisch eine Beförderung nach sich ziehen. Aber auch bei Beamten kann die vorübergehende Übertragung höher bewerteter Tätigkeiten die Chancen auf eine höherwertige Stelle erhöhen. Außerdem geht der Gesetzgeber des LPVG davon aus, dass das BPersVG die vorübergehende Übertragung höherwertiger Tätigkeiten gezielt nicht von der Mitbestimmung ausschließt.[80] Infolgedessen sind sämtliche beabsichtigten Übertragungen höherwertiger Tätigkeiten unabhängig von ihrer Dauer dem Personalrat zur Mitbestimmung vorzulegen.
Die Übertragung niedriger bewerteter Tätigkeiten ist sowohl bei vorübergehenden als auch bei dauerhaften Maßnahmen bei allen Beschäftigten der Mitbestimmung des Personalrats zu unterwerfen.[81] Dies gilt bei Tariflich Beschäftigten allerdings nur, wenn aus einer dauerhaften Übertragung eine Herabgruppierung erwachsen könnte.[82]
3.1.12 Bestimmung der Fallgruppe oder des Abschnitts innerhalb einer Vergütungs- oder Lohngruppe
Die Bestimmung der Fallgruppe oder des Abschnitts innerhalb einer Vergütungs- oder Lohngruppe unterliegt aufgrund der Streichung dieses Tatbestandes aus § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LPVG a. F. nicht mehr der Mitbestimmung durch den Personalrat. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch die Bestimmung der Fallgruppe im Rahmen der Eingruppierung, Höher- oder Herabgruppierung jedenfalls dann nach § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LPVG mitbestimmungspflichtig wäre, wenn sich hieraus Konsequenzen hinsichtlich eines Bewährungsaufstiegs ergäben.[83] Dieser Fall ist jedoch unwahrscheinlich, denn der Grund für die Streichung dieses Tatbestandes liegt in der zu erwartenden Abschaffung der Fallgruppen und dem damit verbundenen Bewährungsaufstieg nach der noch nicht abschließend verhandelten tarifrechtlichen Entgeltordnung.[84] Bereits jetzt ist ein Bewährungsaufstieg nur noch in besonderen Ausnahmefällen vorgesehen.[85]
3.1.13 Wesentliche Änderungen des Arbeitsvertrages
Der Gesetzgeber hat ursprünglich die Mitbestimmung bei wesentlichen Änderungen des Arbeitsvertrages zugunsten der Stärkung der Vertragsfreiheit streichen wollen.[86] In der Beschlussempfehlung und im Bericht des Innenausschusses zum Gesetzentwurf wurde dieser Mitbestimmungstatbestand aus § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LPVG a. F. in die Mitwirkung nach § 73 Nr. 2 LPVG überführt.[87]
3.1.14 Umsetzung innerhalb der Dienststelle ohne Dienstortwechsel
3.1.14.1 Änderung und Begründung
Waren bisher lediglich Umsetzungen innerhalb der Dienststelle ohne Dienstortwechsel für eine Dauer von bis zu drei Monaten gem. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 LPVG a. F. mitbestimmungsfrei, so soll nun die generelle Streichung der Mitbestimmung des Personalrats bei Umsetzungen innerhalb der Dienststelle ohne Dienstortwechsel die Position der Dienststellenleitung stärken. Eine Beteiligung wird dem Personalrat in diesen Angelegenheiten weder im BPersVG noch in sämtlichen Personalvertretungsgesetzen der Länder mit Ausnahme der Länder Brandenburg und Niedersachsen eingeräumt. Aus der Sicht des Gesetzgebers ist ein Schutzbedürfnis für die Beschäftigten nur noch dann gegeben, wenn mit der Umsetzung ein Wechsel des Dienstortes erfolgt.[88]
3.1.14.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
Sofern mit der Umsetzung die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, eine Beförderung, ein Laufbahnwechsel, eine Höhergruppierung, eine Herabgruppierung oder ein Wechsel des Dienstortes verbunden ist, greifen bereits die Mitbestimmungstatbestände aus § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 5 LPVG. Die Mitbestimmung bei der Umsetzung ohne Dienstortwechsel umfasste darüber hinaus insbesondere den dauerhaften Wechsel von Beschäftigten auf gleichwertige Stellen. Kurzfristige Maßnahmen bis zu drei Monaten waren jedoch mitbestimmungsfrei. Folglich fielen nahezu alle Umsetzungsfälle unter die Mitbestimmung der Personalvertretung, wobei fast alle Umsetzungsmaßnahmen einvernehmlich mit dem Personalrat beschlossen wurden.
Insbesondere beim überhängigen Einsatz von Mitarbeitern, die keine feste Stelle innehatten, gab es bisher nur selten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Personalrat und der Dienststelle. Dies gilt sowohl für kurze Einsätze, die dem Personalrat im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit mitgeteilt worden sind, als auch für über einen Zeitraum von drei Monaten hinausgehende und damit mitbestimmungspflichtige Einsätze.
Sofern jedoch überhängige Mitarbeiter – auch gegen ihren Willen – auf feste Stellen umgesetzt werden sollten, ergaben sich beim Personalrat häufiger Bedenken. Unter Hinweis auf die DV Ausschreibung wurden diese Stellen daher fast immer ausgeschrieben, so dass sie nur manchmal mit den von der Dienststelle jeweils vorgesehenen Beschäftigten besetzt werden konnten. Zudem ergaben sich bei der erfolgreichen Bewerbung anderer Kandidaten i. d. R. keine für die überhängigen Kräfte alternativ frei werdenden gleichwertigen Stellen, da diese Bewerber meistens eine geringwertigere Stelle besetzten. Aus Sicht der Dienststelle führte dies zu der unbefriedigenden Situation, dass die betroffenen Kräfte weiter auf ihren bisherigen oder anderen überhängigen Stellen beschäftigt worden sind, so dass die Anzahl dieser Stellen langsamer als angestrebt abgebaut werden konnte.[89]
Im Ergebnis entspricht dies der Situation beim Einsatz von Beschäftigten, die nach Beendigung des Wehr- oder Zivildienstes, der Elternzeit oder des unbezahlten Urlaubs ihre Tätigkeit wieder aufnehmen wollen.[90]
3.1.14.3 Empfehlung
Ziel des Gesetzgebers ist es, Umsetzungen ohne Dienstortwechsel ohne Zustimmung des Personalrats vornehmen zu können. Wie bereits beschrieben[91], spricht jedoch nach wie vor die Mitwirkung des Personalrats bei Stellenausschreibungen grundsätzlich gegen die uneingeschränkte Personalhoheit des Dienststellenleiters. Die Personalvertretung kann folglich Einwendungen erheben, wenn die Dienststelle eine Stelle nicht ausschreiben möchte, weil sie z. B. mit einem überhängigen Mitarbeiter besetzt werden soll.
Darüber hinaus hat sich die Dienststelle nach § 1 Satz 1 der DV Ausschreibung verpflichtet, grundsätzlich alle frei gewordenen oder neuen Stellen auszuschreiben und den Verzicht hierauf gem. § 2 Satz 2 der DV Ausschreibung mit dem Personalrat im Einzelfall abzusprechen. Die Personalvertretung wird dadurch in die Lage versetzt, bei der Entscheidung des Verzichts auf eine Ausschreibung einer Stelle mitzubestimmen. Wie bereits dargestellt[92], handelt es sich hierbei um eine unzulässige Ausweitung der im LPVG abschließend geregelten Beteiligungsrechte[93] und somit um eine gem. § 4 LPVG nicht gerechtfertigte abweichende Regelung des Personalvertretungsrechts durch Dienstvereinbarung[94], so dass § 2 Satz 2 der DV Ausschreibung unwirksam ist.[95]
Um die rechtliche Situation hinsichtlich des Mitwirkungsrechts des Personalrats bei Ausschreibungen zu verdeutlichen, sollte in Ergänzung zum vorherigen Vorschlag[96] § 2 Satz 2 der DV Ausschreibung folgenden Wortlaut erhalten:
„Die Dienststelle behält sich vor, freiwerdende oder neu geschaffene Stellen ohne Ausschreibungsverfahren mit überhängigen Kräften oder mit Beamten bzw. Tariflich Beschäftigten zu besetzen, die gem. Arbeitsplatzsicherungsvorschriften oder nach Ablauf eines Urlaubs ohne Dienstbezüge gem. § 78 b oder § 85 a LBG oder nach entsprechenden Regelungen für Tariflich Beschäftigte einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung haben. Dies gilt jedoch nur dann, wenn mit der Maßnahme keine Umsetzung mit Dienstortwechsel i. S. d. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 LPVG und keine Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit gem. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LPVG verbunden ist. Der Personalrat wirkt bei der Entscheidung, eine freiwerdende oder neu geschaffene Stelle nicht auszuschreiben, nach Maßgabe des § 73 Nr. 2 LPVG mit.“
3.1.15 Umsetzung innerhalb der Dienststelle mit Dienstortwechsel
3.1.15.1 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
Die Mitbestimmung des Personalrats bei Umsetzungen innerhalb der Dienststelle, die mit einem Wechsel des Dienstortes verbunden ist, hatte für den Märkischen Kreis aufgrund der bereits beschriebenen weiteren Mitbestimmungsrechte des Personalrats[97] bei der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, der Beförderung, dem Laufbahnwechsel, der Höhergruppierung, der Herabgruppierung oder bei einer Umsetzung für eine Dauer von mehr als drei Monaten (s. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 5 LPVG a. F.) praktisch kaum eine Bedeutung, da mit diesen Tatbeständen nahezu alle denkbaren Umsetzungsfälle abgedeckt waren. Lediglich eine Umsetzung für eine Dauer von bis zu drei Monaten an einen anderen Dienstort wäre einzig und allein von dem hier betrachteten Mitbestimmungstatbestand aufgefangen worden. Dieser Umsetzungsfall ist in der Praxis beim Märkischen Kreis – wenn überhaupt – nur äußerst selten vorgekommen.
Durch den Wegfall der für nahezu alle Fälle geltenden Mitbestimmung des Personalrats bei allen dauerhaften Umsetzungen innerhalb der Dienststelle ohne Dienstortwechsel[98] gewinnt der Mitbestimmungstatbestand der Umsetzung mit Dienstortwechsel insbesondere für den Märkischen Kreis mit seinen verschiedenen Dienstorten enorm an Bedeutung.
3.1.15.2 Empfehlung
Nach dem Wortlaut des § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 LPVG ist eine Umsetzung dann mitbestimmungspflichtig, wenn sie innerhalb der Dienststelle erfolgt und mit einem Wechsel des Dienstortes verbunden ist, wobei das Einzugsgebiet im Sinne des Umzugskostenrechts zum Dienstort gehört.
Das Einzugsgebiet wird nach dem nordrhein-westfälischen Umzugskostenrecht gem. § 1 Abs. 1 LUKG i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 lit. c BUKG bestimmt. Danach wäre eine Umzugskostenvergütung nicht zuzusagen, wenn die Wohnung auf einer üblicherweise befahrenen Strecke weniger als 30 Kilometer von der neuen Dienststätte entfernt ist oder im neuen Dienstort liegt.[99]
Die konkrete Formulierung des § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 LPVG wirft allerdings die Frage auf, wie die Berechnung des Einzugsgebiets zu erfolgen hat.
Die Berechnung des Einzugsgebiets könnte sich einerseits auf den alten und neuen Dienstort beziehen, wobei entweder die konkreten Adressen der Dienstgebäude oder die Gemeindegrenze des bisherigen Dienstortes und die Adresse des neuen Dienstortes maßgeblich sein können.
Andererseits wäre es auch möglich, bei der Berechnung des Einzugsgebiets den neuen Dienstort und die Wohnung des Beschäftigten heranzuziehen, wobei wiederum offen wäre, ob die konkreten Adressen oder die Gemeindegrenze des neuen Dienstortes und die Adresse des Beschäftigten maßgeblich sind.
Die Literatur geht seit Einführung der entsprechenden Regelung in das BPersVG im Jahre 1974 überwiegend davon aus, dass zu prüfen ist, ob der neue Dienstort innerhalb des Einzugsgebiets des bisherigen Dienstorts liegt.[100] Dies hätte für den Märkischen Kreis zur Folge, dass die Dienstgebäude in Lüdenscheid, Altena und Iserlohn alle im jeweiligen Einzugsgebiet einer dieser bisherigen Dienstorte liegen würden, und zwar unabhängig davon, ob auf die Gemeindegrenze oder die Adresse des bisherigen Dienstortes abgestellt würde.[101] Unklar ist die mit der erstmaligen Einführung der betroffenen Regelung im BPersVG verbundene Absicht des Gesetzgebers.[102] Die Rechtsprechung wiederum gibt vor, dass die Wohnung des Beschäftigten für die Berechnung des Dienstortes maßgeblich ist.[103]
Insofern kann nur nach allgemeinen Gesichtspunkten untersucht werden, wie die Berechnung des Einzugsgebiets vorgenommen werden sollte.
Die Auslegung des Wortlauts des § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 LPVG führt zu keinem Ergebnis, da sowohl das Einzugsgebiet des alten als auch des neuen Dienstortes gemeint sein könnte.
Aus praktischen Erwägungen heraus wäre es durchaus denkbar, die Entfernung zwischen den einzelnen Dienstorten, beim Märkischen Kreis insbesondere der Städte Lüdenscheid, Altena und Iserlohn mit dem weitaus größten Anteil der Beschäftigten, zu Grunde zu legen. Die einmalige Festsetzung der Entfernung würde eine jeweilige Einzelfallprüfung bei beabsichtigten Maßnahmen entbehrlich machen. Zudem ist zumindest den Beschäftigten, die seit der Gebietsreform zu Beginn des Jahres 1975[104] zum Märkischen Kreis gekommen sind, bekannt, dass mehrere Dienstorte existieren und ein Wechsel jederzeit möglich ist. Spätestens durch den Abschluss der Arbeitsverträge wird zumindest den Tariflich Beschäftigten bekannt gegeben, dass ein Einsatz an einem anderen Dienstort möglich ist. Dies gilt insbesondere für organisatorische Änderungen, wonach einzelne Fachdienste oder Teile von ihnen ihren Standort ändern. Hierbei würde es sich jedoch nicht um Umsetzungen handeln, so dass dem Personalrat allenfalls ein Mitwirkungsrecht nach § 73 Nr. 3 LPVG zusteht.[105]
Für dieses Bewusstsein der Beschäftigten spricht auch, dass derzeit ohnehin nicht alle Beschäftigten am jeweiligen Dienstort wohnen und entsprechende Anfahrtswege, die z. T. länger als 30 Kilometer sind, in Kauf nehmen. Zudem liegt auf der Hand, dass von den Beschäftigten aufgrund der Stellen- und damit verbundenen Personaleinsparungen der letzten Jahre[106] mehr Flexibilität verlangt werden muss, um die gesetzlichen Aufgaben des Märkischen Kreises erfüllen zu können. Insofern erscheint es zumutbar, Beschäftigte ohne Zustimmung des Personalrats an einen Dienstort umzusetzen, der nicht weiter als 30 Kilometer vom bisherigen Dienstort entfernt liegt.
Unter dem Aspekt der Gleichbehandlung aller Beschäftigten ist es jedoch angezeigt, die Berechnung des Einzugsgebiets auf den neuen Dienstort und die Wohnung des Betroffenen zu beziehen, denn mit diesem Mitbestimmungsrecht möchte der Gesetzgeber den Beschäftigten vor einer besonderen Härte schützen. Zwar hätte dies zur Folge, dass bei den Beschäftigten, die durch eine Umsetzung nun einen kürzeren, aber immer noch über 30 Kilometer langen Weg zum neuen Dienstort haben, die Zustimmung des Personalrats zu dieser Maßnahme erfolgen müsste. Allerdings wäre in einem solchen Fall eine soziale Härte nicht erkennbar, so dass sich die Verweigerung der Zustimmung durch den Personalrat nicht auf diesen Aspekt stützen könnte.[107]
Der Verweis des Gesetzgebers auf das Umzugskostenrecht lässt ebenfalls den Schluss zu, dass für die Berechnung des Einzugsgebiets die Entfernung der Wohnung des Beschäftigten bis zum neuen Dienstort gemeint ist, da § 1 Abs. 1 LUKG i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 lit. c BUKG eindeutig diese Tatbestände aufweist.
Schließlich ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber durch die Aufnahme von Vorschriften, die die Gleichberechtigung der Beschäftigten sicherstellen sollen (vgl. §§ 62 oder 66 Abs. 3 Nr. 2 LPVG), verdeutlichen will, dass jeder Fall gesondert zu betrachten ist und individuelle Gegebenheiten in den Entscheidungsprozess mit einfließen sollen.[108]
Infolgedessen ist im Einzelfall bei der Berechnung des Einzugsgebiets stets auf die Wohnung des Beschäftigten abzustellen.
Durch den Hinweis auf das Umzugskostenrecht in § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 LPVG ist es erforderlich, hinsichtlich der Frage, ob die Gemeindegrenze des Dienstortes oder die konkrete Adresse des Dienstgebäudes für die Berechnung des Einzugsgebiets maßgeblich ist, ebenfalls die Vorschriften des § 1 Abs. 1 LUKG i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 lit. c BUKG heranzuziehen.
Weder der Gesetzestext noch die VVzLUKG oder die BUKGVwV geben einen Hinweis darauf, dass die Berechnung ab der Gemeindegrenze des neuen Dienstortes erfolgen soll. Genannt werden nach Ziff. 3.1.4 Satz 4 VVzLUKG und BUKGVwV lediglich die Entfernungen zwischen Wohnung und Dienststätte. Nach wörtlicher Auslegung sind also die jeweiligen Adressen maßgeblich.
Auch die Literatur zum Umzugskostenrecht geht davon aus, dass die konkrete Lage des Dienstgebäudes und der Wohnung des Beschäftigten Grundlage für die Berechnung des Einzugsgebiets ist.[109] Für andere – insbesondere ältere – Auffassungen[110] liegen keine rechtlich aktuellen Anhaltspunkte vor.
Zusammenfassend sind für die Berechnung des Einzugsgebietes daher die konkreten Adressen des Beschäftigten und des Dienstgebäudes maßgeblich.
3.1.16 Abordnung und Zuweisung von Beamten für eine Dauer von mehr als drei Monaten und ihre Aufhebung
Mit der zukünftigen Ablösung des BRRG durch das BeamtStG muss der entsprechende Verweis in § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 LPVG angepasst werden. Der jetzige Verweis auf ein noch nicht verabschiedetes Gesetz wirft möglicherweise verfassungsrechtliche Fragen auf, die im Rahmen dieser Arbeit jedoch außer Acht gelassen werden.
Der Gesetzgeber hat den Sinn und Zweck dieser Vorschrift nicht ändern wollen[111], so dass sich hier kein Handlungsbedarf ergibt.
3.1.17 Zuweisung von Arbeitnehmern gem. tarifrechtlicher Vorschriften für eine Dauer von mehr als drei Monaten und ihre Aufhebung
Durch die neue Formulierung des § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 LPVG könnte der Eindruck entstanden sein, dass bisher die Abordnung und Zuweisung und seit der Novellierung nur noch die Zuweisung von Tariflich Beschäftigten nach entsprechenden tariflichen Vorschriften einer Mitbestimmung des Personalrats erfordert. Im Gegensatz zum bisherigen § 12 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 BAT ist nunmehr in den Protokollnotizen zu § 4 Abs. 1 und 2 TVöD eindeutig geregelt, dass es drei Arten von Zuweisungen bei Tariflich Beschäftigten gibt. Es handelt sich hierbei um die Versetzung (vgl. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 LPVG), die Abordnung und die Zuweisung im engeren Sinne. Damit hat sich in Bezug auf die Mitbestimmungstatbestände inhaltlich nichts geändert.
3.1.18 Kürzung der Anwärterbezüge oder der Unterhaltsbeihilfe
Die Streichung der Mitbestimmung des Personalrats bei der durch den § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 LPVG a. F. erfassten Kürzung der Anwärterbezüge oder der Unterhaltsbeihilfe betont den Beurteilungsspielraum des Dienstherrn gegenüber den in der Ausbildung befindlichen Beamten bzw. Juristen.[112] Auf die Juristenausbildung wird hier nicht weiter eingegangen, da der Märkische Kreis keine Juristen ausbildet.
Die oberste Dienstbehörde – beim Märkischen Kreis nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBG i. V. m. § 42 lit. e KrO der Landrat – kann den Anwärterbetrag unter den Voraussetzungen des § 66 BBesG herabsetzen, wenn der Anwärter die vorgeschriebene Laufbahnprüfung nicht bestanden hat oder sich die Ausbildung aus einem vom Anwärter zu vertretenden Grunde verzögert.
Die Kürzung der Anwärterbezüge hat insbesondere beim Nichtbestehen der Laufbahnprüfung keinerlei Folgen auf das eigentliche Ausbildungsverhältnis. Denn die Wiederholung der Prüfung ist auf jeden Fall – beispielsweise im gehobenen Dienst unter den Voraussetzungen des § 27 VAPgD – möglich. Insofern handelt es sich bei der Bezügekürzung in einem solchen Fall zum einen um eine Maßnahme der Kostenreduzierung im Bereich der Ausbildungskosten, zum anderen aber auch um ein deutliches Signal an den betroffenen Beamten im Vorbereitungsdienst. Er soll wissen, dass er sich verbessern muss, wenn er die Prüfung bestehen und beim Märkischen Kreis im Anschluss an die Ausbildung eingestellt werden will. In diesem Zusammenhang sei nochmals darauf hingewiesen, dass durch die bedarfsgerechte Ausbildung eine Einstellung beim Märkischen Kreis garantiert wird, so dass beispielsweise ein Anreiz, sich gegen Konkurrenz durchsetzen zu müssen, als Alternative zu einer Kürzung der Bezüge nicht gegeben ist.
Der Personalrat kann allenfalls im Rahmen seiner allgemeinen Aufgaben gem. § 64 Nr. 2 LPVG darüber wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Regelungen durchgeführt werden. Er hätte zur Wahrnehmung dieser Aufgaben grundsätzlich einen Unterrichtungsanspruch nach § 65 Abs. 1 LPVG.[113] Dieses Überwachungsrecht wird aufgrund des Schutzes personenbezogener Daten durch § 65 Abs. 3 Satz 1 LPVG eingeschränkt, da die Entscheidung über die Kürzung der Anwärterbezüge in die Personalakte des Beamten aufgenommen wird und ein Einblick in diese Akte nur mit Zustimmung des Betroffenen erfolgen darf.[114]
Aus diesem Grunde kann eine Information über die Kürzung der Anwärterbezüge an die Personalvertretung unter keinen Umständen automatisch erfolgen. Wenn allerdings der Beamte die Weitergabe dieser Informationen an den Personalrat wünscht oder er sich dort über die Kürzung seiner Bezüge beschwert, kann die Personalvertretung gem. § 64 Nr. 2 LPVG ihre Überwachungsaufgabe wahrnehmen bzw. gem. § 64 Nr. 5 LPVG eine vollständige Unterrichtung verlangen und ihre eventuelle vorhandenen Bedenken vortragen.[115]
3.1.19 Entlassung eines Beamten auf Probe oder auf Widerruf oder Entlassung aus einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis, wenn der Beschäftigte die Maßnahme nicht selbst beantragt hat
Die Mitbestimmung des Personalrats gem. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 i. V. m. Satz 3 LPVG a. F. bei der Entlassung von Beamten auf Widerruf oder auf Probe gem. § 5 Abs. 1 Nr. 3 und 4 LBG ist in eine Mitwirkung gem. § 74 Abs. 3 LPVG umgewandelt worden. Der Märkische Kreis bildet keine Beschäftigten im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis – z. B. Referendare[116] oder Beschäftigte, denen der Zugang zum mittleren feuerwehrtechnischen Dienst ermöglicht werden soll[117] – aus, so dass dieser Teil der Vorschrift nicht weiter beachtet wird.
Als Begründung für die Schwächung der Rechte des Personalrats führt der Gesetzgeber an, dass die Entlassung der betroffenen Beschäftigten bereits stark reglementiert ist und kaum ein Entscheidungsspielraum besteht.[118]
3.1.20 Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, wenn der Beamte die Maßnahme nicht selbst beantragt hat
Unter geringer sprachlicher Änderung ist die Mitbestimmung des Personalrats bei der vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand gem. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 i. V. m. Satz 3 LPVG a. F. durch eine Mitwirkung gem. § 74 Abs. 3 LPVG ersetzt worden. Aufgrund detaillierter Vorschriften ist der Entscheidungsspielraum aus Sicht des Gesetzgebers stark eingegrenzt.[119]
3.1.21 Feststellung der begrenzten Dienstfähigkeit, wenn der Beamte die Maßnahme nicht selbst beantragt hat
Die Feststellung der begrenzten Dienstfähigkeit unterliegt nicht mehr der Mitbestimmung des Personalrats, da § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 i. V. m. Satz 3 LPVG a. F. gestrichen worden ist. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass der Ermessensspielraum des Dienstherrn ohnehin sehr begrenzt und damit ebenso der Handlungsspielraum bei der Mitbestimmung eher gering ist.[120]
Der Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Entscheidung über das Vorliegen einer begrenzten Dienstfähigkeit ergibt sich aus den maßgeblichen §§ 45a Abs. 1 Satz 3 i. V. m. 46 f. LBG. Dabei liefert das amtsärztliche Gutachten gem. § 47 Abs. 1 Satz 1 LBG die wesentlichen Anhaltspunkte für diese Entscheidung.
Aufgrund der Tatsache, dass persönliche Rechte der Beschäftigten gegenüber den Informationsrechten der Personalvertretung zur Erfüllung ihrer allgemeinen Aufgaben zu schützen sind[121], kann die Dienststelle keine Informationen über den Sachverhalt an den Personalrat weiterleiten. Es wird in der Praxis darauf ankommen, ob sich der Beamte gegen die Feststellung der begrenzten Dienstfähigkeit zur Wehr setzen oder unabhängig davon entsprechende Informationen an den Personalrat aufgrund dessen Überwachungsfunktion weitergeben möchte. Sollte er mit der Entscheidung der Dienststelle nicht einverstanden sein, wird er sich neben der Wahrnehmung seiner individuellen Rechte (vgl. § 47 Abs. 2 f. LBG) vermutlich beim Personalrat nach § 64 Nr. 5 LPVG über diese Maßnahme beschweren und ihm die Einsicht in seine Personalakte gem. § 65 Abs. 3 Satz 1 LPVG ermöglichen.
3.1.22 Weiterbeschäftigung von Arbeitnehmern über die Altersgrenze hinaus
Die Begriffe Angestellte und Arbeiter in § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 LPVG a. F. – jetzt § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 LPVG – sind beim Mitbestimmungstatbestand hinsichtlich der Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus durch das Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt worden, da der Tarifvertrag gem. § 1 Abs. 1 TVÖD die Unterscheidung von Angestellten und Arbeitnehmern aufgegeben hat.[122] Inhaltlich hat sich hierdurch nichts geändert.
3.1.23 Untersagung einer Nebentätigkeit
Bisher bestand gem. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 LPVG a. F. nur eine Mitbestimmung des Personalrats bei der Versagung einer Nebentätigkeit. Der Begriff „Versagung“ stammt aus dem Beamtenrecht (§ 68 Abs. 2 Satz 1 LBG), auf welches der nun nicht mehr geltende § 11 Satz 1 BAT verwiesen hat. Nach § 3 Abs. 3 Satz 2 TVöD wird stattdessen der Begriff der Untersagung einer Nebentätigkeit verwandt, weshalb das LPVG entsprechend angepasst werden musste, um den ursprünglichen inhaltlichen Zustand wieder herzustellen.[123]
3.1.24 Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub ohne Fortzahlung der Vergütung mit entsprechender Arbeitsvertragsänderung bei Tariflich Beschäftigten
3.1.24.1 Änderung und Begründung
Auch wenn in den Landespersonalvertretungsgesetzen in Bremen und Schleswig-Holstein dieser Mitbestimmungstatbestand nicht konkret genannt wird, so werden mit Ausnahme des Bundes und des Landes Berlin überall Beamte und Tariflich Beschäftigte[124] hinsichtlich der Mitbestimmung des Personalrats bei Ablehnungen von Anträgen auf Teilzeitbeschäftigung oder unbezahlten Urlaub gleichgestellt. Der Gesetzgeber verweist zur Begründung der Streichung der bisher in § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 LPVG a. F. geregelten Mitbestimmung in den Fällen einer Ablehnung entsprechender Anträge von Tariflich Beschäftigten lediglich auf das in dieser Hinsicht eine Ausnahme bildende BPersVG, ohne weitere konkrete Gründe zu benennen.[125]
3.1.24.2 Bisherige Situation beim Märkischen Kreis
Anträge auf Teilzeitbeschäftigungen sind beim Märkischen Kreis sehr häufig bewilligt worden, auch wenn aus dienstlichen Gründen z. T. Korrekturen hinsichtlich der abzuleistenden Stundenzahl oder des Arbeitszeitmodells vorgenommen worden sind. Differenzen zwischen dem Personalrat und der Dienststelle waren bisher sehr selten.
Noch weniger Probleme hat die Gewährung von Urlaub ohne Fortzahlung der Vergütung bzw. des Entgelts bereitet, da die Anträge meist aus familiären Gründen für die Zeit im Anschluss an die bereits gewährte Elternzeit gestellt worden sind.
3.1.24.3 Empfehlung
Sämtliche Anträge auf Teilzeitbeschäftigung von Tariflich Beschäftigten ziehen bei einer Genehmigung durch die Dienststelle eine Arbeitsvertragsänderung nach sich. Ist diese Änderung wesentlich, steht dem Personalrat nach § 73 Nr. 2 LPVG ein Mitwirkungsrecht zu. Bei der Gewährung von Sonderurlaub im Sinne des § 28 TVöD ruht das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen. Auch hier dürfte es sich um eine wesentliche Änderung des Arbeitsvertrages i. S. d. § 73 Nr. 2 LPVG handeln, da sämtliche gegenseitige Ansprüche des Arbeitnehmers und Arbeitgebers für einen bestimmten Zeitraum nicht zur Geltung kommen.[126]
Das Mitwirkungsrecht aus § 73 Nr. 2 LPVG kommt jedoch nur dann zum Tragen, wenn dem jeweiligen Antrag des Tariflich Beschäftigten stattgegeben wird. Ist die Ablehnung des Antrags beabsichtigt, ändert sich auch nicht der Arbeitsvertrag, so dass kein Beteiligungsrecht mehr besteht. Aus diesem Grunde kann § 73 Nr. 2 LPVG vorliegend nicht als Auffangtatbestand dienen.
Die analoge Anwendung des für Beamte geltenden § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 LPVG n. F. scheidet aufgrund der bewussten Streichung der Regelung für Tariflich Beschäftigte aus.[127]
Ein Mitbestimmungsrecht steht dem Personalrat allerdings bei Maßnahmen, die nach § 72 Abs. 4 Satz 1 Nr. 18 LPVG der Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern dienen, zu. Es stellt sich daher die Frage, ob von dieser Vorschrift auch Anträge auf Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung zumindest aus familiären Gründen i. S. d. § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 LPVG a. F. bei Tariflich Beschäftigten erfasst werden.
Bei der Einführung der entsprechenden Regelung in das BPersVG (§ 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10) durch das Zweite Gleichberechtigungsgesetz hat der Gesetzgeber beabsichtigt, „Maßnahmen zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung der Geschlechter“[128] in den Mitbestimmungskatalog aufzunehmen. Es ist mangels weiterer Erläuterung davon auszugehen, dass sich das Land Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf die Novellierung des LPVG dieser Begründung anschließen möchte.
Neben weiteren gesetzlichen Regelungen ist in Nordrhein-Westfalen insbesondere das LGG maßgeblich für die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung der Geschlechter. Nach § 1 Abs. 1 Sätze 1 und 3 LGG dient das Gesetz der Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und hat darüber hinaus das Ziel, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Anträgen von Beschäftigten auf Beurlaubung oder auf Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit bis auf die Hälfte zur tatsächlichen Betreuung oder Pflege mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen ist gem. § 13 Abs. 3 Satz 1 und § 14 Abs. 1 Satz 1 LGG zu entsprechen, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Es handelt sich bei diesen Vorschriften – im Gegensatz zum Abschnitt II mit den dort enthaltenen Maßnahmen zur Frauenförderung nach den §§ 5 bis 12 LGG – jedoch ausdrücklich um Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie i. S. d. Abschnitts III des LGG unabhängig vom Geschlecht der Beschäftigten.
Aus diesem Grunde fallen Ablehnungen von Anträgen Tariflich Beschäftigter auf Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung nicht unter den neuen Mitbestimmungstatbestand des § 72 Abs. 4 Satz 1 Nr. 18 LPVG.[129] Dies gilt erst recht für Anträge auf Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung aus Gründen, die sich nicht aus der familiären Situation ergeben.
Hinsichtlich der Anträge auf unbezahlten Urlaub kommt noch die Anwendung des § 72 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 LPVG in Betracht, wonach die Aufstellung des Urlaubsplans mitbestimmungspflichtig ist. Gemeint ist hier jedoch lediglich die Festsetzung der zeitlichen Lage der geplanten Urlaube der Beschäftigten und nicht die konkrete Entscheidung über die Urlaubsgewährung selbst.[130]
[...]
[1] Vgl. Edenfeld, Rn. 1.
[2] Vgl. Urteil des BVerfG, BVerfGE 28, S. 314 (323).
[3] Vgl. Edenfeld, Rn. 1; Becker, S. 424.
[4] Vgl. Kübler, S. 18; Steiner, S. 393.
[5] Vgl. Becker, S. 314; Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 1.
[6] Vgl. GVBl NRW, 61. Jg., S. 394 bis 404.
[7] Vgl. Pressemitteilung des Landtags NRW vom 08.08.2007 unter http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/P/Presse/Oeffentlichkeitstsarbeit /Informationen.jsp?oid=84219, vgl. Anhang 1, S. 1; Artikel der Westdeutschen Zeitung vom 20.09.2007 unter http://www.wz-newsline.de/index.php?redid=175958, vgl. Anhang 2.
[8] Vgl. Pressemitteilung des Innenministeriums NRW vom 31.10.2006 unter http://www.nrw.de/ Presseservice/archive/presse2006/10_2006/061031IM.php, vgl. Anhang 3, S. 1; Pressemitteilung des Innenministeriums NRW vom 28.02.2007 unter http://www.presseservice.nrw.de/
presse2007/02_2007/070228IM1.php, vgl. Anhang 4, S. 1; Pressemitteilung des Landtags NRW vom 08.08.2007 unter http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/P/Presse/
Oeffentlichkeitstsarbeit /Informationen.jsp?oid=84219, vgl. Anhang 1, S. 1; Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 41.
[9] Vgl. Stellungnahmen zur Anhörung zum LPVG durch den Innenausschuss sowie den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags NRW am 08.08.2007 vom dbb nrw und tarifunion NRW, S. 1 bis 3, S. 14 bis 18 und S. 27 f., vgl. Anhang 5, von der komba gewerkschaft nrw, S. 1 f. und S. 13 bis 17, vgl. Anhang 6, sowie vom Deutschen Gewerkschaftsbund Bezirk NRW, S. 1 f. und S. 8 bis 15, vgl. Anhang 7, S. 2 bis 11.
[10] Ohne Kreispolizeibehörde.
[11] Vgl. Cecior u. a., § 8, Rn. 11; Havers, § 8, Erl. 5.1 f.; Ilbertz/Widmaier, § 7, Rn. 4; Altvater/Peiseler, § 7, Rn. 1.
[12] Vgl. Formulierung des § 49 Abs. 1 Satz 2 KrO (dienst- und arbeitsrechtliche Entscheidungen).
[13] Vgl. Cecior u. a., § 66, Rn. 11; Havers, § 66, Erl. 1.1; Welkoborsky, § 72, Rn. 1; Ilbertz/Widmaier, vor § 66, Rn. 5; Wichmann/Langer, Rn. 650; Müller, S. 276 und 292; Becker, S. 29; Kübler, S. 96.
[14] Vgl. Cecior u. a., § 66, Rn. 22; Ilbertz/Widmaier, vor § 66, Rn. 5; Altvater/Peiseler, § 69, Rn. 1; (a. A. Havers, § 66, Erl. 2.1).
[15] Vgl. Anhang 8, S. 2.
[16] Vgl. Cecior u. a., § 68, Rn. 9; Havers, § 68, Erl. 3; Welkoborsky, § 68, Rn. 2.
[17] Vgl. Beschluss des BVerfG, ZBR 1996, S. 15 bis 20.
[18] Zur Problematik vgl. Ilbertz/Widmaier, § 104, Rn. 2; Altvater/Peiseler, § 104, Rn. 2 bis 4.
[19] Vgl. Cecior u. a., § 69, Rn. 11; Havers, § 69, Erl. 2 und 5; Welkoborsky, § 73, Rn. 1; Ilbertz/Widmaier, vor § 66, Rn. 6; Altvater/Peiseler, § 72, Rn. 1; Müller, S. 292; Becker, S. 30.
[20] Vgl. Kapitel 2.4.1.
[21] Vgl. Cecior u. a., § 75, Rn. 3; Havers, § 75, Erl. 7 f.; Welkoborsky, § 75, Rn. 1; Ilbertz/Widmaier, vor § 66, Rn. 7; Altvater/Peiseler, § 78, Rn. 1b; Pfohl, Rn. 598; Müller, S. 366; Kübler, S. 96.
[22] Vgl. z. B. Cecior u. a., § 64, Rn. 6; Welkoborsky, § 64, Rn. 1; Havers, § 64, Erl. 2; Ilbertz/Widmaier, vor § 66, Rn. 7; Altvater/Peiseler, § 81, Rn. 1; Müller, S. 274 bis 276.
[23] Vgl. Veröffentlichung des Märkischen Kreises unter http://www.maerkischer-kreis.de/
buergerservice/infosystem/berichte/dfz07.pdf, vgl. Anhang 9, S. 2.
[24] Vgl. Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes unter https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/
dWerteabruf_Page;jsessionid=D48005179DA3D96A0F19D2DB9F2A6390.tc4, vgl. Anhang 10.
[25] Vgl. Personal- und IT-Bericht des Märkischen Kreises 2006, Teil A, S. 10 und 25, vgl. Anhang 11, S. 2 und 4.
[26] Vgl. Personal- und IT-Bericht des Märkischen Kreises 2006, Teil B, S. 2 f., vgl. Anhang 11, S. 5 f.
[27] Vgl. § 37 Abs. 3 des Gesetzes zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes Sauerland / Paderborn (Sauerland / Paderborngesetz) vom 05.11.1974 (GVBl NRW, 28. Jg., S. 1224 bis 1234), vgl. Anhang 12, S. 2; § 1 Abs. 2 der Hauptsatzung des Märkischen Kreises, vgl. Anhang 8, S. 1.
[28] Vgl. Veröffentlichung des KAV unter http://www.kav-nw.de/kav/verband/wuu.shtml, vgl. Anhang 13.
[29] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 59.
[30] Vgl. Cecior u. a., § 72, Rn. 35; Welkoborsky, § 72, Rn. 9; Pfohl, Rn. 48.
[31] Vgl. Cecior u. a., § 72, Rn. 34; Havers, § 72, Erl. 4; Welkoborsky, § 72, Rn. 9; Pfohl, Rn. 48.
[32] Vgl. ver.di Gemeinden NRW, Beteiligungstatbestände nach LPVG NRW, Altfassung und Neufassung, Stand 20.09.2007, Sortierung nach Reihenfolge der Bestimmung, S. 1, veröffentlicht unter http://gemeinden.nrw.verdi.de/pdf-dateien/data/alleaenderungenlpvg.pdf, vgl. Anhang 14.
[33] Vgl. Cecior u. a., § 65, Rn. 7; Havers, § 65, Erl. 2.1; Welkoborsky, § 65, Rn. 1; Ilbertz/Widmaier, § 68, Rn. 2; Altvater/Peiseler, § 68, Rn. 11.
[34] Vgl. Cecior u. a., § 62, Rn. 4 f.; Welkoborsky, § 62, Rn. 1; Ilbertz/Widmaier, § 67, Rn. 2 bis 4; Altvater/Peiseler, § 67, Rn. 1 f.; Reimann, S. 273; Kübler, S. 130.
[35] Vgl. Cecior u. a., § 65, Rn. 6; Havers, § 65, Erl. 2.1; Welkoborsky, § 65, Rn. 2; Ilbertz/Widmaier, § 68, Rn. 34 und 35; Altvater/Peiseler, § 68, Rn. 12.
[36] Vgl. Palandt, § 611, Rn. 1, § 320, Rn. 5 und 9; Schreiber, S. 39 und 483; Götze, S. 25 und 307 f.
[37] Vgl. Cecior u. a., § 65, Rn. 26, § 72, Rn. 33; Havers, § 65, Erl. 12; Ilbertz/Widmaier, § 68, Rn. 45b und 48; Altvater/Peiseler, § 68, Rn. 21; Kübler, S. 22.
[38] Vgl. Cecior u. a., § 64, Rn. 15 und 37, § 65, Rn. 13; Havers, § 64, Erl. 5, § 65, Erl. 4; Ilbertz/Widmaier, § 68, Rn. 2.
[39] Vgl. § 2 Abs. 3 Satz 2 TVöD; Wichmann/Langer, Rn. 491.
[40] Vgl. Welkoborsky, § 72, Rn. 10.
[41] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 59.
[42] Vgl. Cecior u. a., § 73, Rn. 49.
[43] Vgl. Kapitel 3.1.2.2.
[44] Vgl. Havers, vor § 66, Erl. 1; Ilbertz/Widmaier, vor § 66, Rn. 8; Pfohl, Rn. 570.
[45] Vgl. Cecior u. a., § 4, Rn. 15, § 70, Rn. 16 und 18; Havers, § 70, Erl. 4;, Welkoborsky, § 4; Ilbertz/Widmaier, vor § 66, Rn. 8, § 76, Rn. 2, § 97, Rn. 4.
[46] Vgl. Havers, § 4, Erl. 3; Ilbertz/Widmaier, § 97, Rn. 5.
[47] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 59.
[48] Vgl. Sponer/Steinherr, § 2, Rn. 701; Clemens u. a., § 2, Rn. 474.
[49] Vgl. Palandt, § 622, Rn. 18; Sponer/Steinherr, § 2, Rn. 702; Clemens u. a., § 2, Rn. 475.
[50] Vgl. Cecior u. a., § 65, Rn. 7; Havers, § 65, Erl. 2.1; Welkoborsky, § 65, Rn. 1; Ilbertz/Widmaier, § 68, Rn. 2; Altvater/Peiseler, § 68, Rn. 11.
[51] Vgl. Ausführungen in Kapitel 3.1.1.3.
[52] Vgl. Wichmann/Langer, Rn. 167.
[53] Vgl. Cecior u. a., § 2, Rn. 6; Ilbertz/Widmaier, § 2, Rn. 3.
[54] Vgl. Wichmann/Langer, Rn. 49.
[55] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 59; Gesetzentwurf der Bundesregierung, Drucksache 16/4027, S. 23.
[56] Vgl. Cecior u. a., § 72, Rn. 12; Havers, § 72, Erl. 2.2; Welkoborsky, § 72, Rn. 7.
[57] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 60.
[58] Vgl. Havers, § 72, Erl. 8.
[59] Vgl. Wichmann/Langer, Rn. 285.
[60] Vgl. Beschluss des BVerwG vom 28.10.2002, 6 P 13.01, http://www.bundesverwaltungsgericht.de/media/archive/864.pdf, S. 9, vgl. Anhang 15, S. 5.
[61] Vgl. Beschluss des BVerwG vom 28.10.2002, 6 P 13.01, http://www.bundesverwaltungsgericht.de/media/archive/864.pdf, S. 10 f., vgl. Anhang 15, S. 5 f.
[62] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 60; Weißauer im Seminar vom 14.12.2007 in Ergänzung zu den Seminarunterlagen, S. 26, vgl. Anhang 16, S. 5.
[63] Vgl. Beschluss des BVerwG, ZBR 1984, 77 (78); Beschluss des BVerwG vom 30.09.1983, 6 P 11.82 (unveröffentlicht), LEXsoft Professional, vgl. Anhang 17, S. 2; Beschluss des BVerwG vom 30.09.1983, 6 P 2.82 (unveröffentlicht), LEXsoft Professional, vgl. Anhang 18, S. 2; Beschluss des BVerwG vom 17.08.1989, 6 P 11.87, ZBR 2/1990, S. 50; Cecior u. a., § 72, Rn. 20; Altvater/Peiseler, § 75, Rn. 8; Dörner, Rn. 875.
[64] Vgl. Beschluss des BVerwG, ZBR 1984, 77 (78); Beschluss des BVerwG vom 30.09.1983, 6 P 11.82 (unveröffentlicht), LEXsoft Professional, vgl. Anhang 17, S. 2; Beschluss des BVerwG vom 30.09.1983, 6 P 2.82 (unveröffentlicht), LEXsoft Professional, vgl. Anhang 18, S. 2.
[65] Vgl. Beschluss des BVerwG, ZBR 1979, 279; Beschluss des BVerwG, ZBR 1984, 77 (78); Beschluss des BVerwG vom 30.09.1983, 6 P 11.82 (unveröffentlicht), LEXsoft Professional, vgl. Anhang 17, S. 2; Beschluss des BVerwG vom 30.09.1983, 6 P 2.82 (unveröffentlicht), LEXsoft Professional, vgl. Anhang 18, S. 2 f.; Cecior u. a., § 72, Rn. 25; Havers, § 72, Erl. 9.1; Ilbertz/Widmaier, § 75, Rn. 4a.
[66] Vgl. Cecior u. a., § 72, Rn. 25; Ilbertz/Widmaier, § 75, Rn. 4a.
[67] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 60.
[68] Vgl. Cecior u. a., § 72, Rn. 482; Havers, § 72, Erl. 73.2; Welkoborsky, § 72, Rn. 126; Lorenzen u. a., § 76, Rn. 44; Ilbertz/Widmaier, § 75, Rn. 133; Altvater/Peiseler, § 75, Rn. 40; Müller, S. 325.
[69] Vgl. Ilbertz/Widmaier, § 76, Rn. 11 und 13.
[70] Das BRRG wird durch das BeamtStG abgelöst und der bisherige § 18 Abs. 2 Satz 2 durch § 18 Abs. 1 Satz 2 neu geregelt, vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Drucksache 16/4027, S. 11 und 26.
[71] Vgl. Cecior u. a., § 72, Rn. 76; Wichmann/Langer, Rn. 133.
[72] Vgl. Cecior u. a., § 72, Rn. 77; Wichmann/Langer, Rn. 133.
[73] Vgl. Cecior u. a., § 72, Rn. 114; Ilbertz/Widmaier, § 76, Rn. 11; Altvater/Peiseler, § 76, Rn. 6, 6a und 6c.
[74] Vgl. Cecior u. a., § 72, Rn. 84; Havers, § 72, Erl. 14; Welkoborsky, § 72, Rn. 21.
[75] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 60; §§ 4 Abs. 3, 6 Abs. 2 Satz 3, 7 Abs. 4 Satz 3 TVÜ-VKA.
[76] Vgl. Beschluss des BVerwG, ZBR 1998, 236 (238); Ilbertz/Widmaier, § 75, Rn. 10; Altvater,/Peiseler, § 75, Rn. 9.
[77] Vgl. Beschluss des BVerwG, ZBR 1998, 236 (238); Altvater,/Peiseler, § 75, Rn. 9.
[78] Vgl. Beschluss des BVerwG, ZBR 1998, 236 (238); Ilbertz/Widmaier, § 75, Rn. 9.
[79] Vgl. Ilbertz/Widmaier, § 76, Rn. 12; Altvater/Peiseler, § 76, Rn. 6e.
[80] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 60.
[81] Vgl. Ilbertz/Widmaier, § 75, Rn. 11, § 76, Rn. 12; Altvater/Peiseler, § 75, Rn. 9, § 76, Rn. 6e.
[82] Vgl. Ilbertz/Widmaier, § 75, Rn. 9.
[83] Vgl. Ilbertz/Widmaier, § 75, Rn. 18.
[84] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 60.
[85] Vgl. § 8 Abs.1 bis 3 TVÜ-VKA.
[86] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 60.
[87] Vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses NRW, Drucksache 14/5034 (Neudruck), S. 28 und 66.
[88] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 60.
[89] Vgl. Ziele der Verwaltung im Personal- und IT-Bericht des Märkischen Kreises 2006, Teil A, S. 22, vgl. Anhang 11, S. 3; Handlungskonzept zur Personalkostenreduzierung, Beratungsdrucksache des Kreistags des Märkischen Kreises FB 1/7/674 vom 28.02.2007, S. 3 bis 5, vgl. Anhang 19, S. 2 bis 4.
[90] Vgl. Kapitel 3.1.2.
[91] Vgl. Kapitel 3.1.2.
[92] Vgl. Kapitel 3.1.2.3.
[93] Vgl. Havers, vor § 66, Erl. 1; Ilbertz/Widmaier, vor § 66, Rn. 8; Pfohl, Rn. 570.
[94] Vgl. Cecior u. a., § 4, Rn. 15, § 70, Rn. 16 und 18; Havers, § 70, Erl. 4; Welkoborsky, § 4; Ilbertz/Widmaier, vor § 66, Rn. 8, § 76, Rn. 2, § 97, Rn. 4.
[95] Vgl. Havers, § 4, Erl. 3; Ilbertz/Widmaier, § 97, Rn. 5.
[96] Vgl. Kapitel 3.1.2.3.
[97] Vgl. Kapitel 3.1.14.2.
[98] Vgl. Kapitel 3.1.14.
[99] Vgl. Ziff. 3.1.4 der VVzLUKG zu § 3 BUKG; Mohr/Sabolewski, § 3, Erl. 9; Ilbertz/Widmaier, § 75, Rn. 22a, § 76, Rn. 16 (a. A. bzw. rechtlich überholt Cecior u. a., § 72, Rn. 146; Havers, § 72, Erl. 22.3; Welkoborsky, § 72, Rn. 32).
[100] Vgl. Havers, § 72, Erl. 22.3; Ilbertz/Widmaier, § 75, Rn. 22a; Altvater u. a., § 75, Rn. 18; Kuhn u. a., § 75, Rn. 10; Altvater/Peiseler, § 75, Rn. 11; Schelter, Art. 75, Rn. 8 (a. A.: Cecior u. a., § 72, Rn. 146; Lorenzen u. a., § 75, Rn. 58; Ilbertz/Widmaier, § 76, Rn. 16; Aufhauser/Brunhöber/ Warga, Art. 75, Rn. 45; Schmitt im Seminar vom 14.12.2007 in Ergänzung zu den Seminarunterlagen, S. 26, vgl. Anhang 16, S. 5; offen: Krieg/Orth/Welkoborsky, Erl. § 72 (1) 5; Welkoborsky, § 72, Rn. 32; Richardi, § 75, Rn. 63, § 76, Rn. 35).
[101] Vgl. Berechnungen diverser Strecken zwischen den Kreisgebäuden laut Volkswagen Routenplaner: von Lüdenscheid nach Iserlohn-Griesenbrauck unter http://bme.map24.com/modules/sessionbase/resizeview/print_screen.php?map24_sid=c7Kk3ql0nACcjp3T7TaJUSZvHKJVbUja2byFIJoR.ENQG8iUQJ0Rw6.3NoSNT4ABbSGuYuJaf6ZouTA.wKqHpg&appid=VOLKSWAGEN&stg=&bmetype=sessionbase&subset=searchlocation&runtime_state=routeplanner&webfw_module=print&webfw_module_event=printroute&minimap=0&metric=Y&t=c054d30ac6e7e371d71d1980b7282c49&rid=ZZIDHHVMR6_REUC3_TA_6_7_17_34_37_SHORTA3F3_FTFEtfT1.0ComVec_v3CoCtyVehtSTab3_, vgl. Anhang 20; von Lüdenscheid nach Iserlohn unter http://bme.map24.com/modules/sessionbase/resizeview/print_screen.php?map24_sid=c7Kk3ql0nACcjp3T7TaJUSZvHKJVbUja2byFIJoR.ENQG8iUQJ0Rw6.3NoSNT4ABbSGuYuJaf6ZouTA.wKqHpg&appid=VOLKSWAGEN&stg=&bmetype=sessionbase&subset=searchlocation&runtime_state=routeplanner&webfw_module=print&webfw_module_event=printroute&minimap=0&metric=Y&t=06be6b89933bbaa3b395fb547e067624&rid=GKDXTTGMR5_REUC3_TA_5_7_17_56_38_SHORTA3F3_FTFEtfT1.0ComVec_v3CoCtyVehtSTab3_, vgl. Anhang 21; von Lüdenscheid nach Altena unter http://bme.map24.com/modules/sessionbase/resizeview/print_screen.php?map24_sid=c7Kk3ql0nACcjp3T7TaJUSZvHKJVbUja2byFIJoR.ENQG8iUQJ0Rw6.3NoSNT4ABbSGuYuJaf6ZouTA.wKqHpg&appid=VOLKSWAGEN&stg=&bmetype=sessionbase&subset=searchlocation&runtime_state=routeplanner&webfw_module=print&webfw_module_event=printroute&minimap=0&metric=Y&t=e3b91040933d74480b3c8abe150dc9ae&rid=PLQQGVFQR5_REUC3_TA_5_7_17_58_19_SHORTA3F3_FTFEtfT1.0ComVec_v3CoCtyVehtSTab3_, vgl. Anhang 22.
[102] Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Drucksache VI/3721, S. 15, 26 f. und 41.
[103] Vgl. Urteil des LAG Köln (Leitsatz), PV 2001, S. 423.
[104] Vgl. § 37 des Sauerland / Paderborngesetzes (GVBl NRW, 28. Jg., S. 1224 bis 1234), vgl. Anhang 12, S. 2.
[105] Vgl. Cecior u. a., § 72, Rn. 145; Ilbertz/Widmaier, § 75, Rn. 22a.
[106] Vgl. Personal- und IT-Bericht des Märkischen Kreises 2006, Teil A, S. 25, vgl. Anhang 11, S. 4.
[107] Vgl. Cecior u. a., § 72, Rn. 147.
[108] Vgl. Cecior u. a., § 62, Rn. 4; Havers, § 62, Rn. 5 f.; Welkoborsky, § 62, Rn. 1; Ilbertz/Widmaier, § 67, Rn. 2; Altvater/Peiseler, § 67, Rn. 2, § 77, Rn. 6.
[109] Vgl. Mohr/Sabolewski, § 3, Erl. 9; Lorenzen u. a., § 75, Rn. 58.
[110] Vgl. Cecior u. a., § 72, Rn. 146; Havers, § 72, Erl. 22.3; Krieg/Orth/Welkoborsky, Erl. § 72 (1) 5; Welkoborsky, § 72, Rn. 32; Ilbertz/Widmaier, § 75, Rn. 22a, § 76, Rn. 16; Altvater u. a., § 75, Rn. 18; Kuhn u. a., § 75, Rn. 10; Richardi, § 75, Rn. 63, § 76, Rn. 35; Aufhauser/Brunhöber/Warga, Art. 75, Rn. 45.
[111] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 61.
[112] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 61.
[113] Vgl. Cecior u. a., § 65, Rn. 7; Havers, § 65, Erl. 2.1; Welkoborsky, § 65, Rn. 1; Ilbertz/Widmaier, § 68, Rn. 2; Altvater/Peiseler, § 68, Rn. 11.
[114] Vgl. Cecior u. a., § 65, Rn. 26; Havers, § 65, Erl. 12; Ilbertz/Widmaier, § 68, Rn. 45b und 48; Altvater/Peiseler, § 68, Rn. 21.
[115] Vgl. Cecior u. a., § 64, Rn. 15 und 37, § 65, Rn. 13; Havers, § 64, Erl. 5, § 65, Erl. 4; Ilbertz/Widmaier, § 68, Rn. 2.
[116] Vgl. Welkoborsky, § 72, Rn. 36.
[117] Vgl. Verordnung über ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis für den Zugang zur Ausbildung zur Brandmeisterin oder zum Brandmeister NRW.
[118] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 61.
[119] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 61.
[120] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 61.
[121] Vgl. Kapitel 3.1.1.3.
[122] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 61.
[123] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 61.
[124] Durch den TVöD ist die bisherige Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern (vgl. § 1 Abs. 1 TVöD) entfallen.
[125] Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung NRW, Drucksache 14/4239, S. 61.
[126] Vgl. Cecior u. a., § 72, Rn. 121.
[127] Vgl. Ilbertz/Widmaier, § 76, Rn. 20.
[128] Vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Frauen und Jugend, Bundestagsdrucksache 12/7232, S. 37.
[129] Vgl. a. A.: Lorenzen, § 76, Rn. 113; Ilbertz/Widmaier, § 76, Rn. 57 f.; Altvater/Peiseler, § 76, Rn. 25.
[130] Vgl. Cecior u. a., § 72, Rn. 380; Havers, § 72, Erl. 60.1; Welkoborsky, § 72, Rn.102; Ilbertz/Widmaier, § 75, Rn. 97 f.; Altvater/Peiseler, § 75, Rn. 31.
Details
- Titel
- Die Auswirkungen des neuen Landespersonalvertretungsgesetzes Nordrhein-Westfalen auf die Beteiligungsrechte des Personalrats in personellen Angelegenheiten
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2008
- Seiten
- 159
- Katalognummer
- V225817
- ISBN (eBook)
- 9783836613583
- Dateigröße
- 9691 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- personalvertretungsgesetz beteiligungsrechte personalrat lpvg nordrhein-westfalen
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2008, Die Auswirkungen des neuen Landespersonalvertretungsgesetzes Nordrhein-Westfalen auf die Beteiligungsrechte des Personalrats in personellen Angelegenheiten, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/225817
- Angelegt am
- 28.5.2008

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.