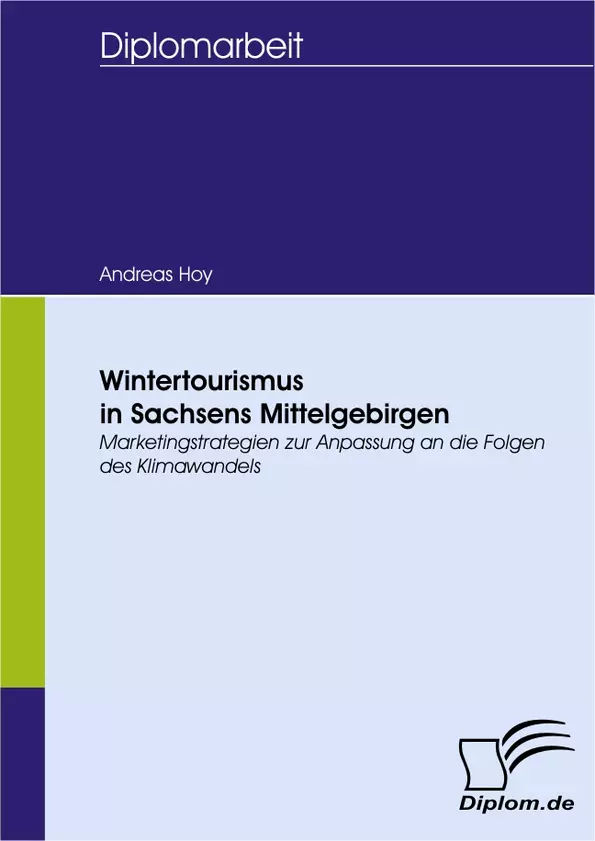Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos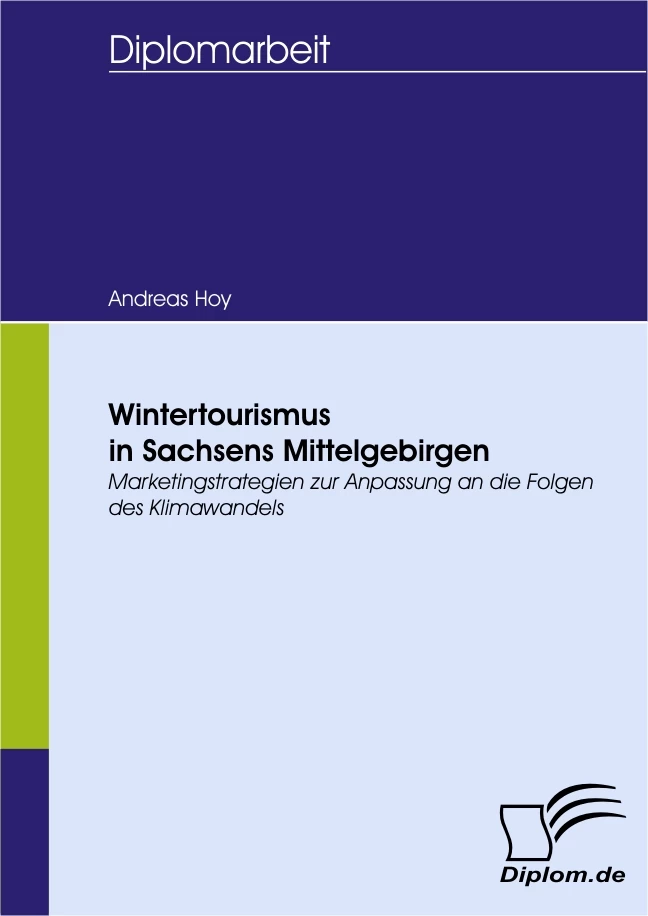
Wintertourismus in Sachsens Mittelgebirgen
Diplomarbeit, 2008, 165 Seiten
Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Wirtschaftswissenschaften)
Note
1,0
Leseprobe
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Danksagung
1 Einführung
1.1 Globale Einordnung des Themas „Klimawandel“
1.2 Hypothesen, Ziel und Konzept
1.3 Geografische Einordnung des Untersuchungsgebietes
2 Begriffsdefinitionen
2.1 Marketing
2.1.1 Strategisches Marketing
2.1.2 Regionalmarketing
2.2 Tourismus
2.2.1 Definition und Abgrenzung
2.2.2 Wintertourismus und Wintersporttourismus
2.3 Tourismusmarketing
2.4 Definition und Abgrenzung der Begriffe Wetter, Witterung und Klima
3 Volkswirtschaftliche Konsequenzen des anthropogenen Klimawandels
3.1 Problemfeld „Anthropogener Klimawandel“
3.1.1 Begriff
3.1.2 Weiterführende Informationen und Literatur
3.2 Globale ökonomische Folgen
3.3 Ökonomische Folgen für Deutschland
4 Klimatische Verhältnisse als Grundlage des Wintertourismus
4.1 Großräumige klimatische Einflussfaktoren im Winter
4.1.1 Die Nordatlantische Oszillation
4.1.2 Die Großwetterlagen/Großwettertypen
4.2 Variablen des sächsischen Mittelgebirgsklimas
4.3 Natürliche Schneebedeckung und Schneesicherheit
4.4 Technische Beschneiung
4.5 Klimaprojektionen und -szenarien: Ausblick bis 2050
5 Tourismus und Wintertourismus in Sachsen
5.1 Tourismus und touristische Vermarktungsstruktur
5.2 Bedeutung des (Winter-)tourismus für die sächsischen Mittelgebirge und insbesondere das Erzgebirge
5.3 Alpine Skigebiete als „Leuchttürme“ des Wintertourismus
5.3.1 Historische Entwicklung des alpinen Skitourismus
5.3.2 Heutige Bedeutung für den Wintertourismus
5.3.3 Touristische Zielgruppen
5.4 Skilanglauf als wichtige Basis des Wintertourismus
5.5 Weitere wintertouristische Aktivitäten und Entwicklungspotenzial
6 Empirische Untersuchung des wintertouristischen Angebotes
6.1 Methodik und Ablauf der Befragung
6.2 Frequenzvergleich von Sommer- und Wintertourismus
6.3 „Stars“ des wintertouristischen Angebotes
6.4 Lage, Infrastruktur und Betreiber der Skigebiete
6.5 Marketing
6.5.1 Dienstleistungsangebot der Skigebiete
6.5.2 Informationsquellen zu aktuellen Schneeverhältnissen am Skihang
6.5.3 Platzierung von Werbemaßnahmen
6.5.4 Vorhandensein eines Unique Selling Proposition
6.5.5 Durchführung von Befragungen der Nachfrageseite
6.6 Beurteilung technischer Beschneiung durch die Vertreter der Skigebiete
6.7 Geplante Investitionen in den Skigebieten
6.8 Beurteilung des Wegfalls der Grenzkontrollen nach Tschechien
6.9 Klimawandel und Auswirkungen
6.9.1 Einfluss auf die natürlichen Schneeverhältnisse
6.9.2 Priorität des Themas Klimawandel
6.9.3 Kompetenz der Informationen zum Thema Klimawandel
6.9.4 Erfolgte und geplante Anpassungsmaßnahmen
6.9.5 Chancen durch den Klimawandel
6.9.6 Risiken durch den Klimawandel
6.9.7 Reaktion der Skiliftbetreiber bei zunehmender Schneearmut
6.10 Beurteilung von Ideen zu Alternativangeboten im Wintertourismus
6.10.1 Allgemeine Erläuterung zum Fragenkomplex
6.10.2 Beurteilung der vorgegebenen Alternativangebote
7 Übersicht der Anpassungsstrategien
7.1 Anpassungsstrategien der Nachfrage
7.2 Anpassungsstrategien des Angebotes
8 Handlungsempfehlungen zur Anpassung des sächsischen Wintertourismus an den Klimawandel
8.1 Sicherung des schneegebundenen Wintertourismus
8.1.1 Erweiterung der technischen Beschneiung in Alpinskigebieten
8.1.2 Pistenpräparierung zur Nutzung niedrigerer Schneehöhen
8.1.3 Skiloipennetz Sachsen
8.1.4 Winter- und Schneeschuhwandern
8.1.5 Skihallen zur Sicherung des Ski-Nachwuchses
8.1.6 Vernetzung von Skigebieten und weiteren Attraktionen
8.1.7 Ergänzungsfunktion kleiner Skigebiete
8.2 Winterliche Alternativen ohne Schneebindung
8.2.1 Schneeunabhängige Angebote auf dem Skihang
8.2.2 Aktivwege und Allwetterloipen
8.2.3 Trendsportarten Nordic Walking und Wandern
8.2.4 Von Wellness zu Selfness
8.2.5 Kulturangebote
8.2.6 Verstärkte Aktivierung des Potenzials 50+-Generation
8.2.7 Offensives Marketing mit Alternativangeboten
8.2.8 Gezielte staatliche Förderung der Diversifizierung des Wintertourismus
8.3 Vier-Jahreszeiten-Tourismus
8.3.1 Ausdehnung der Zwischensaison
8.3.2 „Sommerfrische“ als Chance des Klimawandels
8.4 Risiken und Schwierigkeiten
8.4.1 Schlechte Annahme der Alternativangebote
8.4.2 Erlebnis „weißer Winter“ und Abwanderung in schneesichere Gebiete
9 Beschreibung einer empirischen Untersuchung der Nachfrageseite
9.1 Forschungsdesign
9.2 Fragestellungen
10 Fazit und Ausblick
Anlagen
Anlage 1: Globaler anthropogener Klimawandel - wissenschaftliche Grundlagen
Anlage 2: Großwetterlagen/Großwettertypen in Sachsen: Untersuchungsmethodik und weitere Ergebnisse
Anlage 3: Verwendete und empfohlene Fragebögen
Anlage 4: Untersuchte Gemeinden und Skilifte
Anlage 5: Liste der Expertengespräche
Quellenverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung1-1: Karte der Naturräume Sachsens
Abbildung2-1: Verknüpfungspunkte von Marketing und Tourismus
Abbildung 2-2: Abgrenzung der Begriffe Wetter, Witterung, Klima und Klimawandel..
Abbildung4-1: Verteilung des mittleren Luftdrucks auf Meereshöhe über dem Nordatlantik im Januar für die Periode 1941-1970
Abbildung4-2a: Mittlere Häufigkeit der Großwettertypen in den zehn an der Station Fichtelberg/Sachsen kältesten bzw. wärmsten Wintern im Zeitraum 1916/17-2006/07 im Vergleich zum langjährigen Mittelwert ihres Auftretens
Abbildung4-2b: Mittlere Temperaturabweichung der einzelnen Großwettertypen in den Wintern des Zeitraumes 1916/17-2006/07 an der Station Fichtelberg/Sachsen
Abbildung 4-3: Verteilung der mittleren Wintertemperatur im Zeitraum 1981-2000
Abbildung4-4: Jahresgang der mittleren Schneehöhe auf dem Fichtelberg im Vergleich der Zeiträume 1951-1980 und 1981-2007.
Abbildung 4-5: Winterliche Differenz der Temperatur der Periode 2041-2060 (Projektion im Szenario A1B) zur Periode 1981-2000
Abbildung 5-1: Touristische Vermarktungsstruktur des Regionalmarketings in Sachsen
Abbildung6-1: Bedeutung der Winter- im Vergleich zur Sommersaison in den untersuchten Gemeinden
Abbildung 6-2: Touristische Hauptattraktionen in der Wintersaison
Abbildung6-3: Räumliche Verteilung der untersuchten Skigebiete innerhalb der sächsischen Mittelgebirgsregionen
Abbildung 6-4: Betreiber der untersuchten sächsischen Skigebiete
Abbildung 6-5: Dienstleistungsangebot am Skihang
Abbildung 6-6: Informationsquellen zu den aktuellen Schneebedingungen am Skihang
Abbildung 6-7: Beurteilung technischer Beschneiung
Abbildung6-8: Beurteilung des Wegfalls der Grenzkontrollen zu Tschechien im Hinblick auf die Besucherfrequenzen
Abbildung6-9: Meinungen zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die natürlichen Schneeverhältnisse
Abbildung 6-10: Priorität des Themas Klimawandel
Abbildung 6-11: Kompetenz der Informationen zum Thema Klimawandel
Abbildung 6-12: Reaktion der Vertreter der Skigebiete bei zunehmender Schneearmut
Abbildung 6-13: Beurteilung alternativer Angebote im Wintertourismus
Abbildung 7-1: Reaktionsmöglichkeiten der Wintertouristen auf den Klimawandel in Sachsen
Abbildung 7-2: Reaktionsmöglichkeiten der Wintertouristiker auf den Klimawandel in Sachsen
Abbildung 8-1: Mattenskihang in Rugiswalde (Sächsische Schweiz)
Abbildung 8-2: Plastematten in Rugiswalde (Sächsische Schweiz)
Abbildung 8-3: Bevölkerungspyramide Sachsens 2005 im Vergleich zu 2020 (Prognose)
Abbildung8-4: Beschneite Skipiste in Klingenthal OT Mühlleithen (Vogtland) inmitten schneeloser Umgebung
Tabellenverzeichnis
Tabelle 3-1: Darstellung der CO2e-Werte wichtiger Spurengase
Danksagung
Nachfolgend möchte ich mich bei all denen bedanken, die mir durch wertvolle Ratschläge die Erstellung der vorliegenden Arbeit erleichterten und mich auch in schwierigen Phasen zum Durchhalten ermutigten.
Mein besonderer Dank gebührt der Erstbetreuerin dieser Diplomarbeit, Frau Prof. Dr. Anja Stöhr, die mich in der Wahl dieses interessanten Themas bestärkte und mir mit ihren Ratschlägen wertvolle Hinweise zum Gelingen dieser Arbeit gab. Besonders bedanken möchte ich mich auch bei meinem Zweitbetreuer, Herrn Dipl.-Met. Wilfried Küchler, der meine Ideen zu dieser Arbeit begeistert aufnahm und mich vielfältig unterstützte.
Herzlich danken möchte ich den Mitarbeitern des Referates „Klima“ des Landesamtes für Umwelt und Geologie für die vielfältige fachliche, technische und moralische Unter-stützung. Speziell genannt seien Udo Mellentin und Nils Feske, die mir besonders bei Fragen in den Bereichen Klima und Klimawandel beratend zur Seite standen, Irini von Rechenberg, die immer ein offenes Ohr für mich hatte, sowie Andreas Köhl für die gute Zusammenarbeit beim gegenseitigen Korrekturlesen unserer Diplomarbeiten.
Bedanken möchte ich mich außerdem bei allen, die mir im Rahmen der Expertengespräche und Interviews für meine Fragen zur Verfügung standen. Dem Leiter der Wetterstation Fichtelberg, Herrn Gerd Franze, gilt mein Dank für die Unterstützung bei der Digitalisierung der Klimadaten der Wetterstation Fichtelberg, ebenso erneut Nils Feske für seine Hilfe im Rahmen dieses Projektes.
Den Korrekturlesern dieser Arbeit danke ich für ihre Zeit und Mühe. Ebenso möchte ich mich bei meinen Eltern und Freunden für die Unterstützung, Geduld und Aufmunterung während der vergangenen sechs Monate bedanken.
Der Klimawandel ist „…das größte Marktversagen, das die Menschheit je gesehen hat.“
Sir Nicholas Stern , ehem. Chefökonom der Weltbank, anlässlich der Vorstellung des Stern Report zu den wirtschaftlichen Folgekosten des Klimawandels am 30.10.2006 in London [FAZ.net 06.11.2006]
„Ohne es zu bemerken, haben wir einen Krieg mit der Erde angefangen. Es ist Zeit, Frieden mit dem Planeten zu schließen.“
Al Gore , ehem. Vizepräsident der USA, anlässlich der Entgegennahme des Friedensnobelpreises am 10.12.2007 in Oslo [FAZ 11.12.2007]
1 Einführung
1.1 Globale Einordnung des Themas „Klimawandel“
Die Welt des 21. Jahrhunderts steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die Lebensgewohnheiten der Menschen, die sich über Jahrhunderte und Jahrtausende nur langsam wandelten, verändern sich seit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert in immer schnellerem Tempo. Dies betrifft inzwischen fast alle Bevölkerungsgruppen der Erde. Gleichzeitig verändern die Grundlagen des Wohlstandes der entwickelten Länder, vor allem die exzessive Nutzung fossiler Energieträger, das klimatische Gleichgewicht der Atmosphäre. Mit der seit den 1990er Jahren verstärkten ökonomischen Globalisierung und dem ständig steigenden Rohstoffbedarf aufstrebender Schwellenländer wie China und Indien erhöhte sich die Dynamik dieser Entwicklung erneut. Die Konsequenzen daraus bedrohen nicht nur die Existenz vieler ökologischer Habitate und einen großen Anteil der globalen Vielfalt an Flora und Fauna, sondern auch den Verursacher dieser Veränderungen – die globale und regionale Wirtschaft.
Schon viele Jahrzehnte mahnen Klimaforscher vor den dramatischen Folgen anthropogener Einflüsse auf das Weltklima, aber nie waren deren Warnungen so drastisch wie im Jahr 2007. Noch nie war die Sicherheit ihrer Aussagen so hoch. Und niemals zuvor war ein globales politisches Handeln zur Bewältigung dieser Herausforderung so nötig wie gegenwärtig. Die vorangestellten Zitate zweier bedeutender Persönlichkeiten belegen diese Dramatik eindrucksvoll. Die Verleihung des Friedensnobelpreises am 10. Dezember 2007 an den ehemaligen Vizepräsidenten der USA, Al Gore, und den Weltklimarat der Vereinten Nationen (IPCC) für ihr Engagement gegen die anthropogene Veränderung des Klimas symbolisiert, dass jetzt ein entschlossenes politisches Handeln erforderlich ist, um die Gefahr weitreichender Verwerfungen innerhalb der menschlichen Gesellschaft aufgrund fortschreitender Klimaänderungen eindämmen zu können. Dabei muss ökonomisches Handeln als Ursache der anthropogenen Beeinflussung des Weltklimas auch bei deren Eindämmung die dominierende Rolle spielen. Gleichzeitig ist eine nachhaltige wirtschaftliche Anpassung an nicht mehr zu vermeidende Folgen der Klimaänderung unumgänglich, um künftiges Wachstum zu ermöglichen und eine lebenswerte Zukunft zu sichern.
1.2 Hypothesen, Ziel und Konzept
Folgende Hypothesen bilden die Grundlage dieser Diplomarbeit:
- Das Klima in Sachsen erwärmt sich in den nächsten Jahrzehnten. Die Bedingungen für die Ausübung von schneegebundenen wintertouristischen Aktivitäten in Sachsen werden sich demzufolge flächendeckend verschlechtern (Tendenzhypothese)
- Die Tourismuswirtschaft in Sachsens Mittelgebirgen ist bisher unzureichend auf die mit dem Klimawandel einhergehenden Veränderungen im Wintertourismus eingestellt. Für eine erfolgreiche Anpassung an diese Veränderungen ist eine Umgestaltung der Marketingstrategien im Wintertourismus – insbesondere des fremdenverkehrlichen Angebotes und der touristischen Kommunikation – unbedingt erforderlich (Orientierungshypothese)
Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es, für die Region der sächsischen Mittelgebirge Ansätze für eine touristische Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu entwickeln. Im Vordergrund steht dabei eine stärkere Diversifizierung des wintertouristischen Angebotes.
Im theoretischen Teil der Arbeit werden zunächst für das Verständnis der Arbeit wichtige Begriffe definiert und Zusammenhänge zwischen diesen erläutert. Anschließend werden das Problemfeld des anthropogenen Klimawandels und mit dem Klimawandel einhergehende langfristige ökonomische Konsequenzen auf globaler und nationaler Ebene betrachtet. Daran schließt sich die Darstellung großräumiger klimatischer Einflussfaktoren auf das sächsische Winterklima, der Charakteristik des winterlichen Mittelgebirgsklimas und der Projektionen klimatischer Veränderungen im Freistaat an. Aufgrund der starken Schneeabhängigkeit des Wintertourismus liegt ein Schwerpunkt der klimatologischen Betrachtung auf dem Parameter Schnee und dessen technischer Beeinflussung. Weiterhin werden die touristische Vermarktung im Freistaat Sachsen und die Bedeutung des Tourismus für den sächsischen Mittelgebirgsraum dargestellt. Als bedeutendste Bestandteile des Wintertourismus werden alpiner Skisport und Skilanglauf näher erläutert.
Um eigene Erkenntnisse zum Thema Wintertourismus und Klimawandel in Sachsen gewinnen zu können, wurde eine empirische Untersuchung unter Vertretern des wintertouristischen Angebotes durchgeführt. Dazu wurden 59 Vertreter von alpinen Skigebieten und Gemeinden des sächsischen Mittelgebirgsraumes befragt. Die Auswertungen dazu umfassen vor allem Fragen zum Status quo des eigenen Marketings und zur Beurteilung des Klimawandels und der sich daraus ergebenden Konsequenzen. Wichtig im Hinblick auf die Ergebnisse dieser Arbeit waren insbesondere die Bewertung und die Entwicklung von Alternativangeboten für eine stärkere Diversifizierung des Wintertourismus. Anschließend werden in knapper und übersichtlicher Form mögliche Anpassungsstrategien von Seiten der Nachfrage und des Angebotes dargestellt.
Aufbauend auf der theoretischen Basis dieser Arbeit und den Ergebnissen der eigenen Untersuchung werden Handlungsempfehlungen gegeben, wie sich der sächsische Wintertourismus an den Klimawandel und andere relevante Veränderungen (bspw. den demografischen Wandel) anpassen kann. Die angebotenen Vorschläge bedienen sich einer Palette von Möglichkeiten, um eine stärkere Diversifizierung des Angebotes und damit eine geringere Vulnerabilität gegenüber gesellschaftlichen und klimatischen Veränderungen zu erreichen. Die Arbeit endet mit der Vorstellung von Forschungsdesign und Fragestellungen für eine mögliche weitere Untersuchung im Nachfragebereich unter Alpin- und Langlaufskifahrern. Die Durchführung und Auswertung der empfohlenen Befragung dient als Handlungsempfehlung für nachfolgende Arbeiten.
1.3 Geografische Einordnung des Untersuchungsgebietes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung1-1: Karte der Naturräume Sachsens
Quelle: Köhl 2008
Sachsen befindet sich zwischen 50° 10’ und 51° 41’ nördlicher Breite sowie 11° 52’ und 15° 03’ östlicher Länge im „Herzen“ Europas [SLFS 2007a: 26]. Abbildung1-1 illustriert die Naturräume Sachsens. Die sächsischen Mittelgebirge erstrecken sich entlang der südlichen Landesgrenze zur Tschechischen Republik. Von Ost nach West umfasst das Untersuchungsgebiet dieser Diplomarbeit das Zittauer Gebirge, das Oberlausitzer Bergland, die Sächsische Schweiz, das gesamte Erzgebirge und das Vogtland. Höhenlagen von unter 600m über Normal Null (NN) werden im Rahmen dieser Arbeit als niedrig, zwischen 600 und 900m über NN als mittelhoch und über 900m über NN als hoch gelegen bezeichnet.
2 Begriffsdefinitionen
2.1 Marketing
2.1.1 Strategisches Marketing
Im folgenden Kapitel werden für diese Arbeit relevante Begriffe der Bereiche Marketing, Tourismus und Klima analysiert und miteinander in Beziehung gesetzt.
Der Terminus Marketing bezeichnet die Analyse, Planung, Realisation und Kontrolle aller auf die Märkte ausgerichteten Unternehmensaktivitäten. Dabei wird vor allem auf die Absatzmärkte Bezug genommen [Bruhn 2007: 14]. Der Markt als Ort des Zusammen-treffens von Angebot und Nachfrage bildet dabei sowohl Bezugs- als auch Zielobjekt des Marketings. Die Bezugsfunktion ist dabei gekennzeichnet durch die Einschränkung des Handlungsspielraumes des Unternehmens durch die auf dem Markt auftretenden Akteure (Kunden, Wettbewerber, Partner, Zulieferer, Arbeitskräfte, staatliche Institutionen usw.). Im Gegensatz dazu wird der Markt gleichzeitig zum Ziel von Aktivitäten des Marketing treibenden Unternehmens. Im Mittelpunkt steht dabei die Beeinflussung potenzieller Kunden und der Konkurrenten zum eigenen Vorteil [Homburg/Krohmer2006: 2 f.].
Unter einer Strategie werden im betriebswirtschaftlichen Sinne die von der Unternehmensführung zur Erreichung der zentralen Unternehmensziele getroffenen langfristigen Entscheidungen und Maßnahmen verstanden [Brockhaus2006, Bd.26:445]. Sie basiert auf den Beziehungen des Unternehmens zur externen Umwelt, den individuellen Ressourcen und Fähigkeiten, den eigenen Wettbewerbsvorteilen und nicht zuletzt der Synergie aus dem Zusammenwirken dieser verschiedenen Kräfte durch strategische Entscheidungen [Gabler2004: 2833, 2873].
Abgeleitet von diesen beiden Begriffen bestimmt die Marketingstrategie bzw. das Strategische Marketing also diejenigen Aktivitäten, die für eine möglichst dauerhafte erfolgreiche Positionierung eines Unternehmens am Markt notwendig sind.
2.1.2 Regionalmarketing
Das Regionalmarketing ist neben dem Stadtmarketing eine Form des Standortmarketings. Vermarktet wird die Region in ihrer Funktion als Wohn- und Lebensraum der ansässigen Bevölkerung, als Standort der Wirtschaft und, falls relevant, als Tourismusdestination. Ziel ist es, über die Entwicklung von Marketingstrategien (dabei insbesondere über die zielgruppengerechte Erstellung von Leistungsangeboten und deren Kommunikation) die Attraktivität der Region zu steigern [Diller 2001: 1479f., 1603ff.]. Das Tourismus-marketing im Sinne dieser Arbeit ist eine Form des Regionalmarketings.
2.2 Tourismus
2.2.1 Definition und Abgrenzung
Der Begriff Tourismus umfasst nach der Definition der Welttourismusorganisation WTO[1] „die Gesamtheit aller Erscheinungen und Beziehungen, die mit dem Verlassen des üblichen Lebensmittelpunktes und dem Aufenthalt an einer anderen Destination […] verbunden sind“ [Frietzsche in Gabler2004: 2948 f.]. Analog dazu werden auch die Termini Fremdenverkehr und touristischer Reiseverkehr verwendet. Zum Tourismus zählen Freizeit- und Geschäftsreisen. Je nach Dauer werden diese in Ausflugsverkehr (ohne Übernachtung), Kurzreisen (wenige Übernachtungen) und längere bzw. Urlaubsreisen eingeteilt [Freyer 2007: 4].
Der institutionelle Begriff Touristik bezeichnet die touristische Branche. Die darin auftretenden Akteure setzen sich aus erwerbswirtschaftlich orientierten Unternehmen und (über-)regionalen Nonprofit-Organisationen zusammen [Frietzsche in Gabler 2004: 2955]. Letztere prägen über das touristische Regionalmarketing bzw. das Tourismusmarketing maßgeblich die strategischen touristischen Entscheidungen eines Gebietes (vgl. für die touristische Vermarktungsstruktur in Sachsen Kapitel 5.1)
2.2.2 Wintertourismus und Wintersporttourismus
„Der Wintertourismus grenzt den Tourismus zeitlich auf die Wintersaison und räumlich auf Gebirge oder Hügel mit Schneefall ein.“ Dabei umfasst dieser vor allem schneegebundene Tourismusaktivitäten (wie bspw. Skifahren). Zusätzlich werden noch andere, schneeunabhängige Tourismusformen angeboten. Diese können speziell auf die Wintersaison ausgerichtet sein, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich [Klein 2007: 15].
Alle schnee- und/oder eisabhängigen Aktivitäten fallen unter den Begriff des Wintersporttourismus. Besonders bedeutsam ist der Skilauf, der sich in den alpinen oder Abfahrtsskilauf und den Skilanglauf gliedert [Brockhaus2006,Bd.1:354]. Für die Skiabfahrt werden die Skifahrer mittels einer Aufstiegshilfe von der Tal- zur Bergstation hinauf befördert, um von dort auf einem Skihang selbstständig bergab zu fahren. Abwandlungen der klassischen Fortbewegung (wie bspw. Snowboarding oder Carving) sind im Rahmen dieser Arbeit ausdrücklich in dem Begriff des alpinen Skifahrens integriert. Beim Skilanglauf fahren die Skifahrer auf ebener oder hügeliger Strecke auf Loipen oder Skiwanderwegen[2], ohne dass Aufstiegshilfen notwendig sind. Auch hier sollen Abwandlungen von der klassischen Technik (wie bspw. das Skaten) in dem Begriff Skilanglauf integriert sein [Arbeitsdefinition des Verfassers].
2.3 Tourismusmarketing
Viele der bisher in diesem Kapitel definierten Termini sind im Begriff des Tourismusmarketing s integriert (vgl. Abbildung2-1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung2-1: Verknüpfungspunkte von Marketing und Tourismus
Quelle: eigene Darstellung
Diese recht junge Disziplin entwickelte sich erst in den 1970er Jahren und lehnt sich an das Dienstleistungsmarketing an. Das Tourismusmarketing ist das Marketing auf dem touristischen Markt [Diller 2001: 1673 f.]. „Der Tourismusmarkt[3] (Reisemarkt) ist der abstrakte Ort, an dem das Angebot an und die Nachfrage nach touristischen Leistungen zusammentreffen“ [Diller 2001: 1674]. Dort konkurrieren aus betriebswirtschaftlicher Sicht unter anderem Reiseveranstalter, Beherbergungsbetriebe, touristische Transportbetriebe, Fremdenverkehrsämter, Tourismusdestinationen und Tourismus-verbände miteinander. Das „Zusammenspiel“ dieser und weiterer gesamtwirtschaftlicher Faktoren wirkt sich auf volkswirtschaftliche Einheiten wie Gemeinden, Regionen, Bundesländer und andere aus. Der Markt fungiert dabei als Bindeglied zwischen betriebs- und volkswirtschaftlichen Einheiten. Ein erfolgreiches Tourismusmanagement ist durch deren gute Kooperation am Tourismusmarkt gekennzeichnet [Freyer 2007: 6ff.].
2.4 Definition und Abgrenzung der Begriffe Wetter, Witterung und Klima
Der Begriff des Klimas wird umgangssprachlich häufig mit den Termini Wetter oder Witterung gleichgesetzt. Dabei sind die drei Begriffe eindeutig voneinander abgrenzbar und werden zur Charakterisierung der meteorologischen Ereignisse unterschiedlich langer Zeiträume verwendet. Im sächsischen Wintertourismus entscheidet das Klima, ob ein Gebiet zur Ausübung von schneegebundenen Tourismusformen geeignet ist oder nicht. Ob die tatsächliche Ausübung zu einem bestimmten Zeitpunkt möglich ist, wird vom Wetter bzw. der Witterung bestimmt. Zum korrekten Verständnis der vorliegenden Diplomarbeit ist die richtige Einordnung dieser meteorologischen Grundbegriffe daher eine essentielle Voraussetzung und wird nachfolgend vorgenommen (vgl. auch Abbildung 2-2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2-2: Abgrenzung der Begriffe Wetter, Witterung, Klima und Klimawandel
Quelle: eigene Darstellung
Als Wetter wird im deutschsprachigen Raum der messbare physikalische Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort der Erdoberfläche über die Dauer von Stunden oder Tagen definiert. Geprägt wird das Wetter von den Wetterlagen, die den Zustand der Atmosphäre über einem größeren Gebiet bestimmen [Hupfer/Kuttler 1998: 16; Schönwiese 2003: 48 f.].
Mit wachsender Zeitspanne schließt sich der Begriff der Witterung an. Diese umfasst den Ablauf des Wettergeschehens über viele Tage, einige Wochen, Monate oder einzelne Jahreszeiten. International, insbesondere in der englischsprachigen Literatur, ist der Witterungsbegriff unbekannt. Dort wird die Grenze zwischen Wetter und Klima bei etwa einem Monat festgelegt, der nach gegenwärtiger Auffassung theoretischen Obergrenze für Wettervorhersagen [Hupfer/Kuttler 1998: 17; Schönwiese 2003: 48 f.].
Das Klima eines Ortes oder einer Region ist laut der Meteorologischen Weltorganisation (WMO)[4] die Synthese des Wetters an der Erdoberfläche über einen bestimmten Zeitraum. Dazu werden von der WMO dreißigjährige Referenzperioden festgelegt, um die charakteristischen statistischen Eigenschaften des Wetters bestimmen zu können. Gegenwärtig gilt der Zeitraum 1961 bis 1990 als Klimanormalperiode [Hupfer/Kuttler 1998: 17; Schönwiese 2003: 48 f.]. Der Begriff Klimawandel ist eng mit dem Begriff des Klimas verknüpft. Klima ist kein Zustand, sondern verändert sich permanent. Die bisherige Klimageschichte der Erde ist gleichzeitig die Geschichte des natürlichen Klimawandels.
3 Volkswirtschaftliche Konsequenzen des anthropogenen Klimawandels
3.1 Problemfeld „Anthropogener Klimawandel“
3.1.1 Begriff
Die Notwendigkeit von klimatisch bedingten Anpassungsprozessen in der sächsischen Tourismuswirtschaft besteht aufgrund des anthropogen verursachten Klimawandels. Eine nähere Betrachtung des Themenkreises Klimawandel ist daher sinnvoll, um den Bedarf an Anpassungsmaßnahmen begründen zu können.
Der Begriff Klimawandel wird vom Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) wie folgt definiert: “any change in climate over time, whether due to natural variability or as a result of human activity” [IPCC 2007a: 2]. Durch den vom Menschen verursachten Anstieg der Konzentration der bereits für den natürlichen Treibhauseffekt verantwortlichen Gase Kohlendioxid, Methan, Lachgas und anderen wird dieser verstärkt [IPCC 2007a: 2ff.]. Aus dieser zusätzlichen – anthropogen bedingten – Verstärkung des natürlichen Treibhauseffektes leitet sich der Begriff des „anthropogenen Klimawandels“ ab. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird synonym als kürzere Form nur das Wort „Klimawandel“ verwendet.
3.1.2 Weiterführende Informationen und Literatur
Für eine – im Rahmen dieser Arbeit – ausführliche Darstellung der wissenschaftlichen Grundlagen dieses Themenkreises sowie der gegenwärtigen und zukünftig zu erwartenden Folgen der Klimaänderung sei auf die Anlage 1 verwiesen. Einen erschöpfenden Überblick über den aktuellen wissenschaftlichen Stand zum Thema Klimawandel geben die vier Publikationen des IPCC, die im Verlauf des Jahres 2007 erschienen:
- Report 1: “The Physical Science Basis“ zu den Ursachen und Charakteristiken des Klimawandels (komplett: IPCC 2007e, Zusammenfassung: IPCC 2007a)
- Report 2: “Climate Change Impacts, Adaption and Vulnerability“ zu ökologischen und ökonomischen Verwundbarkeiten durch den Klimawandel (komplett: IPCC 2007f, Zusammenfassung: IPCC 2007b)
- Report 3: “Mitigation of Climate Change“ zu Maßnahmen zur Abschwächung der erwarteten Auswirkungen des Klimawandels (komplett: IPCC 2007g, Zusammenfassung: IPCC 2007c)
- Report 4: “Synthesis Report“ für eine integrierte Betrachtung der Thematik unter Einbeziehung der drei vorhergehenden Teilreporte (komplett: IPCC 2007h, Zusammenfassung: IPCC 2007d)
3.2 Globale ökonomische Folgen
Die Problematik des Klimawandels wurde bereits 1979 in einer UN-Weltklimakonferenz thematisiert. Das Gipfeltreffen in Rio de Janeiro 1992 legte sich auf die Zielsetzung fest, die Treibhausgaskonzentrationen zu stabilisieren. Das 1997 verabschiedete Kyoto- Protokoll setzte erstmals verbindliche Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Die Industrienationen verpflichteten sich, diese bis zum Jahr 2012 um 5,2 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 zu reduzieren [Stern 2007: 514 f.]. Die Wirtschaft muss also handeln, doch auf welcher Grundlage?
Die umfassendste Analyse möglicher Auswirkungen des Klimawandels auf die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft bietet die Veröffentlichung “The Economics of Climate Change“, die im Auftrag der britischen Regierung vom ehemaligen Chefökonomen der Weltbank Sir Nicholas Stern herausgegeben wurde.[5] Im Zentrum dieser Veröffentlichung stehen neben der Betrachtung von business as usual (BAU) Szenarien[6] die Kosten der Stabilisierung der Treibhausgasemissionen sowie Strategien zur Abschwächung unvermeidbarer Folgen des Klimawandels, mögliche Anpassungsmaßnahmen und zukünftige nachhaltige Handlungsalternativen [Stern2007]. Nachfolgend werden die Kernaussagen in knapper Form vorgestellt.
Sollten keine Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels ergriffen werden, so würden die daraus resultierenden jährlichen Einbußen für das globale BIP am Ende dieses Jahrhunderts mindestens fünf Prozent betragen. Zusätzliche Risiken umfassen u.a. direkte Auswirkungen des Klimawandels auf Umwelt und menschliche Gesundheit, Risiken sozialer und politischer Instabilität, abrupte Änderungen des Klimasystems (z.B. Zusammenbruch des Golfstroms, Austrocknen des Amazonas) sowie eine veränderte Gewichtung des Verhältnisses entwickelter zu wenig entwickelten Staaten. Werden diese Risiken einkalkuliert, so ist eine jährliche Abschwächung des BIP um 20 und mehr Prozentpunkte möglich. Am stärksten betroffen wären die Entwicklungsländer, die am geringsten zur Erwärmung des Klimas beitragen [Stern 2007: xv, 161 f.].
Frühzeitiges Handeln hingegen würde deutlich geringere Kosten verursachen. Vielen Wissenschaftlern zufolge gilt eine Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur um mehr als 2K[7] als in ihren ökologischen und ökonomischen Folgen kaum noch beherrschbar. Bei sofortigem, entschlossenem Handeln der Treibhausgasemittenten sind die Kosten zur Unterschreitung dieser Marke mit unter einem Prozent des jährlichen globalen BIP deutlich geringer als die Folgekosten einer unkontrollierten Erwärmung.
Um den Wert von 2K nicht zu überschreiten, ist eine Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration auf unter 550ppm CO2e zwingend notwendig. Hierfür ist bis 2050 ein Rückgang der globalen Treibhausgasemissionen im Vergleich zum gegenwärtigen Niveau um mindestens 25Prozent notwendig [Stern 2007: xvf., 318ff.].
Treibhausgase werden zur Darstellung des gesamten anthropogenen Klimaeinflusses in äquivalente Kohlendioxideinheiten (CO2e) umgerechnet. Dieser Terminus steht dabei für das globale Erwärmungspotenzial bezogen auf das von CO2. Für das CO2 als Basisgröße ergibt sich der Wert eins, für die meisten anderen Spurengase werden deutlich höhere Werte angegeben. Trotz dessen ist das CO2 aufgrund seiner Häufigkeit das mit Abstand am stärksten wirkende Treibhausgas [Stern 2007: 224]. Eine Darstellung der äquivalenten CO2-Werte wichtiger Spurengase zeigt Tabelle 3-1.[8]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3-1: Darstellung der CO2e-Werte wichtiger Spurengase
Quelle: eigene Darstellung, nach Ramaswamy et al. in Stern 2007: 224
Alle Länder sollten die Entwicklung zu einer klimaschonenden Industrie mittragen. Die Industrieländer müssen die ärmeren Nationen bei der Entwicklung kohlenstoffarmer Technologien jedoch unterstützen, z.B. über den Clean Development Mechanism (CDM). Dieser im Kyoto-Protokoll verankerte Mechanismus erlaubt Unternehmen in Industrienationen höhere Emissionen, wenn diese gleichzeitig Projekte zur Minderung von Kohlenstoffemissionen in Entwicklungsländern unterstützen[9]. Gleichzeitig entstehen dadurch auch neue wirtschaftliche Möglichkeiten [Stern 2007: xvi f.]. Die Aussage ist daher eindeutig: “Tackling climate change is the pro-growth strategy for the longer term“ [Stern 2007: xvii].
Für ein wirksames und nachhaltiges globales Handeln gegen den anthropogen verursachten Klimawandel sind u.a. folgende Elemente notwendig:
- die Bepreisung des Kohlenstoffes und der Einstieg in den Emissionshandel
- die Förderung von Investitionen in nachhaltige, kohlenstoffarme Technologien
- internationale Kooperationen im Bereich Forschung und Entwicklung
- die Steigerung der globalen Energieeffizienz
- die Reduzierung der Abholzung von Wäldern und Regenwäldern sowie
- die Bereitschaft des Einzelnen zum Handeln [Stern xvii f.].
All diese Elemente werden einen Klimawandel nicht verhindern, sondern dessen Auswirkungen nur noch abschwächen können. Eine Anpassung an nicht mehr zu vermeidende Veränderungen ist daher in jedem Fall notwendig.
3.3 Ökonomische Folgen für Deutschland
Am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW) wurden unter Leitung von Prof. Claudia Kemfert Modellrechnungen durchgeführt, welche Kosten in welchen Wirtschaftsbereichen aufgrund des Klimawandels auf Deutschland zukommen könnten. Dabei wurden volkswirtschaftliche Modelle mit Klimamodellen gekoppelt und Berechnungen auf jährlicher Basis bis zum Jahr 2100 vorgenommen. Grundlage waren die Klimaszenarien des IPCC. Für die Annahme einer Temperaturerhöhung um 4,5 K bis zum Jahr 2100 würden bereits bis zum Jahr 2050 Kosten in Höhe von bis zu 800 Mrd. Euro entstehen. Dabei würden die durch Klimaschäden – insbesondere der Zunahme extremer Klimaereignisse – verursachten Kosten mit ca. 330 Mrd. Euro am stärksten zu dieser Summe beitragen. Die weiteren Kosten entstünden durch erhöhte Energiekosten (ca. 300 Mrd. Euro) und Anpassungskosten (ca. 170 Mrd. Euro). Damit verbunden wären jährliche Einbußen beim Wachstum des BIP von bis zu 0,5Prozent. Bis zum Jahr 2100 würden die entstehenden Kosten bis zu 3.000 Mrd. Euro betragen, deren Anstieg würde sich im Laufe der Zeit also beschleunigen [Kemfert 2007].
Die Auswirkungen des Klimawandels wurden für die Sektoren Land- und Forstwirtschaft, den Tourismus, das Gesundheitswesen, den Energiebereich, das Verkehrswesen und das Baugewerbe berechnet. Nachfolgend wird nur der Bereich Tourismus betrachtet. Bis 2050 ist nach dem obigen Szenario mit Anpassungskosten von 11 Mrd. Euro und Schäden von 19 Mrd. Euro zu rechnen. Zudem soll bereits bei einer Temperaturzunahme von 1K in 60Prozent der heutigen Wintersportgebiete Deutschlands kein wirtschaftlich tragfähiger Betrieb mehr möglich sein. Im Falle eines Temperaturanstieges von 4,5K wären sämtliche Wintersportgebiete betroffen [Kemfert2007]. Aufgrund der hohen Wertschöpfung des Wintertourismus [Klein 2007: 46] ist in den stark auf diesen Bereich spezialisierten Regionen mit großen Verlusten im Tourismusbereich zu rechnen. Für Österreich bspw. wird pro Grad Erwärmung ein Rückgang des gesamten BIP um bis zu zwei Prozent[10] vorhergesagt [Breiling in Klein 2007: 56].
4 Klimatische Verhältnisse als Grundlage des Wintertourismus
4.1 Großräumige klimatische Einflussfaktoren im Winter
4.1.1 Die Nordatlantische Oszillation
In Kapitel 4 werden die für den Wintertourismus relevanten klimatischen Verhältnisse in Sachsen und Trends ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklung betrachtet.
Die „Wetterküche“ Sachsens befindet sich über dem Atlantik. Einen entscheidenden Einfluss auf das mitteleuropäische Witterungsgeschehen – vor allem im Winter[11] – hat die Nordatlantische Oszillation (NAO). Fast ein Drittel der Temperaturvariabilität der nördlichen Hemisphäre kann durch dieses Phänomen erklärt werden. Auch das sächsische Klima wird von dem Zusammenspiel aus tiefem Luftdruck im Raum Island (Islandtief) und hohem Luftdruck südwestlich der Iberischen Halbinsel (Azorenhoch) geprägt. Der NAO-Index quantifiziert den Betrag dieser Druckdifferenz für zwei Standorte in der Nähe der mittleren Druckzentren[12] [Livingstone 2004: 23].
Abbildung4-1 stellt die Nordatlantische Oszillation als vereinfachte Zeichnung der Druckzentren dar. Islandtief und Azorenhoch sind mit der charakteristischen Lage ihres Zentrums eingezeichnet. Das rote Kreuz markiert die Lage von Sachsen. Verlagern sich beide Druckgebilde gegenüber ihrer mittleren Position nach Norden, so tritt eine Intensivierung derselben ein: der Luftdruck des Azorenhochs ist höher als im langjährigen Durchschnitt, der des Islandtiefs niedriger – der NAO-Index ist positiv. Aus dieser Konstellation eines starken meridionalen Druckgradienten[13] wird in einer kräftigen Westwindströmung milde und feuchte Meeresluft nach Mittel- und Nordeuropa geführt [Livingstone 2004: 23f., DWD 2003]. Wintersport ist in solchen Wintern nur in den oberen Berglagen möglich, selbst in Regionen wie dem Fichtelberggebiet kann bis in die Gipfellagen Regen fallen. Der in Sachsen extrem warme Winter 2006/07 steht beispielhaft für einen positiven NAO-Index.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung4-1:Verteilung des mittleren Luftdrucks auf Meereshöhe über dem Nordatlantik im Januar für die Periode 1941-1970
Quelle: bearbeitet nach Livingstone 2004: 23
Mit einer Südwärtsverlagerung der Druckgebilde geht eine Abschwächung dieser einher – der NAO-Index ist negativ. Es treten gehäuft kältere und trockenere Winter auf. Die winterliche Kaltluftproduktion wird aufgrund schwacher Winde über Osteuropa weniger gestört; diese Kälte kann sich Richtung Westen ausbreiten [Livingstone 2004: 23f., DWD 2003]. Der in Sachsen zu kalte Winter 2005/06 trat in einer negativen Anomalie des NAO-Index auf. In sehr seltenen Fällen – zuletzt im kältesten mitteleuropäischen Winter des 20. Jahrhunderts 1962/63 – kann sich die normale Druckverteilung umkehren. Polare Luftmassen können so bis nach Südeuropa vorstoßen [Livingstone 2004: 24]. Trotz im Verhältnis zum langjährigen Mittelwert meist geringerer Niederschläge – die jedoch überwiegend als Schnee fallen – sind die Wintersportbedingungen in Wintern mit negativem NAO-Index in Sachsen zumeist gut bis hervorragend.
Im 20. Jahrhundert war die längste Negativperiode des NAO-Index zwischen den 1950er Jahren und den beginnenden 1970er Jahren zu verzeichnen. In dieser Zeit traten im Alpen- und Mittelgebirgsraum viele kalte und schneereiche Winter auf. Diese bildeten die Grundlage für viele Skiliftplanungen. Mitte der 1970er Jahre wurde diese Episode von der bisher längsten positiven Phase des NAO-Index abgelöst, womit gehäuft milde Winter und vor allem im Mittelgebirgsraum schlechte Schneeverhältnisse verbunden waren und sind [Pfister 1999:54].
Wissenschaftliche Untersuchungen gehen davon aus, dass mit einer weiteren Verstärkung des anthropogenen Treibhaussignals eine Stabilisierung des NAO-Index um einen positiven Mittelwert wahrscheinlich ist. Ein Grund dafür ist, dass sich aufgrund des noch vorhandenen Land- und Meereises das Meerwasser in den höheren Breiten langsamer als in den mittleren Breiten erwärmt. Diese Verschärfung des Temperaturgegensatzes bewirkt ebenso eine Verstärkung der Druckgegensätze [Paeth 2000: 149, Paeth in Schneider/Saurer/Schönbein 2005: 19]. Zusätzlich ist durch das geringere Kältepotenzial schneearmer Winter in Osteuropa das osteuropäische Kältehoch bereits heute zunehmend schwächer ausgeprägt. Folglich sinkt dessen blockierende Wirkung gegenüber milden atlantischen Luftmassen. Diese Tendenz wird sich in einem wärmeren Klima verstärken [MunichRe 2001:107]. Damit dürfte der Trend zu milderen Wintern in Mitteleuropa auch und vor allem unter Einbeziehung des regionalen Phänomens der Nordatlantischen Oszillation anhalten.
4.1.2 Die Großwetterlagen/Großwettertypen
Es wurde dargestellt, dass die Nordatlantische Oszillation einen bedeutsamen Faktor für die Ausprägung der Winterwitterung in Sachsen vorgibt. Großwetterlagen (GWL) bestimmen detaillierter über die sächsische Winterwitterung. Sie wurden vom Begründer dieser Theorie, Franz Baur,[14] als „die mittlere Luftdruckverteilung eines Großraumes, mindestens von der Größe Europas während eines mehrtägigen Zeitraumes“[15] definiert [Baur in Gerstengarbe/Werner 1999: 7]. Aufgrund der vorherrschenden Bodendruck-gebiete in Europa wird der jeweiligen Wettersituation jeden Tages eine von 29 Wetterlagenklassen zugeordnet.[16] Für eine Beschreibung der Großwetterlagen sei auf das Standardwerk „Katalog der Großwetterlagen Europas“ [Gerstengarbe/Werner 1999] verwiesen. Mehrere verwandte Großwetterlagen lassen sich zu einem sog. Großwettertyp (GWT) zusammenfassen. Die Großwettertpyen orientieren sich an der Richtung, aus der die Luftmassen nach Europa bzw. im konkreten Fall Sachsen geführt werden [Gerstengarbe/Werner 1999: 10].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung4-2a:Mittlere Häufigkeit der Großwettertypen in den zehn an der Station Fichtelberg/ Sachsen kältesten bzw. wärmsten Wintern im Zeitraum 1916/17-2006/07 im Vergleich zum lang-jährigen Mittelwert ihres Auftretens
Abbildung4-2b: Mittlere Temperaturabweichung der einzelnen Großwettertypen in den Wintern des Zeitraumes 1916/17-2006/07 an der Station Fichtelberg/Sachsen
Quelle: eigene Berechnungen; Datenquelle: DWD Fichtelberg
Um die Bedeutung der Herkunft der Luftmassen für die Winterwitterung in Sachsen zu untersuchen, wurden am Beispiel der Bergwetterstation Fichtelberg[17] die zehn kältesten und die zehn wärmsten Winter des Zeitraumes 1916/17 bis 2006/07 ermittelt. Für diese sowie den 91-jährigen Gesamtzeitraum wurde der Mittelwert der Auftrittshäufigkeit aller zehn Großwettertypen gebildet (vgl. Abbildung4-2a). In Abbildung4-2b ist die mittlere Temperaturabweichung je GWT dargestellt. Nähere Informationen zu der den Abbildungen zugrunde liegenden Methodik sowie ergänzende Darstellungen befinden sich in Anlage 2.
In milden Wintern dominiert der Großwettertyp West deutlich. Ebenso treten Südwest- und Hochdrucklagen über Mitteleuropa verstärkt auf. In kalten Wintern überwiegt dagegen die Luftzufuhr aus östlichen Richtungen. Auch Nord-, Nordost- und Südostlagen kommen gehäuft vor. Die im Winter im langjährigen Mittel an einem von drei Tagen zu erwartenden Westwetterlagen treten hingegen deutlich weniger auf. Im Vergleich mit den angegebenen mittleren Temperaturanomalien wird deutlich, dass „warme“ Großwetter-lagen in milden, „kalte“ hingegen in frostigen Wintern dominieren. Dies belegt die Bedeutung der Großwetterlagen/Großwettertypen für die sächsische Winterwitterung.
Die Zunahme sehr milder Winter in den vergangenen Jahrzehnten korreliert mit einem Anstieg der warmen Großwettertypen West und Südwest. Der Anstieg dieser Häufigkeiten wird durch die anhaltend positive Anomalie des NAO-Index begünstigt. Eine Fortsetzung dieser Entwicklung ist daher wahrscheinlich.
4.2 Variablen des sächsischen Mittelgebirgsklimas
Im Bergland nehmen Temperaturen allgemein mit der Höhe ab, Niederschläge zu, weshalb Andauer und Mächtigkeit der Schneebedeckung ebenfalls mit der Höhe zunehmen müssen. Sachsen liegt im Übergangsbereich zwischen dem maritimen Einfluss von Atlantik, Nord- und Ostsee (gemäßigter Jahresgang von Temperatur und Niederschlag) und dem kontinentalen Klima Osteuropas (deutlicher Jahresgang der Temperatur und Niederschlagsmaximum – bedingt durch den dominierenden Einfluss konvektiver Prozesse – im Sommer) [Hupfer 1998: 243; Kowalke 2000: 74ff.]. Der Charakter des Klimas der sächsischen Mittelgebirge ist daher durch eine von West nach Ost ansteigende Kontinentalität bestimmt. Dieser Faktor drückt sich bspw. in einer – auf gleicher Höhenlage – zunehmenden Winterstrenge und längeren Andauer der Schneedecke aus. Weiterhin sind ausgeprägte Luv- und Leewirkungen[18] sowie eine deutliche Stufung der Temperaturen, Niederschläge und Schneehöhen mit der Höhe zu erkennen [Kowalke 2000: 74f.]. Abbildung 4-3 belegt diese Höhenstufung anhand des Parameters Temperatur für die Verteilung der mittleren Wintertemperatur in Sachsen im Zeitraum 1981 bis 2000. Durchschnittliche Temperaturen unter 0°C sind nur noch im Mittelgebirgsraum zu finden, Werte von unter -3°C treten nur noch im Bereich der Wetterstationen Fichtelberg und Zinnwald auf.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4-3: Verteilung der mittleren Wintertemperatur im Zeitraum 1981-2000
Quelle: eigene Darstellung; Datenquelle: Sächsische Klimadatenbank
Tiefgründigere Informationen zu den klimatischen Parametern für Sachsen geben Kowalke [2000] sowie, speziell für das Erzgebirge, eine Publikation der ehemaligen Wetterdienste der CSSR und der DDR[19].
4.3 Natürliche Schneebedeckung und Schneesicherheit
Zur Bewertung der Wintersporteignung einer Region wird häufig deren Schneesicherheit betrachtet. Diese ist letztlich eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die einem wirtschaftlichen Betrieb von Liftanlagen zugrunde liegt. In einer häufig zu findenden Definition für die Alpen wird ein alpines Skigebiet als schneesicher bezeichnet, wenn in mindestens sieben von zehn Wintern an wenigstens 100 Tagen während einer festgelegten Zeitspanne[20] eine für den alpinen Skisport ausreichende Schneedecke[21] von mindestens 30 cm, für den Skilanglauf von 15 cm liegt [Abegg in Elsasser/Bürki 2007: 867, Müller 2007: 127]. Nach dieser Regel wäre in Sachsen mit im Durchschnitt der Jahre ab 1951 acht von zehn Wintern bis 1980 und sechs von zehn Wintern danach nur das Gebiet um den Fichtelberg (noch) schneesicher und ein alpiner Skibetrieb wirtschaftlich rentabel [DWD Fichtelberg]. Dies passt zu der gegenwärtig für die Alpen definierten Höhengrenze der Schneesicherheit von 1.200m über NN [Elsasser/Bürki 2007: 868]. In den kleineren Skigebieten der Mittelgebirge reichen jedoch meist deutlich weniger als 100 Tage und zum Teil auch geringere Schneehöhen aus, um Gewinne erwirtschaften zu können. Roth et al. [2001: IV] geben für das Sauerland den Wert von 80 Tagen für modernisierte Abfahrtskigebiete an. Seifert [2004: 87] nennt für das Fichtelgebirge den Durchschnittswert von 50-60 Tagen, nach denen ein alpiner Skibetrieb an einer durchschnittlichen Anlage noch rentabel sei.
Zur allgemeinen Bewertung der Wintersportmöglichkeiten hat sich die Einteilung der Schneehöhenstufen nach Peppler [bspw. in Fojt 1974: 2] bewährt:
- Schneehöhe mindestens 10 cm: Skilauf möglich
- Schneehöhe mindestens 20 cm: gute Wintersportmöglichkeiten
- Schneehöhe mindestens 30 cm: sehr gute Wintersportmöglichkeiten
- Schneehöhe mindestens 40 cm: ausgezeichnete Wintersportmöglichkeiten
Bis auf das Skigebiet Lausche befinden sich die Wintersportgebiete in Oberlausitz und Sächsischer Schweiz weitgehend unter 600m über NN [vgl. Kapitel 6.4, Abbildung6-3]. Zwar ist hier von November bis März häufig eine Schneedecke vorhanden, diese schmilzt aufgrund winterlicher Warmlufteinbrüche jedoch gelegentlich wieder ab. Konstante Wintersportbedingungen in der gesamten kalten Jahreszeit sind selten, Wintersport ist daher meist nur mit Unterbrechungen möglich. Die Skigebiete in Erzgebirge und Vogtland liegen zumeist höher.[22] In den Lagen bis unter 1.000m über NN schmilzt die vorhandene Winterdecke bei Tauwetter zwar in (bisher) seltenen Fällen ab, akkumuliert sich im Allgemeinen jedoch mit zunehmender Höhe bis in den März hinein [Kowalke 2000: 79f.]. Dass sich die Bedingungen für den schneegebundenen Wintertourismus in Sachsen jedoch vor allem in den Höhenlagen unter 800m über NN in den Jahren von 1960 bis 2000 verschlechtert haben, zeigt die umfangreiche Untersuchung von Freydank [2001].
Die Gipfellagen über 1.000m über NN verzeichnen im Durchschnitt von Oktober oder November bis in den April hinein eine geschlossene Schneedecke, die erst im März ihre größte Mächtigkeit erreicht [Kowalke 2000: 79f., Fojt 1974[23] ]. Dennoch verschlechtern sich auch dort die Schneeverhältnisse, wie Abbildung 4-4 anhand der Veränderung der mittleren Schneehöhe für den Fichtelberg illustriert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung4-4:Jahresgang der mittleren Schneehöhe auf dem Fichtelberg im Vergleich der Zeiträume 1951-1980 und 1981-2007.
Quelle: eigene Berechnungen; Datenquelle: DWD Fichtelberg
Zum Beispiel tritt dort in der Periode von 1981 bis 2007 die mächtigste Schneedecke ca. 20 Tage eher als im vorherigen Zeitraum von 1951 bis 1980 auf und ist mit 100cm Höhe etwa 25cm niedriger als zuvor.
4.4 Technische Beschneiung
Im Zuge der Bewertung des Wintersportpotenzials einer Region kann die natürliche Schneebedeckung nicht mehr als einziger Parameter dienen. Zur Sicherung der Saison ist die technische Beschneiung in vielen Skigebieten nicht mehr wegzudenken Die Eignung eines Gebietes für den (vor allem alpinen) Wintersport ergibt sich daher heute aus der Kombination von natürlicher Schneedecke und technischen Beschneiungsmöglichkeiten [Schneider/Schönbein 2006: 7]. So sind mittlerweile 90Prozent aller Skigroßräume der Alpen mit Schneekanonen ausgerüstet [Gerl 2006] und auch in Sachsen steigt die Anzahl der technisch beschneiten Pisten [vgl. TMGS 2007b: 50 ff.].
Beschneiungsanlagen imitieren den natürlichen Prozess der Schneebildung. Dazu wird Wasser in winzige Tröpfchen zerstäubt. Diese gefrieren an winzigen Schwebeteilchen – den sog. Kristallisationskeimen – und bilden Eiskristalle von weniger als einem Zehntel Millimeter Durchmesser. Diese verbinden sich und fallen als Schneeflocken auf die Skipiste. Je höher die umgebende Luftfeuchtigkeit, desto niedrigere Temperaturen werden zur Schneeerzeugung benötigt[24] [Gerl 2006, Schneider/Saurer/Schönbein 2005: 19].
Der zusätzliche, künstlich erzeugte Schnee bietet zusammen mit einer behutsamen Präparierung der Schneedecke die Möglichkeit, die Wintersporteignung eines Gebietes deutlich zu verbessern. Die Widerstandsfähigkeit gegenüber Auftauphasen steigt – maßgeblich auch aufgrund der höheren Dichte des technisch erzeugten Schnees – deutlich an [Schneider/Schönbein 2006: 7]. Andererseits erhöht die technische Beschneiung die Kosten zur Betreibung eines Skigebietes signifikant,[25] zumal diese im Zuge der bereits eingetretenen und zu erwartenden weiteren Erwärmung weiter ansteigen werden, während gleichzeitig die Anzahl der Tage, an denen die künstliche Schneeerzeugung möglich ist, sinkt [OECD 2007: 4]. In der Studie von Schneider und Schönbein zur Schneesicherheit und Beschneibarkeit in deutschen Mittelgebirgen [2006: 26, 54ff.] gehen beide Parameter – natürliche Schneesicherheit und Beschneibarkeit – bis zum Jahr 2025 in allen verwendeten Szenarien[26] und Gebieten zum Teil deutlich zurück. Die bereits gegenwärtig sinkende Eignung der sächsischen Mittelgebirge für die Ausübung von Skisport sowie anderen schneegebundenen Aktivitäten wird also voraussichtlich weiter abnehmen. Insbesondere in den Höhenlagen unter 900m über NN (dies betrifft alle sächsischen Alpinskigebiete mit Ausnahme von Oberwiesenthal/Fichtelberg) werden sich in den kommenden Jahrzehnten nur „ausgesuchte Standorte mit besonderer Infrastruktur oder besonderem Lokalklima“ halten können [Schneider/Schönbein 2006: 28].
4.5 Klimaprojektionen und -szenarien: Ausblick bis 2050
Klimaprojektionen sind „Projektionen des künftigen Klimas in Abhängigkeit von möglichen Verhaltensweisen der menschlichen Gesellschaft“ [SMUL 2005: 27]. Die Klimaprojektionen für Sachsen basieren auf den IPCC-Szenarien der zukünftigen globalen gesellschaftlichen Entwicklung und dem damit verbundenen Ausstoß von Treibhausgasen [vgl. Kapitel 5.1 in Anlage 1, IPCC 2007a: 18]. Im Fokus steht die regionale Ausprägung der zu erwartenden Klimaänderungen in Sachsen. Für regionale Projektionen wird u.a. das statistische Regionalisierungsverfahren WEREX[27] eingesetzt.
Nach den neuesten Modellprojektionen für Sachsen sind im Durchschnitt der Modelle bis zum Jahr 2050 zwei bis 2,5K Erwärmung im Winter zu erwarten [Mellentin 2008]. Abbildung 4-5 zeigt die winterliche Erwärmung im Szenario A1B für die Periode 2041- 2060, dargestellt als Differenz zum Zeitraum 1981-2000. Sie liegt für dieses Szenario im sächsischen Flächenmittel bei 2,6K. Der Schneeanteil unter den Niederschlägen wird somit auch im Gebirge in allen Höhenlagen weiter zurückgehen. Erkennbar ist jedoch, dass die Erwärmung in den Kammlagen mit punktuell weniger als 2K Erwärmung langsamer als im Tiefland voranschreitet, wo bis annähernd 3K höhere Temperaturen erwartet werden. Eine Ursache dafür ist möglicherweise die weiter zunehmende Zyklonalität, die die Bildung von im Flachland kalten, in den Bergen – die sich häufig über der Inversionsgrenze befinden – warmen Inversionswetterlagen stärker als bisher behindert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4-5: Winterliche Differenz der Temperatur der Periode 2041-2060 (Projektion im Szenario A1B) zur Periode 1981-2000
Quelle: eigene Darstellung; Datenquelle: Sächsische Klimadatenbank
Die natürliche Schneesicherheit nach der 100-Tage-Regel verschiebt sich mit jedem Grad Erwärmung um etwa 150 m[28] nach oben [Elsasser/Bürki 2007: 868], zusätzlich sinkt die Anzahl der Tage, an denen eine technische Beschneiung möglich sein wird, deutlich ab. Langfristig wird daher also selbst in den (noch) schneereichen Gebieten des oberen Erzgebirges ein wirtschaftlich tragfähiger Skibetrieb kaum noch möglich sein.
5 Tourismus und Wintertourismus in Sachsen
5.1 Tourismus und touristische Vermarktungsstruktur
Die Tourismuswirtschaft ist eine Querschnittsbranche, die sich aus einer Vielzahl von Leistungen aus unterschiedlichen Bereichen der Volkswirtschaft zusammensetzt und sich über das „Reisen“ als Nachfragezweck definiert. Der Deutsche Tourismusverband gibt den Anteil der in Deutschland vom Tourismus abhängigen Arbeitsplätze mit acht Prozent an [DTV 2007: 2] und unterstreicht damit dessen hohe volkswirtschaftliche Bedeutung. Fast 200 Mio. Besuchstage[29] konnte Sachsen im Jahr 2005 registrieren. Der daraus generierte Bruttoumsatz betrug ca. 6,2 Mrd. Euro.[30] Eine herausragende Position nimmt dabei der Tagestourismus mit 158 Mio. Tagesreisen und ca. 4,0 Mrd. Euro Bruttoumsatz[31] ein [nach Berechnungen des DWIF, in LTV/SLFS 2007: 5], eine Form des Tourismus, die in vielen Veröffentlichungen der Branche trotz ihrer Bedeutung immer noch vernachlässigt wird. Die höchste Tourismusintensität (Übernachtungen je 1.000 Einwohner) ist in den mittelgebirglich geprägten Landkreisen Sächsische Schweiz, Weißeritzkreis und Annaberg zu verzeichnen [SLFS 2007b].
„ Sachsen. Land von Welt “. Mit diesem Slogan wirbt der Freistaat seit dem Jahr 2006 im In- und Ausland um Besucher. Geschichte und Kultur werden damit als gewisses Alleinstellungsmerkmal für Sachsen vermarktet. [TMGS 2007a: 8]. Um ein professionelles und einheitliches touristisches Marketing in Sachsen zu betreiben und konsequent am Markt auszurichten, wurde 1999 die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS) gegründet. Diese präsentiert Sachsen als Urlaubs- und Reiseland im In- und besonders im Ausland und kann auf Veränderungen in der Nachfragestruktur schnell und unkompliziert reagieren. Die Zentralisierung war notwendig, um die kleineren regionalen Organisationen von dieser Aufgabe entlasten zu können. Deren Marketing soll sich somit auf den regionalen Bereich konzentrieren [SMWA 2007: 22]. Dessen ungeachtet kritisiert eine aktuelle Studie des BMVBS/BBR[32] zur touristischen Entwicklung in den neuen Bundesländern immer noch zum Teil ineffiziente Vermarktungsstrukturen: „Zu viele Organisationen auf kommunaler und regionaler Ebene präsentieren sich auf dem Markt im Kampf um die Gäste“ [BMVBS/BBR 2007: 4]. Eine Übersicht über die gegenwärtigen touristischen Marketingstrukturen in Sachsen gibt Abbildung 5-1.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5-1: Touristische Vermarktungsstruktur des Regionalmarketings in Sachsen
Quelle: eigene Darstellung
Die Dachorganisation der TMGS ist der Landestourismusverband (LTV). Dessen Arbeitsschwerpunkt liegt seit der Gründung der TMGS allerdings im Innenmarketing, d.h. der Zusammenarbeit mit den Regionalverbänden und touristischen Leistungsträgern. Diese sind für eine differenzierte Darstellung der Regionen unter der Dachmarke „Sachsen. Land von Welt“ zuständig [SMWA 2007: 26f.]. Die öffentlichen und privaten Anbieter touristischer Dienstleistungen vor Ort bilden die Basis und Schnittstelle zum Kunden (dem Touristen). Auf ihren Ausflügen kommen die Gäste vor allem mit diesen in Verbindung. Eine positive oder negative Gesamtbeurteilung der Reise hängt also maßgeblich von dem von den Anbietern vor Ort gebotenen Serviceumfang und dessen Qualität ab.
Sachsen konnte seit der Wendezeit in den Augen der Nachfrager ein eigenständiges touristisches Profil vor allem im Bereich Kultur- und Städtereisen entwickeln [BMVBS/BBR 2007: 4]. Ergänzend soll Interesse für weitere Reisethemen geweckt werden. Dazu zählen Vitalurlaub & Wellness, Familien- und Aktivurlaub. Unter letzterem Oberbegriff wird der „Winterurlaub in Sachsen“ vermarktet [TMGS 2007a: 9f.].
5.2 Bedeutung des (Winter-)tourismus für die sächsischen Mittelgebirge und insbesondere das Erzgebirge
Von den Urlaubsreisen der Deutschen ab einer Länge von fünf Tagen führten im Jahr 2005 sechs Prozent – dies entspricht 3,8 Mio. Reisen – in die deutschen Mittelgebirge. Dieser Anteil blieb über die vergangenen Jahre relativ stabil, nachdem in den Jahren nach der Deutschen Einheit ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war. Sachsen positioniert sich im Segment der Mittelgebirgsreisen innerhalb von Deutschland mit einem Anteil von elf Prozent auf dem vierten Rang. Knapp die Hälfte der Übernachtungen konnte dabei das Erzgebirge auf sich vereinigen [TMGS/NIT 2006: 8ff.]. Die offiziellen Beherbergungs-statistiken geben nur die Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben ab neun Betten an. Eine Studie im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Südwestsachsen beziffert die Gesamtzahl der Übernachtungen im Erzgebirge im Jahr 2006 auf insgesamt 10,7 Mio. Nur 28Prozent davon sind in der offiziellen Statistik erfasst, der Großteil entfällt auf Verwandten- und Bekanntenbesuche (57Prozent bzw. 6,1 Mio. Übernachtungen). Hinzu kommen ca. 23 Mio. Tagesreisen, so dass für das Jahr 2006 insgesamt mit 33,7 Mio. touristischen Aufenthaltstagen gerechnet werden kann. Dabei werden im Durchschnitt pro Kopf und Tag 26,20 Euro ausgegeben. Der dabei generierte Bruttoumsatz beläuft sich auf ca. 883 Mio. Euro. Etwa 14 Prozent der touristischen Einnahmen Sachsens werden demzufolge im Erzgebirge erwirtschaftet. Das berechnete Einkommen aus der Tourismuswirtschaft im Erzgebirge liegt pro Jahr und Einwohner bei 560 Euro [IHK Südwestsachsen 2007:5ff.].
Laut einer Untersuchung von Harrer[33] aus dem Jahr 1996 [S.57] finden dabei ca. 44Prozent der Übernachtungen im Winterhalbjahr (November bis April) statt. Damit liegt das Erzgebirge unter den untersuchten deutschen Bergregionen an der Spitze, was die Bedeutung der Wintersaison für dieses Gebiet unterstreicht. Diese ist jedoch stark schneeabhängig. Ein Blick auf die offizielle Übernachtungsstatistik[34] der sehr milden Wintersaison 2006/07 im Vergleich zur relativ kalten und schneereichen Periode 2005/06 verdeutlicht diese Abhängigkeit. Während die Übernachtungen in Sachsen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ca. zwei Prozent anstiegen, sanken sie im Erzgebirge um 4,6Prozent ab. Die Sächsische Schweiz als Mittelgebirgsraum ohne bedeutende Skiinfrastruktur konnte hingegen einen Anstieg um 5,5Prozent vermelden [SLFS 2007c]. Die Hauptaktivitäten liegen dort im Bereich Sightseeing, Wandern und Klettern – Aktivitäten, die bei mildem Winterwetter besser auszuüben sind als bei kalten Temperaturen und verschneiten Felsen.
Acht Prozent der deutschen Bevölkerung sind an Wintersport interessiert [Roth/Prinz/Krämer 2005: 10]. Für die sächsischen Mittelgebirgsregionen gilt es, dieser Zielgruppe möglichst attraktive Bedingungen zur Ausübung ihrer Aktivitäten zu bieten, um eine Abwanderung in andere Gebiete zu verhindern.
5.3 Alpine Skigebiete als „Leuchttürme“ des Wintertourismus
5.3.1 Historische Entwicklung des alpinen Skitourismus
Der Wintersporttourismus in Deutschland startete zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Am Anfang standen Skitouren ohne künstliche Aufstiegshilfen [Harrer 1996: 18]. Die ersten Seilbahnen Deutschlands entstanden zwar schon Ende des 19. Jahrhunderts,[35] hatten jedoch noch keine wintertouristische Bedeutung. Der erste Ski-Schlepplift wurde 1904 am Feldberg im Schwarzwald gebaut [VDS 2007a: 17]. Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfolgte ein großer Aufschwung des alpinen Skitourismus. Seine endgültige Bindung an Aufstiegshilfen erfolgte jedoch erst in den schneereichen 1960er und den darauf folgenden 1970er Jahren, als der Großteil der heutigen Anlagen geplant und gebaut wurde [Jülg 2007: 254, Harrer 1996: 18].
In Sachsen befördern heute sieben Seilschwebebahnen, zwei Standseilbahnen und 97 Schlepplifte Besucher auf die Berge. Während die Seilschwebe- und Standseilbahnen auch für den Ganzjahrestourismus geeignet sind, werden die Schlepplifte aufgrund ihrer Untergrundabhängigkeit bislang nur für den Skitourismus eingesetzt [VDS 2007a:6f.].
5.3.2 Heutige Bedeutung für den Wintertourismus
Die Bergbahnen sind ein Grund, weshalb der Wintertourismus für Gebirgsregionen gegenüber dem Sommerzeitraum (trotz im Winter höherer Betriebskosten) aufgrund seiner hohen Wertschöpfung interessant ist. Jülg gibt für Österreich pro Gast und Nacht im Winter um ein Drittel höhere Einnahmen an. Diese entstehen u.a. durch zusätzliche Ausgaben der Gäste im alpinen Wintersport für Skischulen, Skikurse und Seilbahnen. Davon profitieren die Gemeinden, die Wirtschaft und die Einwohner der Region durch höhere Einnahmen [Jülg 2007: 252]. Die touristischen Ausgaben im alpinen Wintersport fallen auch in Sachsen durch Übernachtungs- und Tagesgäste an, weshalb in Gemeinden mit alpinen Skiarealen – relativ zur Sommersaison – ebenfalls von einer höheren touristischen Wertschöpfung im Winter auszugehen ist. Eine zunehmende Schnee-unsicherheit in der kalten Jahreszeit könnte somit besonders im wintertouristisch gut erschlossenen Erzgebirge zu großen wirtschaftlichen Problemen führen.
5.3.3 Touristische Zielgruppen
Um zu erfahren, welche Bevölkerungsgruppen mit welchen Angeboten im Winter-tourismus erreicht werden, ist eine Einteilung in Zielgruppen sinnvoll. Roth et al. [2001: 90f.] geben dabei für den alpinen Wintersporttourismus in Deutschland folgende Zielgruppen an:
- Familien mit Kindern bis zehn Jahren: geringe Kaufkraft, möglichst kurze Anfahrtsstrecke zum Wintersportort, Bevorzugung von Anfängerskigebieten, Dienstleistungsangebote für Kinder (bspw. Unterhaltung, Betreuung) wichtig
- Familien mit Kindern über zehn Jahren: geringe Kaufkraft, zunehmender Einfluss der Kinder auf Freizeitentscheidungen, Nutzung von Skiarealen für Anfänger und Fortgeschrittene sowie im Trend liegende Wintersportarten wichtig
- Singles: hohe Kaufkraft, Freizeit- und Kurzreiseorientierung, Bevorzugung von Skiarealen für Fortgeschrittene und Könner, Unterhaltungs- und Aprèsski-Orientierung
- Jungsenioren (40+): sehr hohe Kaufkraft, zukünftig stark zunehmende Zielgruppe, hochwertige Dienstleistungen und Erlebnisqualität entscheidend, überproportionale Neigung zu Kurzreisen, Nutzung von Skiarealen für Fortgeschrittene mit hohem Maß an Naturerlebnis
Da sich die Skipisten in Sachsen vorwiegend im leichten und mittleren Schwierigkeitsgrad befinden, sind diese für Familien und Anfänger für Tagesausflüge, aber auch als Urlaubsziele interessant. Für die Zielgruppe der Jungsenioren, mehr noch jedoch der Singles, kommen die sächsischen Abfahrtskigebiete für Urlaubsreisen dagegen aufgrund ihrer gehobenen Ansprüche kaum in Frage. Als nahe gelegene Ausflugsmöglichkeiten bieten sie für diese dennoch Möglichkeiten zur kurzfristigen Ausübung von Wintersport-aktivitäten. Ein Mindestmaß an Komfort ist Voraussetzung, um für diese Gruppen das Mittelgebirge als interessante Alternative für Tages- und evtl. Mehrtagesausflüge als Ergänzung zu Skiurlauben im Hochgebirge zu positionieren.
5.4 Skilanglauf als wichtige Basis des Wintertourismus
Vor allem die nordischen Bewegungsformen entsprechen dem derzeitigen Trend der Fitness-, Wellness- und Gesundheitswelle und besitzen daher ein positives, modernes Image [Roth/Prinz/Krämer 2005: 10]. Aufgrund der geografischen und klimatischen Gegebenheiten bilden Skilanglauf und Skiwandern den Schwerpunkt des Wintersports in Sachsen. Selbst in Sachsens größter Alpinregion Oberwiesenthal waren im Jahr 1992 35Prozent der Besucher an Langlauf und Skiwandern interessiert [Dietz 1992]. Im Gegensatz zum alpinen Skisport verteilen sich die Langläufer auch innerhalb der Altersgruppen gleichmäßiger. Der Skilanglauf bildet also die Basis des Skisports in Sachsen, allerdings ist dessen Wertschöpfung schon aufgrund der zur Ausübung der Aktivität nicht benötigten Aufstiegshilfen deutlich geringer.
Roth et al. [2001: 97f.] geben folgende Zielgruppen für den Skilanglauf an:
- Familien und Anfänger: Spaß an der Bewegung und Naturerlebnis entscheidend, einfache Rundkurse ohne schwierige Abfahrten ausreichend, Abkürzungs-möglichkeiten gewünscht, Nähe zu Gastronomie und anderen Anlagen (bspw. Rodelhänge) vorteilhaft
- Skiwanderer: längere Rundstrecken sowie Fernloipen besonders attraktiv, Natur- und Landschaftserlebnis im Vordergrund, abwechslungsreiche Loipenführung, geringes bis mittleres Anforderungsniveau, Gastronomie erwünscht
- sportorientierte Läufer und Vereine: sportlicher Aspekt dominiert das Natur-erlebnis, Loipen differenzierter Längen, Anforderungsniveaus und Lauftechniken gewünscht
- fitnessorientierte Skilangläufer: Gesundheitstraining für Rehabilitationszwecke Auslegung der Loipen auf geringe körperliche Belastungsfähigkeit
Für all diese Zielgruppen sind in Sachsen Loipen und Skiwanderwege vorhanden. Für Skiwanderer lädt bspw. die Erzgebirgs-Skimagistrale von Zinnwald bis Schöneck im Vogtland zur Durchquerung des gesamten Erzgebirges ein. Aufgrund des Wegfalls der Grenzkontrollen nach Tschechien ergeben sich auch für grenzüberschreitende Verläufe von Loipen und Skiwanderwegen viele attraktive neue Möglichkeiten. Und Rundkurse sind bei geeigneter Schneelage auch in tieferen Lagen zu finden.
5.5 Weitere wintertouristische Aktivitäten und Entwicklungspotenzial
Die Broschüre „Wintertourismus in Sachsen“ der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen [TMGS 2007b] wirbt in Bild und Text fast ausschließlich mit schneegebundenen Aktivitäten. Neben den Hauptaktivitäten Ski alpin und Langlauf zählen klassische Angebote wie Winterwandern, Kutschfahrten im Schnee, Rodeln und Schneeschuh-wandern dazu. Aber auch innovative Ideen wie Pistenbullyfahrten, Nordic-Cruising und Nordic-Snow-Walking werden vorgestellt. Veranstaltungen wie Fasching und Aprèsski sollen mit „Party am Hang“ den Winterurlaub zu einem Erlebnis werden lassen. Zur Entspannung laden Wellnessangebote wie Sauna und Schwimmbäder ein. Interessante Alternativen zum „weißen Winter“ fehlen jedoch bzw. werden nur als kurzzeitige Überbrückung schneeloser Zeiten gesehen.
Dabei bieten touristische und gesellschaftliche Trends in Zeiten abnehmender Schneesicherheit durchaus Chancen für eine Diversifizierung des winterlichen Angebotes. Harrer [1996: 95] ermittelte bereits 1994 einen Anteil von 72Prozent der ostdeutschen Bevölkerung mit Interesse an einem Übernachtungsaufenthalt in den Bergen, die unabhängig von der Schneelage in der Wintersaison dorthin fahren würden. Als die mit Abstand bedeutendsten Reisegründe wurden die schöne Landschaft und die intakte Natur genannt. Dieses Potenzial bietet auch und vor allem vor dem Hintergrund des Klimawandels Entwicklungsmöglichkeiten, welche in Kapitel 8 näher dargestellt werden.
6 Empirische Untersuchung des wintertouristischen Angebotes
6.1 Methodik und Ablauf der Befragung
Vom 10. bis 18. Januar 2008 wurde eine telefonische Befragung von Vertretern sächsischer Alpinskigebiete sowie von Vertretern der Gemeinden, auf deren Gebiet sich diese Skigebiete befinden, durchgeführt. Dabei wurde der Großteil der sächsischen Skigebiete erfasst, um einen Querschnitt des wintertouristischen Angebotes in Sachsen zu erhalten und Aussagen auch nach Regionen differenzieren zu können. Befragt wurde der Vertreter des Skigebietes bzw. der Kommune, der am ehesten für das Skiareal bzw. den Tourismus in der Gemeinde zuständig ist. Im Falle der Skigebiete war dies meist das Vorstandsmitglied eines Skivereins, der Geschäftsführer einer Betreiber-GmbH oder der private Skiliftbetreiber. In den Kommunen wurden die Tourismusverantwortlichen der Gemeinde befragt. In vielen Fällen sind dafür die Fremdenverkehrsämter zuständig, so dass deren Leiter bzw. bei keiner direkten Leitung ein Mitarbeiter befragt wurde. In einigen Fällen beschäftigen sich die Bürgermeister direkt mit touristischen Belangen, in manchen größeren Gemeinden oder Städten existiert eine Abteilung Tourismus oder ein Tourismusmanager.
Welche Skigebiete und Gemeinden im Einzelnen untersucht wurden, ist der Anlage 4 zu entnehmen. Eine Liste mit den Namen der Befragten und den Details der Interviews liegt den Gutachtern dieser Arbeit (in loser Form) als Anlage 6 vor. Nach Mittelgebirgen wurden
- im Zittauer Gebirge Vertreter von drei Skigebiete und Gemeinden
- in der Oberlausitz Vertreter von fünf Skigebieten und vier Gemeinden
- in der Sächsischen Schweiz Vertreter von zwei Skigebieten und Gemeinden
- im Erzgebirge Vertreter von 18 Skigebieten (zwei Vertreter waren für jeweils zwei Skiareale zuständig) und 14 Gemeinden sowie
- im Vogtland Vertreter von fünf Skigebieten und Gemeinden befragt.
Die zum Teil differierenden Zahlen untersuchter Skigebiete und Gemeinden erklären sich dadurch, dass sich auf manchen Gemeindegebieten mehrere Skiareale befinden. Insgesamt wurden die Vertreter von 33 Skigebieten[36] und 28 Gemeinden befragt und zusammen 59 Interviews durchgeführt. Diese dauerten zwischen acht und mehr als 60 Minuten. Die Interviews wurden entsprechend der standardisierten Fragebögen durchgeführt (vgl. Anlage3). Bei den geschlossenen Fragen wurden nach der Fragestellung die Antwort-möglichkeiten verlesen, bei offenen Fragen nur die jeweilige Frage gestellt. Zusätzlich von den Gesprächspartnern bereitgestellte Informationen wurden bei den entsprechenden geschlossenen oder offenen Fragen ergänzt oder gesondert notiert. Dieses Vorgehen macht es möglich, Hintergründe zu gestellten Fragen oder nicht abgefragte, aber dennoch relevante Zusatzinformationen zu einzelnen Themen geben zu können.
Nachfolgend werden die Befragungsergebnisse von Skigebiets- und Gemeindevertretern vorgestellt. Bei für beide Gruppen gleichen Fragestellungen werden die Ergebnisse der Befragung sowohl getrennt betrachtet, als auch vergleichend gegenübergestellt. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss die zahlenmäßig geringe Stichprobe beachtet werden. Da jedoch die meisten sächsischen Skigebiete in diese Befragung einbezogen wurden, wäre dieses Manko auch bei einer Untersuchung aller Skigebiete weiterhin bestehend.
[...]
[1] WTO = World Tourist Organization
[2] Nach Angaben der Touristinformation Altenberg [TIB Altenberg 2007] werden Loipen und Skiwanderwege folgendermaßen definiert:
- Loipe: Weg für Skilangläufer, der „eindeutig klassifiziert, beschildert, in Karten ausgewiesen und bei ausreichenden Schneebedingungen gespurt bzw. präpariert“ ist.
- Skiwanderweg: Weg für Skilangläufer, der „als Weg erkennbar und befahrbar ist, ebenso eindeutig beschildert und in Karten ausgewiesen ist. In der Regel wird ein Skiwanderweg nur gespurt, wenn der Nutzungsbedarf sehr groß ist und der Betreiber die Möglichkeit dazu hat. Der Besucher hat keinen Anspruch darauf.“
[3] Hervorhebung des Verfassers
[4] WMO = World Meteorological Organization
[5] Als weitere Referenzen in Bezug auf die durch den Klimawandel zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen seien wiederum die Publikationen des IPCC, Reporte 2 bis 4, erwähnt. Die ökonomische Perspektive stellt hier mit Ausnahme des Reportes 3 jedoch nur einen untergeordneten Aspekt der Betrachtungen dar.
[6] BAU-Szenarien gehen von einer zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung ohne Berücksichtigung des Klimawandels in politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen aus [Stern 2007: 161ff.].
[7] Temperaturdifferenzen werden in Kelvin (1K = 1°C) angegeben.
[8] Für detailliertere Informationen zu CO2e vgl. Schönwiese2003: 339,343; Stern 2007: 194.
[9] Für weitere Informationen zu CDM und anderen Mechanismen des Kyoto-Protokolls vgl. u.a. Stern 2007: 540, 555ff.
[10] 0,5Prozent ergeben sich direkt aus dem Wintertourismus, die Gesamtverluste von bis zu zwei Prozent durch Rückkopplungen zu anderen Wirtschaftsbereichen [Breiling in Klein 2007: 56].
[11] Der Begriff Winter umfasst in der Meteorologie die Monate Dezember, Januar und Februar und weicht damit von der kalendarischen Definition ab.
[12] Es existieren verschiedene Zeitreihen des NAO-Index. Das Luftdruckniveau auf Meereshöhe wird für das Azorenhoch je nach Quelle in Ponta Delgada/Azoren (zu Portugal), Lissabon (Portugal) oder Gibraltar (zu Großbritannien) bestimmt. Für das Islandtief werden die Stationen Reykjavik, Stykkisholmur oder Akureyri (Island) herangezogen [DWD 2003; Tinz2003:33].
[13] Der Begriff „meridionaler Druckgradient“ bezeichnet den Druckunterschied entlang gleicher Längengrade.
[14] Franz Baur veröffentlichte im Jahr 1944 erstmals einen „Kalender der Großwetterlagen Europas“ (Bearbeitung der Jahre 1881 bis 1939).
[15] Als mehrtägig gelten in Anlehnung an den 1977 von Hess und Brezowsky festgelegten Standard Zeiträume mit mindestens drei Tagen Andauer [Gerstengarbe/Werner 1999: 6].
[16] Beim Übergang zwischen zwei Großwetterlagen können im Ausnahmefall ein oder zwei Übergangstage auftreten, an denen die Druckverteilung die Zuordnung zu einer der 29 GWL nicht zulässt. Diese Übergangstage werden als 30. Großwetterlage bestimmt [Gerstengarbe/Werner 1999: 10].
[17] Die Wetterstation Fichtelberg wurde gewählt, da von dieser Station die mit Abstand längste und zuverlässigste Datenreihe einer Bergwetterstation in Sachsen vorliegt (1916-2007). Von der Wetterstation Zinnwald, die sich aufgrund der geografischen Lage für vergleichende Untersuchungen ebenfalls angeboten hätte, liegen erst ab 1971 Daten vor. Für eine Untersuchung der Eigenschaften der Großwetterlagen/ Großwettertypen ist dieser Zeitraum aufgrund der geringen Auftrittshäufigkeit einiger GWL/GWT somit nur bedingt empfehlenswert. Dennoch sollen einige Ergebnisse des Vergleiches von Fichtelberg und Zinnwald in Anlage 2 dargestellt werden.
[18] Im Luvbereich (windzugewandt, Staueffekte) der vorherrschenden westlichen Strömung sind höhere Niederschlags- und Schneehöhen als im Leebereich (windabgewandt, Föhneffekte) zu verzeichnen [Kowalke 2000: 75, 79].
[19] Literaturempfehlung: Einen ausführlichen Überblick über die Klimaverhältnisse im Erzgebirge gibt eine gemeinschaftliche Publikation der meteorologischen Dienste der CSSR und der DDR mit dem Titel „Klima und Witterung im Erzgebirge“ [HMU/MD1973]. Ausgewertet wurden die Jahre 1943-1963. Eine aktuellere Bearbeitung dieses Themas sowie die Ausdehnung auf weitere sächsische Mittelgebirge existiert bisher nicht.
[20] Die Abgrenzung des 100-Tage-Zeitraumes erfolgt nicht einheitlich. Als Beginn der Periode werden 1. oder 16. Dezember, als Ende 15. oder 30. April genannt [Abegg in Elsasser/Bürki 2007: 867, Müller 2007: 127, Senti in Harrer 1996: 19]. Offensichtlich sind nicht Anfang und Ende des Zeitraumes, sondern die Einhaltung der 100 Tage Schneesicherheit von entscheidender Bedeutung.
[21] Nach der Definition des Deutschen Wetterdienstes wird unter dem Begriff der Schneedecke eine Decke aus festen Niederschlägen verstanden, die mindestens 50 Prozent des Bodens bedeckt. Diese wird täglich um 6:50 Uhr (Winterzeit) bzw. 7:50 Uhr (Sommerzeit) gemessen [DWD 2004: 4-12 f.].
[22] Bis auf die höchsten Lagen des Zittauer Gebirges (Kammregion von der Lausche, 793m über NN bis zum Hochwald, 736m über NN) befinden sich die Erhebungen über 600m über NN ausschließlich im Erzgebirge und Vogtland [vgl. SLFS 2007: 27]. Die dortigen Skigebiete erstrecken sich überwiegend zwischen 600m und 1.215m über NN [vgl. Kapitel 6.4, Abbildung 6-3].
[23] Literaturempfehlung: Eine erschöpfende Lektüre zu den Schneeverhältnissen im deutschsprachigen Erzgebirge gibt die Dissertation von Willy Fojt [1974], die sich auf die Beobachtungen der Winter 1935/36 bis 1966/67 stützt. Dies ist die einzige umfangreiche Bearbeitung des Parameters Schnee für die sächsischen Mittelgebirge. Eine aktuellere Publikation zu dieser Thematik existiert bisher nicht.
[24] Zum Beispiel bei 30 Prozent relativer Luftfeuchte weniger als -1 °C, bei 80 Prozent weniger als -4 °C [Gerl 2006].
[25] Der Betreiber des Skigebietes Altenberg (Erzgebirge) gibt die Kosten zur Errichtung einer Schneelanze zur Kunstschneeerzeugung mit 8.000 bis 10.000 Euro an. Elf Lanzen stehen mittlerweile im Skigebiet. Eine 24-stündige Beschneiung kostet nach Angaben des Betreibers etwa 800 Euro.
[26] Es werden drei Szenarien dargestellt. Zum einen eine lineare Fortsetzung der von 1960 bis 2002 beobachteten Trendentwicklung der Lufttemperatur, zum anderen die Ableitung regionaler Temperaturentwicklungen aus den IPCC-Szenarien für die Nordhemisphäre mit der jeweils geringsten und höchsten Erwärmung [Schneider/Schönbein 2006: 16 f.].
[27] WEREX (We tterlagenbedingte R egression für Ex tremwerte): Diese Regionalisierungsmethode bestimmt aus der sich ändernden Häufigkeit und dem sich ändernden Charakter der objektiven Wetterlagen daraus abgeleitete Klimaänderungen. Das Modell erfasst nicht nur die durchschnittliche Entwicklung des zukünftigen Klimas, sondern erlaubt zusätzlich Aussagen zu erwarteten Änderungen von Klimaextremen [SMUL 2005: 27, 30, 102].
[28] Dieser häufig zitierte Wert ergibt sich aus der durchschnittlichen vertikalen Abkühlung der Luft (Temperaturgradient) um 0,65K pro 100m in der Troposphäre [Hupfer/Kuttler 1998: 78]. Eine Erwärmung um 1K bedeutet demnach einen Anstieg der Null-Grad-Grenze um ca. 150m. Harrer [1996: 8] gibt die Verschiebung dieser Grenze pro K Temperaturanstieg sogar mit 170 bis 200m an. Eine Verifizierung dieser Angabe ist anhand seiner Ausführungen nicht möglich. Es liegt jedoch nahe, dass er aufgrund im Winter häufig auftretender Inversionswetterlagen von einem Temperaturgradient zwischen 0,5 und 0,6K ausgeht. Diese Bandbreite ist durchaus plausibel. Im Vergleich der DWD-Wetterstation Fichtelberg (1.213m über NN) und der Meteomedia-Wetterstation Oberwiesenthal (914m über NN) beträgt der Temperaturgradient im meteorologischen Winter (Stichprobe von Januar 2001 bis Februar 2007: Verwendung von 20 komplett vorliegenden Monaten) sogar nur 0,43K [Datenquelle: DWD Fichtelberg/MM Oberwiesenthal]. Lokal können bei einer Erwärmung um 1K daher durchaus stärkere Verschiebungen der Null-Grad-Grenze als 150m auftreten. Abbildung 4-5 zeigt jedoch auch, dass der winterliche Temperaturgradient zwischen Tief- und Bergland zukünftig tendenziell zunehmen wird.
[29] Diese Zahl umfasst die Übernachtungen nach der amtlichen Beherbergungsstatistik (Übernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben mit neun und mehr Betten sowie auf Campingplätzen: 2006 ca. 16,4 Mio. [SLFS 2007: 693]) sowie zusätzlich Tagesgäste, Gäste bei Verwandten und Freunden und Aufenthalte am Freizeitwohnsitz [SMWA 2007: 4].
[30] Der Bruttoumsatz errechnet sich aus der Anzahl der Übernachtungen und Tagesreisen multipliziert mit den jeweiligen durchschnittlichen Tagesausgaben von 31.20 Euro [LTV/SLFS 2007: 5, 15].
[31] Der Bruttoumsatz setzt sich aus der Anzahl der Tagesreisen multipliziert mit den durchschnittlichen Tagesausgaben von 25,37 Euro zusammen [nach Berechnung des DWIF, in DTV 2007: 5].
[32] Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung/Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.
[33] Hier wurden im Gegensatz zur vorhergehenden Studie nur die Übernachtungen der amtlichen Beherbergungsstatistik (in Beherbergungsbetrieben mit neun oder mehr Betten) analysiert [vgl. Harrer 1996: 57].
[34] Beherbergungsbetriebe mit neun oder mehr Betten [vgl. SLFS 2007c].
[35] Wichtige Wegmarken: 1877 - Erste Standseilbahn Deutschlands in Zeitz, 1895 - Standseilbahn in Dresden (Dresden-Loschwitz – Weißer Hirsch), 1901 - Erste Seilschwebebahn der Welt in Dresden (Dresden-Loschwitz – Oberloschwitz); 1902 - Pendelluftbahn zur Bastei [Harrer 1996: 18, VDS 2007a: 17, VDS 2007b].
[36] Für die zwei Skiareale Geising und Altenberg sowie die zwei Skigebiete Rehefeld und Oberbärenburg (alle Erzgebirge) ist jeweils ein Betreiber zuständig. Somit wurden zwar 33 Skigebiete untersucht, aber nur 31 Personen befragt.
Details
- Titel
- Wintertourismus in Sachsens Mittelgebirgen
- Untertitel
- Marketingstrategien zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2008
- Seiten
- 165
- Katalognummer
- V225797
- ISBN (eBook)
- 9783836613255
- Dateigröße
- 3272 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- klimawandel klimafolgen wintertourismus tourismus sachsen
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2008, Wintertourismus in Sachsens Mittelgebirgen, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/225797
- Angelegt am
- 22.5.2008

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.