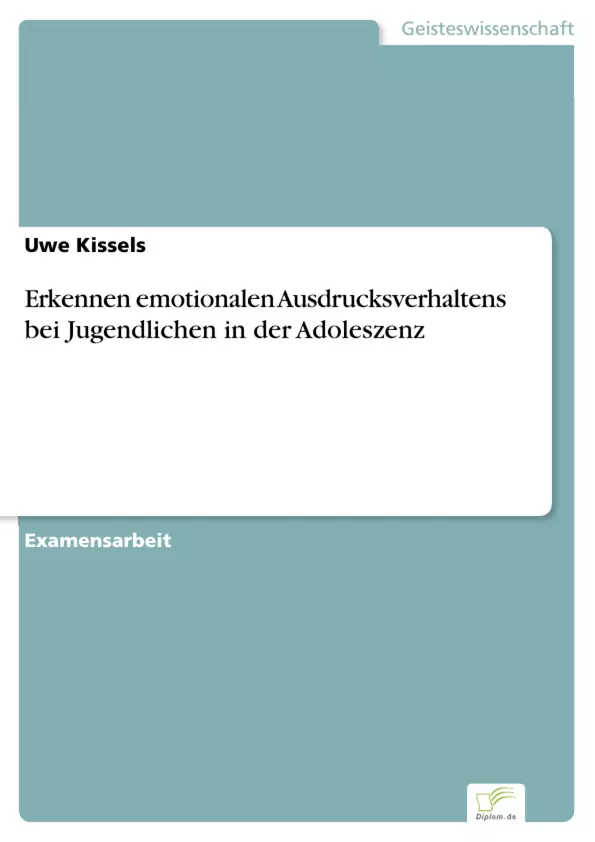Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos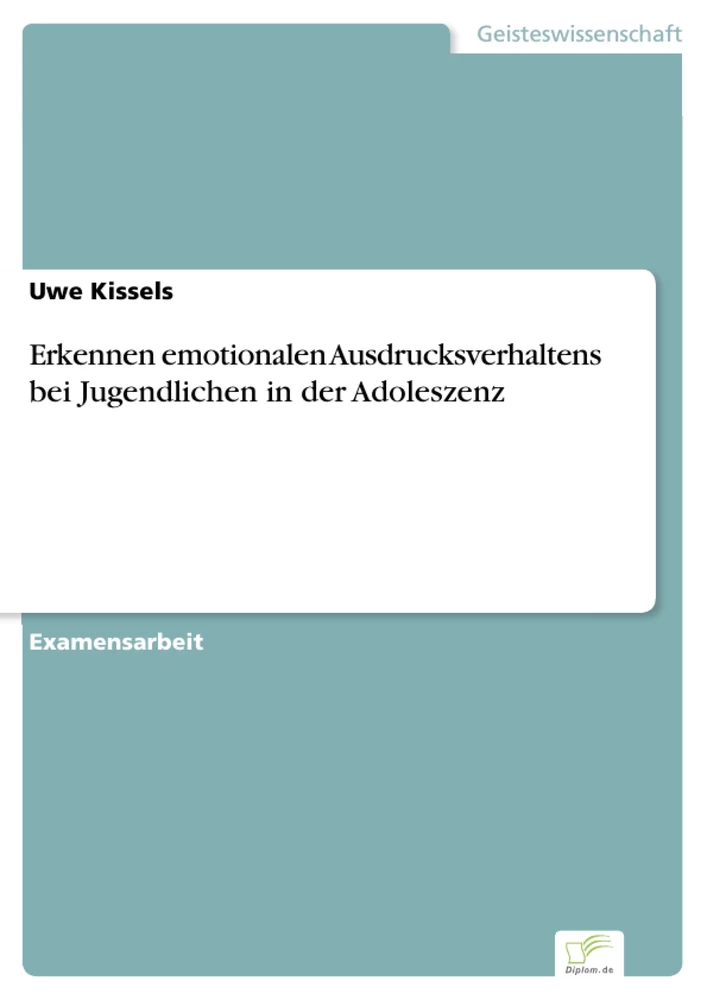
Erkennen emotionalen Ausdrucksverhaltens bei Jugendlichen in der Adoleszenz
Examensarbeit, 2007, 101 Seiten
Kategorie
Examensarbeit
Institution / Hochschule
Universität Koblenz-Landau (Psychologie, Mathematik, Theologie (Lehramt für Grund- und Hauptschule))
Note
1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I – Einleitung
II – Theoretischer Teil
1. Emotionen
1. 1 Theoretische Hauptrichtungen der Emotionspsychologie
1. 2 Historischer Überblick über neurowissenschaftliche Emotionstheorien
1. 3 Gegenwärtige neurowissenschaftliche Emotionstheorien
1. 3. 1 Die Furchttheorie von LeDoux
1. 3. 2 Die Übertragung des Ansatzes von LeDoux auf den Menschen - Arne Öhman
1. 3. 3 Die Theorie der somatischen Marker von Antonio Damasio
1. 4 Emotionsdefinitionen
2. Amygdala
2. 1 Aufbau und Anordnung im Gehirn
2. 2 Funktionsweisen der Amygdala beim emotionalen Geschehen
3. Gedächtnis
3. 1 Differenzierung des Gedächtnisses nach zeitlichen, seriellen Gesichtspunkten – Das Mehr-Speicher-Modell
3. 2 Differenzierung des Gedächtnisses nach inhaltlichen Gesichtspunkten
3. 2. 1 Das deklarative und nicht-deklarative Gedächtnismodell von Squire
3. 2. 1 Die hierarchische Klassifikation des Gedächtnisses nach Tulving
4. Emotionen und Gesichtsausdrücke
4. 1 Von der Universalität der Emotionen
4. 2 Kategoriales und dimensionales Emotionsmodell
4. 3 Der Vorgang der Gesichtswahrnehmung
4. 4 Lateralitätshypothese und valenzabhängige Lateralitätshypothese bei der Wahrnehmung emotionaler Gesichtsausdrücke
4. 5 Die Wahrnehmung emotionaler Gesichtsausdrücke und kortikale Korrelate
5. Adoleszenz
III – Empirischer Teil
1. Fragestellung und Hypothesen
2. Beschreibung der Stichproben
2. 1 Stichprobe am Sickingen-Gymnasium Landstuhl
2. 2 Stichprobe an der Europäischen Akademie für Bildung und Dienstleistung (EABD), Pirmasens
3. Beschreibung der Methode
3.1 Beschreibung des Erhebungsinstruments
3. 2 Versuchsablauf
3. 3 Statistisches Verfahren
4. Ergebnisse
4. 1 Ergebnisse für das Erkennen des emotionalen Gesichtsausdrucks unabhängig seiner Position
4. 1. 1 Ergebnisse für Probanden aus der Europäischen Akademie für Bildung und Dienstleistungen (EABD), Pirmasens
4. 1. 2 Ergebnisse für die Probanden des Sickingen-Gymnasiums, Landstuhl
4. 1. 3 Ergebnisse für beide Versuchsgruppen
4. 1. 4 Geschlechtsunterschiede
4. 2 Ergebnisse für das Erkennen des emotionalen Gesichtsausdrucks in Abhängigkeit seiner Position
IV – Zusammenfassung und Diskussion
V – Literaturverzeichnis
VI – Anlagen
A – Informationsschreiben und Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
B – Daten-CD
VII – Versicherung
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Schematische Darstellung der James-Lange-Theorie (modifiziert nach LeDoux, 2006, S. 88; Siebert, 2002, S. 8)
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Cannon-Bard-Theorie (Siebert, 2002, S. 10; Modifiziert nach LeDoux, 2006, S. 91)
Abbildung 3: Schematische Darstellung der Theorie von Papez (Siebert, 2002, S. 11; Modifiziert nach LeDoux, 2006, S. 96)
Abbildung 4: Pfade der Informationsverarbeitung bei der Furchtkonditionierung (Modifiziert nach Erk & Walter, 2003, S. 54)
Abbildung 5: Schaltkreis der Angstkonditionierung bei auditorischen Reizen (modifiziert nach Pinel, 1997, S. 471)
Abbildung 6: der Amygdala im limbischen System (Übernommen aus Pinel, 1997, S. 77)
Abbildung 7: Verschachtelungen der Amygdala (Modifiziert nach Schandry, 2006, S. 494)
Abbildung 8: Schematische Darstellung des Mehr-Speicher-Modells (Siebert, 2002, S. 31; Modifiziert nach Pritzel et al., 2003, S. 410)
Abbildung 9: Differenzierung des Langzeitgedächtnisses nach Squire (Modifiziert nach Siebert, 2002, S. 35)
Abbildung 10: Die Gedächtnissysteme nach Tulving & Markowitsch (Modifiziert nach Pritzel et al., 2003, S. 415; Siebert, 2002, S. 36)
Abbildung 11: Periodisierung des Jugendalters (Modifiziert nach Oerter & Dreher, 1995, S. 312)
Abbildung 12: Die eingesetzten emotionalen Gesichtsausdrücke
Abbildung 13: Beispiel für eine eingesetzte Grafik mit einem emotionalen Stimulus
Abbildung 14: Verteilung der Reaktionszeiten aller männlichen Probanden auf positive bzw. negative Gesichtsausdrücke
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Reihenfolge der präsentierten Grafiken mit Position des Stimulus
Tabelle 2: Positionierungsmatrix
Tabelle 3: Statistische Kennwerte aller Reaktionszeiten auf positive und negative Stimuli unabhängig ihrer Position, Pirmasens
Tabelle 4: Ergebnisse des t-Tests für gepaarte Stichproben unabhängig der Position des Stimulus für alle Reaktionszeiten, Pirmasens
Tabelle 5: Statistische Kennwerte für die Mittelwerte der Reaktionszeiten auf positive und negative Stimuli unabhängig ihrer Position, Pirmasens
Tabelle 6: Ergebnisse des t-Tests für gepaarte Stichproben unabhängig der Position des Stimulus bei gemittelten Reaktionszeiten, Pirmasens
Tabelle 7: Statistische Kennwerte für alle Reaktionszeiten auf positive bzw. negative Stimuli unabhängig der Position, Landstuhl
Tabelle 8: Ergebnisse des t-Tests für gepaarte Stichproben unabhängig der Position des Stimulus für alle Reaktionszeiten, Landstuhl
Tabelle 9: Statistische Kennwerte für die Mittelwerte der Reaktionszeiten auf positive und negative Stimuli unabhängig ihrer Position, Landstuhl
Tabelle 10: Ergebnisse des t-Tests für gepaarte Stichproben unabhängig der Position des Stimulus bei gemittelten Reaktionszeiten, Landstuhl
Tabelle 11: Statistische Kennwerte für alle Reaktionszeiten auf positive bzw. negative Stimuli unabhängig der Position, Landstuhl und Pirmasens
Tabelle 12: Ergebnisse des t-Tests für gepaarte Stichproben unabhängig der Position des Stimulus bei allen Reaktionszeiten, Landstuhl und Pirmasens
Tabelle 13: Statistische Kennwerte für die Mittelwerte der Reaktionszeiten auf positive und negative Stimuli unabhängig ihrer Position, Landstuhl und Pirmasens
Tabelle 14: Ergebnisse des t-Tests für gepaarte Stichproben unabhängig der Position des Stimulus bei gemittelten Reaktionszeiten, Landstuhl und Pirmasens
Tabelle 15: Statistische Kennwerte für die Mittelwerte der Reaktionszeiten auf positive und negative Stimuli unabhängig ihrer Position bei allen männlichen Jugendlichen
Tabelle 16: Ergebnisse des t-Tests für gepaarte Stichproben unabhängig der Position des Stimulus bei allen männlichen Jugendlichen
Tabelle 17: Statistische Kennwerte für die Mittelwerte der Reaktionszeiten auf positive und negative Stimuli unabhängig ihrer Position bei allen weiblichen Jugendlichen
Tabelle 18: Ergebnisse des t-Tests für gepaarte Stichproben unabhängig der Position des Stimulus bei allen weiblichen Jugendlichen
Tabelle 19: Statistische Kennwerte für alle Reaktionszeiten auf positive bzw. negative Stimuli in Abhängigkeit der Position, Landstuhl und Pirmasens
Tabelle 20: Statistische Kennwerte für die Mittelwerte der Reaktionszeiten auf positive und negative Stimuli in Abhängigkeit ihrer Position bei allen männlichen Jugendlichen
Tabelle 21: Ergebnisse des t-Tests für gepaarte Stichproben in Abhängigkeit der Position des Stimulus bei allen männlichen Jugendlichen
Tabelle 22: Statistische Kennwerte für die Mittelwerte der Reaktionszeiten auf positive und negative Stimuli in Abhängigkeit ihrer Position bei allen weiblichen Jugendlichen
Tabelle 23: Ergebnisse des t-Tests für gepaarte Stichproben in Abhängigkeit der Position des Stimulus bei allen weiblichen Jugendlichen
I – Einleitung
Emotionen sind ständige Begleiter unseres Lebens, denen wir bewusst oder unbewusst gewahr werden. Sie dienen der Kommunikation und der sozialen Interaktion und helfen uns, das eigene Verhalten schnell und flexibel an Situationen anzupassen. Ein Beispiel: Ein Freund von Ihnen rennt mit einem wütenden Gesicht auf Sie zu. Sie sehen seinen Gesichtsausdruck und interpretieren ihn als „Ärger“ oder „Wut“. Ihr Verhalten in dieser Situation wird sich sehr wahrscheinlich von dem unterscheiden, welches Sie zeigen würden, wenn Ihr Freund mit einem lachenden Gesicht auf Sie zukommt. Eine adäquate Reaktion in einer sozialen Situation setzt die korrekte Interpretation des emotionalen Ausdrucks voraus.
Emotionen dienen aber nicht nur der Kommunikation, sondern sie können auch Einfluss auf die Gedächtnisleistungen eines Individuums nehmen. Beispielsweise kann ich mich noch heute sehr gut an das Fußballspiel 1. FC Kaiserslautern gegen Real Madrid erinnern, dass Kaiserslautern 1982 mit 5:0 gewann. Es war das erste Fußballspiel, das ich im Stadion gesehen habe, und wenn ich daran zurückdenke, fällt mir wieder die Begeisterung bei jedem Tor und die Schadenfreude bei jeder der beiden roten Karten ein. Umgekehrt könnte ich nicht mehr angeben, welche Emotionen ich empfunden habe, als der FC Bayern München zuletzt Deutscher Fußballmeister wurde. Ich schätze aber, dass es kein wohlwollendes Gefühl war.
Als eine zentrale Struktur für die Emotionsverarbeitung und für emotionale Gedächtnisprozesse wird die Amygdala angesehen. Diese spielt insbesondere in Gefahrensituationen eine außerordentliche Rolle: Sie wird als das Zentrum angesehen, das eine Information als Gefahr interpretiert und entsprechende Handlungsanweisungen an andere Abteilungen im Gehirn sendet, wodurch die Überlebenschancen eines Individuums in einer tatsächlichen Gefahrensituation enorm gesteigert werden. Dies setzt aber voraus, dass ein Stimulus, der auf eine Gefahr hindeutet, sehr schnell verarbeitet wird.
In der vorliegenden Arbeit wird an Jugendlichen in der späten Adoleszenz überprüft, ob Stimuli, die auf eine Gefahr hindeuten, tatsächlich schneller verarbeitet werden als Stimuli, die auf keine Gefahr schließen lassen. Als Stimuli werden dabei negative, ärgerliche und positive, freudige Gesichtsausdrücke eingesetzt, die es zu erkennen gilt. Die Verarbeitungszeit selbst wird in Form von Reaktionszeiten festgehalten und überprüft.
Im Theorieteil dieser Arbeit betrachte ich folglich zuerst allgemeine Emotionstheorien, um dann meinen Schwerpunkt auf neuere neurowissenschaftliche Emotionstheorien zu legen. Ferner bespreche ich den Aufbau und die Funktionsweise der Amygdala, da dieser beim Erkennen von negativen emotionalen Stimuli eine besondere Rolle beigemessen wird.
Da das Erkennen einer Gefahr ein Wissen und auch ein Erinnern voraussetzt, gehe ich in dem sich anschließenden Kapitel auf das Gedächtnis ein und stelle verschiedene Annahmen zum Aufbau und der Funktionsweise des Gedächtnisses vor.
Da im empirischen Teil die Reaktionszeiten von Jugendlichen auf emotionale Stimuli gemessen und ausgewertet werden, ist es dringend erforderlich, emotionalen Gesichtsausdrücken auch im theoretischen Teil ein eigenes Kapitel zu widmen. Dort soll geklärt werden, ob verschiedene emotionale Gesichtsausdrücke von verschiedenen Personen immer in der gleichen Art erkannt und interpretiert werden, und wie dieses Erkennen erfolgt.
Der Schwerpunkt des empirischen Teils liegt auf dem Vergleich der Reaktionszeiten von Jugendlichen in der späten Adoleszenz beim Erkennen positiver bzw. negativer emotionaler Gesichtsausdrücke. Die dabei entstandenen Ergebnisse werden abschließend zusammengefasst und diskutiert.
II – Theoretischer Teil
1. Emotionen
Innerhalb der Emotionsforschung gibt es weder eine einheitliche Emotionsdefinition, noch eine einheitliche Theorie der Emotionen. Der Grund für diese Mannigfaltigkeit ist, dass emotionales Verhalten ein sehr komplexes Thema darstellt und unterschiedliche Zugänge ermöglicht. Daher fühlen sich, wie Traue & Kessler (2003) bemerken, viele verschiedene wissenschaftliche Forschungsbereiche dazu berufen, ihren Beitrag zur Entschlüsselung dessen, was Emotionen sind und was emotionales Verhalten ausmache, zu leisten. Auch berufen sich die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen auf verschiedene Ansätze, was unausweichlich zu einer Theorienvielfalt emotionalen Verhaltens beiträgt. Ein Blick in die verschiedenen Lehr- und Fachbücher genügt, diesen Sachverhalt zu verdeutlichen: Traue & Kessler beispielsweise nennen sieben verschiedene Theorienbereich, die alle das Thema Emotion zum Gegenstand haben. Sie unterschieden die Expressionstheorie, die psychoanalytische Emotionstheorie, die Kognitions-Aktivations-Theorie der Emotionen, systemtheoretische Emotionstheorien, neurobiologische Emotionstheorien, Theorien, die Emotionen als adaptive Reizverarbeitung verstehen, und Aktivationstheorien der Emotionen (Traue & Kessler, 2003). Demgegenüber führt Ulich (2003) sechs unterschiedliche Theorien auf: Theorien mit evolutionsbiologischem Ansatz, Emotionen als System, psychophysiologische Theorien, behavioristisch-lerntheoretische Ansätze, kognitive Bewertungstheorien und funktionalistisch orientierte Komponenten-Prozessmodelle (Ulich, 2003). Schaut man in das Buch „Emotionspsychologie – Ein Handbuch“ hinein, das von Otto, Euler und Mandl herausgegeben wird, so zählt man beim Kapitel „Emotionstheorien“ insgesamt elf verschiedene Unterkapitel (Otto, Euler & Mandl, 2000), deren Auflistung ich mir an dieser Stelle erspare.
Sinnvoll erscheint es mir aber, einige der verschiedenen Ansätze und Traditionen innerhalb der Emotionsforschung in kurzen Worten darzustellen, wobei ich mich an einer Aufstellung orientiere, die Ulich (2003) vorgenommen hat.
1. 1 Theoretische Hauptrichtungen der Emotionspsychologie
Als erster Ansatz sei der evolutionsbiologische genannt. Dieser Ansatz gründet sich auf Charles Darwin, der mit seinem 1872 veröffentlichen Buch „The Expression of Emotions in Man and Animals“ den Stein der Emotionsforschung ins Rollen brachte (Siebert, 2002). Darwin vertrat die Auffassung, Menschen und Tiere würden in ihrem emotionalen Ausdrucksverhalten denselben Prinzipien folgen. Folglich könne man durch die Erforschung des Emotionsausdrucks anderer Arten auch Erkenntnisse über den Menschen gewinnen. Darwin nahm an, dass der Ausdruck vieler Emotionen nicht erlernt, sondern angeboren sei. Er untersuchte die Gefühle vom Standpunkt der Entwicklungsgeschichte mittels Beobachtungen und Befragungen und legte dabei sein Augenmerk besonders darauf, welche Mimik und Muskelbewegungen für den Ausdruck der Gefühle benutzt werden, und welchem Zweck diese Bewegungen im Laufe der Evolution gedient haben könnten. Im Rahmen seiner Untersuchungen stellte Darwin fest, dass bestimmte Gefühlserregungen wie zum Beispiel Erstaunen, Scham oder Niedergeschlagenheit von verschiedenen Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt stets in gleicher Weise ausgedrückt werden. Aus dieser Feststellung zog er den Schluss, emotionsspezifischer Ausdruck und das Verstehen dieses Ausdrucks sei universell verbreitet, und demzufolge sei die Verbindung von Emotion und ihrem mimischen Ausdruck angeboren (Meyer, Schützwohl & Reisenzein, 2003; Siebert, 2002; Schandry, 2006).
In der Traditionslinie von Darwin ist Ekman zu nennen, der zwar zunächst den Theorien Darwins misstraute, später aber die Existenz von sechs Basisemotionen („Angst“, „Überraschung“, „Ekel“, „Trauer“, „Ärger“ und „Freude“) nachweisen. Die Untersuchungen von Ekman haben die Forschung in eine bestimmte Richtung, nämlich auf das Konzept der „Basisemotionen“ gelenkt. Damit ist die Vorstellung verknüpft, die Basisemotionen hätten festgelegte Schaltkreise im Gehirn, über die diese Emotionen wie per Knopfdruck aufgerufen werden können. Ferner gehen die Konzepte der Basisemotionen davon aus, dass diskrete Emotionen in der Vergangenheit einen Anpassungsvorteil dargestellt haben und auch weiterhin der Entwicklung und Anpassung von Organismen dienen (Wassmann, 2002; Meyer et al., 2003). In Kapitel 4 werde ich diesen Ansatz näher betrachten.
In der Systemtheorie der Emotionen werden zwei Affektsysteme angenommen: Ein System der Basisemotionen und ein sozial-kognitives Emotionssystem. In diesem Zusammenhang sei stellvertretend auf Izard verwiesen, bei dem die grundlegenden, angeborenen Emotionen ein System bilden. Izard begreift aber dieses Emotionssystem als integraler Bestandteil motivationaler Systeme der Persönlichkeit, deren Funktion auf das Überleben, die Förderung der Kind-Umwelt-Interaktion, der Unterscheidung des eigenen Selbst von anderen Personen, der Ausweitung der Aktivitätsräume, der Förderung der Kognition und der Selbstkontrolle ausgelegt ist (Ulich, 2003).
Das zweite System, das als sozial-kognitives Emotionssystem bezeichnet wird, ist hierarchisch über dem System der Basisemotionen angeordnet und beeinflusst dieses mit Hemm- und Verstärkungsmechanismen, die auf sozialen und kulturellen Bewertungen beruhen. Diese Kontrollmechanismen wirken sich dabei auf die Wahrnehmungs- und Ausdruckskomponenten aus (Traue & Kessler, 2003).
Innerhalb der behavioristischen Theorien zur Erklärung von Emotionen gibt es eine große Bandbreite. Behavioristisch-lerntheoretische Beiträge sehen in Gefühlen zunächst eine Art von Reflexen, nämlich angeborene Reaktionsmuster, die körperliche Veränderungen einschließen (Ulich, 2003).
Am prominentesten sind in diesem Zusammenhang sicherlich die Befunde Watsons zur konditionierten Angst, die die Emotionsforschung jahrelang geprägt haben. Nach Watson gibt es drei angeborene Reiz-Reaktions-Konstellationen beim Kleinkind. Als Grundemotionen nennt er Wut, Furcht und Liebe. Entsprechend den drei angeborenen Grundemotionen unterscheidet Watson auch drei angeborene Auslöser dieser Emotionen: Furcht wird ausgelöst durch laute Geräusche, Wut wird ausgelöst durch Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, Liebe durch liebevolles Streicheln. Diese sehr geringe Anzahl von Reiz-Reaktions-Verbindungen vergrößert sich im Laufe der weiteren Entwicklung durch Lernvorgänge auf der Basis des klassischen Konditionierens (Ulich, 2003).
In den 60er Jahren trat eine „kognitive Wende“ in der Verhaltensforschung ein. Ein Reiz wurde nicht mehr als unmittelbarer Auslöser für das Verhalten angesehen, sondern als Information für den Organismus, die dieser interpretiert. Ausschlaggebend ist demnach die subjektive Bedeutung des Reizes für den Organismus, wie die Neobehavioristen meinten (Wassmann, 2002). Hier haben sich vor allem Mowrer und Miller hervorgetan, die die Entstehung von emotionalen Reaktionen und Reaktionsbereitschaften aus einer Kombination von klassischem und instrumentellem Konditionieren zu erklären versuchten, wobei besonders die Emotion Angst im Mittelpunkt stand. Für Mowrer und Miller waren Emotionen sowohl angeborene als auch erworbene Reaktionsmuster, die oft auch motivierende Eigenschaften annehmen können (Ulich, 2003).
Kognitive Bewertungstheorien oder auch attributionale Theorien der Emotion beschäftigen sich mit der kognitiven Einschätzung einer Person, die zwischen Reiz und Reaktion stehen und vermitteln. Diese kognitive Einschätzung führt dazu, dass gleiche Situationen von verschiedenen Personen unterschiedlich bewertet werden und demzufolge auch unterschiedliche Reaktionen auslösen können (Ulich, 2003).
Innerhalb der kognitiven Emotionstheorien ist der Ansatz von Lazarus wohl der bekannteste, den Lazarus selbst als „kognitiv-phänomenologisch“ bezeichnet (Ulich, 1989). Dabei geht Lazarus vom Erleben und Handeln der Person aus, die er als Prozesse der Informationsverarbeitung versteht. Kern seiner Emotionstheorie ist ein offener Regelkreis bzw. ein offener Rückkoppelungs-Prozess, durch den in idealtypischer Weise die Interaktionen zwischen Person und Umwelt beschrieben werden. Ausgangspunkt des Verlaufsmodells ist eine Situation oder ein Ereignis, das als bedeutsam für das Wohlergehen der eigenen Person angesehen wird. Sobald die Person sich dieser Situation ausgesetzt sieht, erfolgt eine Reflexion darüber, wie sie der Situation begegnen kann. Je nach Einschätzung der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten werden dann Bewältigungsversuche geplant und ausgeführt, die sich auf eine Veränderung der Situation beziehen können oder auf eine psychische Veränderung in Form von Verdrängung oder Verleugnung. Emotionen sind dabei fast immer die Folge der kognitiven Bewertung (Ulich, 1989). Als Schlusspunkt seiner Theorie unterscheidet Lazarus 15 Emotionen, die sich durch spezifische Bewertungsmuster auf sechs Dimensionen ergeben: nämlich neun negative Emotionen (wie zum Beispiel Ärger, Furcht, Angst), vier positive Emotionen (z.B. Zufriedenheit, Stolz, Liebe) sowie die Gefühle Hoffnung und Mitgefühl (Ulich, 2003).
Funktionalistisch orientierte Komponenten-Prozessmodelle zeigen eine gewisse Ähnlichkeit zur Emotionstheorie von Lazarus, gehen aber dennoch über ihn in einem Punkt hinaus. Wie Lazarus sehen diese Modelle Emotionen als das Produkt verschiedener Verarbeitungsschritte auf unterschiedlichen Verarbeitungsebenen an. Zusätzlich postulieren sie aber ein oberstes Ziel, auf die sich die Verarbeitungsschritte hinbewegen, bzw. sie benennen bestimmte Kriterien der Informationsverarbeitung (Ulich, 2003).
Scherer zum Beispiel versteht Emotionen in evolutionstheoretischer Tradition als Schnittstellen zwischen Individuum und Umwelt, mit deren Hilfe starre Reiz-Reaktions-Ketten durch rasch ablaufende Regelmechanismen ersetzt werden. Eine Betonung legt Scherer auf den Bewertungsvorgang im emotionalen Prozess, wobei diese Bewertung hierarchisch in fünf Schritten erfolgen soll: Zuerst erfolgt eine Bewertung der Neuartigkeit eines Reizes. Dann folgt eine Bewertung der Qualität auf der Dimension „angenehm - unangenehm“. Es schließt sich die Bewertung der Zielrelevanz an, die Bewertung der Bewältigungsfähigkeit und schließlich die Bewertung der Selbstkonzeptrelevanz eines Reizes für die eigene Person (Traue & Kessler, 2003).
Schließlich sind noch die neurowissenschaftlichen Emotionstheorien zu nennen, die ich im folgenden Unterkapitel ausführlicher behandeln werde.
1. 2 Historischer Überblick über neurowissenschaftliche Emotionstheorien
Der wichtigste Impuls zur wissenschaftlichen Erforschung der Emotionen im 20. Jahrhundert kam weder aus der Philosophie, die sich seit der griechischen Antike teilweise mit dem Problem der Emotionen beschäftigt hatte, noch aus der eigentlichen Psychologie: es war der Naturwissenschaftler Charles Darwin. Obwohl Darwins Annahmen in der Fachwelt starke Beachtung fanden und zahlreiche Wissenschaftler dazu anspornten, mit Hilfe von Tierversuchen mehr über das menschliche Gehirn in Erfahrung zu bringen, blieb Darwins Einfluss auf die Emotionswissenschaft nur von kurzer Dauer. Die Erkenntnisse jedoch, die an Tierversuchen gewonnen wurden, bildeten den Grundstock für die Emotionstheorie des amerikanischen Physiologen William James und des dänischen Psychologen Carl G. Lange, die heute kurz als James-Lange-Theorie bezeichnet wird. Ausgangspunkt für ihre Theorie war die Frage, ob Emotionen das Resultat der kognitiven Verarbeitung von Körperreaktionen, oder ob Körperreaktionen das Resultat von Emotionen sind (Pritzel, Brand & Markowitsch, 2003)? Die Problematik an einem Beispiel verdeutlicht: „Laufen wir vor einem Bären weg, weil wir uns fürchten, oder fürchten wir uns, weil wir laufen (LeDoux, 2006, S. 48)?“ Die James-Lange-Theorie beantwortet diese Frage folgendermaßen: Wenn wir den Bären sehen, erleben wir eine Veränderung des Körpers. Vielleicht fangen wir zu zittern an, vielleicht steht kalter Schweiß auf unserer Stirn. Es ist egal, welche Art von Veränderung wir erfahren - fest steht, es kommt zu einer Körperveränderung, die das Individuum registriert. Emotionen sind demzufolge nichts anderes als die Wahrnehmung dieser Veränderungen (LeDoux, 2006; Pritzel et al., 2003).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Schematische Darstellung der James-Lange-Theorie (modifiziert nach LeDoux, 2006, S. 88; Siebert, 2002, S. 8)
Dieser Sachverhalt versucht Abbildung 1 zu verdeutlichen: Wird ein Sinnesorgan (bspw. Ohr, Auge) durch einen von außen kommenden Reiz stimuliert, werden Impulse an den sensorischen Kortex weitergeleitet. Der sensorische Kortex aktiviert den motorischen Kortex, wodurch Muskeln und innere Organe angeregt und eine motorische Reaktion ausgelöst werden. Eine solche motorische Reaktion könnte das Weglaufen oder eine Freezing-Reaktion sein. Auch werden physiologische Reaktionen eingeleitet: Die Atemfrequenz oder der Blutdruck steigt an. Die körperlichen Reaktionen werden an den sensorischen Kortex zurückgemeldet. Die Wahrnehmung genau dieser durch den Reiz hervorgerufenen körperlichen Empfindungsveränderungen ist die Emotion und je nach der spezifischen Beschaffenheit der sensorischen Rückmeldung entstehen unterschiedliche Emotionen (LeDoux, 2006; Siebert, 2002).
Die James-Lange-Theorie, die in der Emotionspsychologie lange Zeit eine dominante Rolle eingenommen hatte, wurde von dem amerikanischen Physiologen Walter Cannon 1927 angezweifelt. Er führte ins Felde, dass der sensorische Kortex nicht der Ort sein könne, an dem Emotionen gefühlt werden. Dies hatten Untersuchungen an Tieren ergeben, bei denen alle Verbindungen zwischen Gehirn und den inneren Organen, auf deren Veränderungen emotionale Empfindungen zurückgeführt wurden, unterbunden worden waren. Dabei ließ sich durch die Durchtrennung der Bahnen keine Beeinflussung der emotionalen Reaktionen feststellen. Ferner sollte bedacht werden, dass gleiche viszerale Veränderungen sowohl emotionale als auch nicht-emotionale Zustände hervorrufen. Des Weiteren sind wir uns vieler viszeraler Veränderungen gar nicht bewusst, und zudem erfolgen diese viszeralen Veränderungen so langsam, dass oftmals Emotionsempfindungen vorhanden sind, bevor die viszeralen Reaktionen auftreten (Siebert, 2002; Pritzel et al., 2003; Schandry, 2006). Schließlich konnte durch die Verabreichung von Adrenalin viszerale Veränderungen hervorgerufen werden, die auch von der Versuchsperson wahrgenommen wurden, die aber keine spezifischen Emotionen erzeugten (Siebert, 2002). Die James-Lange-Theorie könne daher den Kern des Problems nicht treffen, da Emotionen allem Anschein nach nicht durch das Erkennen von körperlichen Veränderungen erzeugt werden, was die Grundannahme jener Theorie war.
Als Alternative schlug Cannon eine Emotionstheorie vor, die von dem amerikanischen Physiologen Philip Bard weitergeführt und unter dem Namen Cannon-Bard-Theorie bekannt wurde. Grundidee ist, dass emotionales Erleben unabhängig von viszeralen Körperveränderungen ablaufe. Wenn viszerale Körperveränderungen mit Emotionen auftreten, dann seien diese nur eine Begleiterscheinung (Schandry, 2006; Pritzel et al., 2003).
In der Cannon-Bard-Theorie ist der Thalamus bei der Entstehung von Emotionen von entscheidender Wichtigkeit. Ein emotionsrelevanter Reiz wird vom Thalamus und speziellen sensorischen Arealen des Kortex verarbeitet, und erst nach einem Input durch den Hypothalamus wird im Kortex die Emotion generiert, die vom Subjekt wahrgenommen wird. Gleichzeitig löst der Hypothalamus die körperlichen Begleiterscheinungen der Emotion aus (Siebert, 2002; Schandry, 2006).
Der amerikanische Anatom James Papez knüpfte 1937 mit der Vorstellung, subkortikalen Strukturen komme bei der Emotionsvermittlung eine zentrale Bedeutung zu, an die Theorie von Cannon und Bard an. Auf Grund von klinischen Beobachtungen an Enzephalitispatienten, deren Hippokampus stark beschädigt war und erhebliche emotionale Veränderungen aufzeigten, entwarf Papez einen Schaltkreis, der eine Interaktion von Kognitionen und Emotionen berücksichtigt. Ausgangspunkt seines Schaltkreises ist wiederum ein emotionsrelevanter Reiz, der zum Thalamus weitergeleitet wird. Vom Thalamus aus vergabelt sich der Schaltkreis: Einerseits wird die Information zum Hypothalamus geleitet, der eine körperliche Reaktion einleitet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Cannon-Bard-Theorie (Siebert, 2002, S. 10; Modifiziert nach LeDoux, 2006, S. 91)
Andererseits wird der Input zum sensorischen Kortex übermittelt, der von hieraus die Information in einen Regelkreis von cingulärem Kortex, Hippokampus, Hypothalamus und anteriorem Thalamus überreicht, an dessen Ende das Gefühl entsteht. Dem cingulären Kortex kommt in diesem Schaltkreis nach Papez die Rolle als Sitz der Gefühle zu. Wenn die subkortikalen Informationen im cingulären Kortex miteinander agieren, entsteht, so Papez, ein emotionales Erleben. Aber eine Emotion kann in diesem Schaltkreis, wie aus nachfolgender Darstellung ersichtlich wird, auf zwei Wegen entstehen: nämlich über einen subkortikalen und einen kortikalen Weg (Siebert, 2002; LeDoux, 2006; Peper & Irle, 1994).
Anzumerken bleibt, dass aus heutiger Sicht einige der neuroanatomischen Strukturen, die Papez als emotionsrelevant eingestuft hatte, nicht primär an den emotionalen Funktionen beteiligt sind, sondern viel mehr an Gedächtnisprozessen. Der Hippokampus sei hier stellvertretend genannt (Siebert, 2002).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Schematische Darstellung der Theorie von Papez (Siebert, 2002, S. 11; Modifiziert nach LeDoux, 2006, S. 96)
Durch die Entdeckung der „Seelenblindheit“ bereicherten Heinrich Klüver und Paul Blucy 1937 die Emotionsforschung um einen weiteren Baustein. Unter „Seelenblindheit“ wird beim Klüver-Bucy-Syndrom, bei dem die Schädigung der Amygdala eine entscheidende Rolle spielt, ein Symptomkomplex verstanden, den die beiden Forscher an Affen mit bilateral temporallobektomierten Affen beobachten konnten. Diese zeigten sich als besonders zahm und furchtlos in Konfrontation mit angstrelevanten Objekten wie zum Beispiel Schlangen. Ihr Verhalten war ebenfalls gekennzeichnet durch eine Hyperoralität (Gegenstände, auch solche, die nicht essbar sind, wurden mit dem Mund untersucht), Hypersexualität und gleichgeschlechtliche Kopulationsversuche. Ferner schienen die Affen unter dem Zwang zu stehen, jeden visuellen Reiz zu bemerken und auf ihn zu reagieren, wobei sie gleichzeitig unter einer visuellen Agnosie litten (Siebert, 2002; Pinel, 1997; Peper & Irle, 1994).
In mehreren Arbeiten aus dem Jahr 1949 und 1952 griff McLean den Papezschen Schaltkreis wieder auf und integrierte in ihn die Beobachtungen von Klüver und Bucy. Aus der Integration dieser Komponenten entstand die Vorstellung vom limbischen System, das für McLean das affektregulierende Zentrum des Gehirns darstellte. Als Komponenten des limbischen Systems, einer, so McLean, neuroanatomischen und funktionellen Einheit, führte er die Bestandteile des Papezschen Schaltkreises auf und ergänzte diesen um die Amygdala, das Septum und den präfrontalen Kortex. Dieses System soll sich entwicklungsgeschichtlich aus alten Hirnarealen herausgebildet haben, um viszerale Funktionen und affektives Verhalten zu integrieren. Demzufolge unterscheidet McLean zwei Hirnbereiche: Zum einen das limbische System als Steuerungsinstanz emotionalen Erlebens und emotionaler Reaktionen, zum anderen den Neokortex als Leistungszentrum kognitiver Prozesse (Siebert, 2002; Peper & Irle, 1994). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Funktionsweise eines solchen limbischen Systems stark angezweifelt wird: „Die Theorie vom limbischen System als Erklärung des emotionalen Gehirns ist falsch, und manche Wissenschaftler behaupten sogar, dass es ein limbisches System gar nicht gebe (LeDoux, 2006, S. 81).“ Die Zweifel werden durch Beobachtungen begründet, nach denen eine enge Verknüpfungen zwischen dem limbischen System und dem Neokortex festgestellt worden waren. Auch konnte die Annahme von entwicklungsgeschichtlich älteren und neueren Kortexbereichen durch den Nachweis entkräftet werden, nach welchem primitive Lebewesen Strukturen besitzen, die in ihrer Funktion und ihrem Aufbau dem Neokortex sehr ähneln (Siebert, 2002; Peper & Irle, 1994).
Nachdem in den 40er und 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Emotionsforschung unter dem Einfluss des Behaviorismus auf das Abstellgleis geschoben worden war, lenkten die beiden amerikanischen Sozialpsychologen Stanley Schachter und Jerome Singer Anfang der 60er Jahre mit ihrer Zwei-Faktoren-Theorie das Interesse der Wissenschaft wieder auf diesen Forschungsbereich. Als die beiden Faktoren wurden physiologische und kognitive Prozesse erkannt, die quasi gleichberechtigt nebeneinander gestellt wurden. Demnach müsse für die Entstehung einer Emotion zuerst eine Körperveränderung wahrgenommen werden. Diese Körperveränderung ist zunächst unspezifisch, kann anfänglich nicht erklärt werden und bestimmt nur die Intensität der Emotion. Durch diesen Erklärungsmangel der Körperveränderung bei gleichzeitigem Vorhandensein situativer emotionaler Hinweisreize entsteht ein Bewertungsdruck, der eine Einstufung der Körperveränderung innerhalb emotionaler Kategorien einleitet (Siebert, 2002; Schandry, 2006). Ist dabei die Erregungsquelle bekannt, so erfolgt die Interpretation der Erregung rasch und problemlos. Ist die Quelle indes unbekannt, wird ein Suchprozess eingeleitet, der aus Hinweisen aus der Umwelt heraus die Erregung zu erklären versucht (Siebert, 2002).
Schachter und Singer unternehmen mit ihrer Zwei-Faktoren-Theorie den Versuch, die gegensätzlichen Theorien von James und Lange bzw. Cannon und Bard auszusöhnen und miteinander zu integrieren. Dennoch muss festgehalten werden, dass Schachter und Singer die Rolle der physiologischen Erregung bei der Emotionsentstehung überschätzen. Studien zur Überprüfung der Zwei-Komponenten-Theorie konnten verschiedene Annahmen von Schachter und Singer eben nicht bestätigen. So konnte nachgewiesen werden, dass für ein emotionales Erleben nicht unbedingt eine physiologische Erregung vorausgehen muss. Auch führte eine Variation der Intensität eines Erregungszustandes nicht zu einer höheren oder geringeren Intensität des emotionalen Zustandes (Siebert, 2002).
1. 3 Gegenwärtige neurowissenschaftliche Emotionstheorien
Innerhalb der gegenwärtigen neurowissenschaftlichen Emotionstheorien möchte ich die Ansätze dreier Wissenschaftler vorstellen, die für diese Arbeit wichtige Beiträge leisten. Es handelt sich dabei um die Furchttheorie von Joseph LeDoux, die dieser anhand von Tierversuchen entwickelte, die Übertragung des Ansatzes von LeDoux auf den Menschen durch Arne Öhman sowie die Theorie der somatischen Marker von Antonio Damasio.
1. 3. 1 Die Furchttheorie von LeDoux
Stellen Sie sich vor, sie gehen im Wald spazieren. Plötzlich sehen Sie vor sich etwas, was Sie auf den ersten Blick in Form und Farbe an eine Schlange erinnert. Sie werden erschrecken, stehen bleiben. Ihr Herz wird schneller schlagen, Adrenalin wird ausgeschüttet, und sie werden nach einer kurzen Schrecksekunde sehr wahrscheinlich weglaufen. Alternativ könnten Sie natürlich auch stehen bleiben, die Gefahrensituation genauer analysieren. Es könnte sein, dass sich die vermeintliche Schlange beim genaueren Hinsehen und Nachdenken als ein Ast entpuppt, der zufällig wie eine Schlange gewunden ist und zudem auch noch eine ähnliche Farbe aufweist. Und während Sie darüber nachdenken, ob es in unseren Breitengraden Schlangen gibt, die sich im Unterholz verstecken, könnte es auch passieren, dass Sie einen Stich in Ihrer Wade spüren, da der vermeintliche Ast in Wirklichkeit doch eine Schlange war. Im ersten Fall hätten Sie überlebt, da Sie beim ersten Anzeichen einer Gefahr die Flucht ergriffen haben, im zweiten Fall hätten Sie wahrscheinlich nicht überlebt, da Sie durch zu langes Reflektieren der Situation kostbare Sekunden verschenkt haben.
Mit diesem oder einem ähnlich gearteten Beispiel wird in der Regel die Emotionstheorie des amerikanischen Psychologen Joseph LeDoux veranschaulicht (Erk & Walter, 2003; Pritzel et al., 2003; Wassmann, 2002; LeDoux, 2006). Es soll gezeigt werden, dass es bei der Informationsverarbeitung in möglichen Gefahrensituationen zwei Wege gibt: Einen schnelleren Weg der Informationsverarbeitung und einen langsameren Weg, wobei der schnellere Weg evolutionär betrachtet der Überlebensstrategie eines Lebewesens nützlicher ist als der langsamere Weg (Erk & Walter, 2003).
Doch wie lassen sich diese beiden unterschiedlichen Wege, die anscheinend in hohem Maße einen Einfluss in Gefahrensituationen ausüben, erklären? In diesem Zusammenhang stellt LeDoux fest, dass der Amygdala, einem Teil des limbischen Systems, die zentrale Rolle zukommt.
In der Reaktion auf einen emotionalen Reiz unterscheidet er einen niederen, subkortikalen und einen höheren, kortikalen Weg der Informationsverarbeitung. Abbildung 4 verdeutlicht beide Wege der Informationsverarbeitung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Pfade der Informationsverarbeitung bei der Furchtkonditionierung (Modifiziert nach Erk & Walter, 2003, S. 54)
Ein emotionaler Reiz – hier die Schlange – wird wahrgenommen. Die Information wird direkt zum Thalamus weitergeleitet. Vom Thalamus aus erfolgt die Vergabelung der Informationsweiterleitung in einen kurzen Weg (1) direkt zur Amygdala und in einen langen Weg (2), der vom Thalamus über den Kortex zur Amygdala führt. Der kurze Weg hat den Vorteil, dass er zwar schnell, jedoch aufgrund der subkortikalen Verarbeitung auch ungenau ist. Der längere Weg führt vom Thalamus über neokortikale Assoziationsareale sowie über den Hippokampus zur Amygdala. Hierbei kann die Information präziser verarbeitet werden. So können beispielsweise Objekte genauer erkannt, der Kontext, in dem der Reiz auftritt, beurteilt und Erinnerungen an ähnliche Situationen aktiviert werden, um mit Hilfe dieser Informationen den ankommenden Reiz im Detail bewerten zu können. Dieser Weg benötigt jedoch mehr Zeit. Daher ist dieser Weg zwar genauer, aber auch langsamer (Erk & Walter, 2003; LeDoux, 2006).
Zu diesem oben dargestellten Ergebnis kommt LeDoux anhand von Tieruntersuchungen. In seinem Labor an der Universität von New York erforschte LeDoux an Ratten, wie diese Schaltung bei Angst funktioniert. Bei der klassischen Furchtkonditionierung wird der Ratte zunächst ein neutraler Reiz – zumeist ein Ton – präsentiert, dem kurz danach ein aversiver Reiz – beispielsweise ein Stromschlag am Fuß der Ratte – folgt. Das Versuchstier reagiert auf den aversiven Reiz mit einer Freezing-Reaktion bzw. mit vegetativen Reaktionen. So verharrt beispielsweise das Versuchstier und nimmt eine starre Körperhaltung ein, während gleichzeitig der Blutdruck ansteigt. Treten der neutrale und der aversive Reiz mehrmals gepaart auf, so zeigt die Ratte auch schon beim neutralen Reiz die typischen Angstreaktionen (Schandry, 2006; Pinel, 1997; LeDoux, 2006). Hier setzt nun LeDoux an: Indem er unterschiedliche Regionen und Strukturen des Gehirns der Ratten entfernte, versuchte er, das neuronale System, das diese Form der auditorischen Angstkonditionierung steuert, zu modellieren. Zunächst wurden Läsionen an den auditorischen Bahnen durchgeführt mit dem Ergebnis, dass beidseitige Läsionen des Corpus geniculatum mediale, dem auditorischen Relais-Kern des Thalamus, die Angstkonditionierung gegenüber einem Tonsignal verhinderten, während bilaterale Läsionen des auditorischen Kortex keine derartige Blockade verursachten. Hieraus lässt sich zweierlei schließen: Um eine Angstkonditionierung zu erreichen, die durch einen Ton ausgelöst werden soll, müssen a) die Reize den Corpus geniculatum mediale erreichen, nicht aber den auditorischen Kortex und b) muss eine Nervenbahn existieren, die vom Corpus geniculatum mediale zu einer anderen Stelle als dem auditorischen Kortex zieht. Als diese andere Stelle konnte die Amygdala identifiziert werden, denn Läsionen an der Amygdala führten zu einer Blockade der Angstkonditionierung ebenso wie Läsionen des Corpus geniculatum mediale (Pinel, 1997; Pritzel et al., 2003; Kandel, 2006; LeDoux, 2006). Wir haben gesehen, dass Läsionen des auditorischen Kortex die Angstkonditionierung nicht beeinflusst. Es wäre nun aber ein Fehler anzunehmen, der auditorische Kortex würde keine Rolle bei der Angstkonditionierung spielen. Vom Corpus geniculatus mediale ziehen jedoch die beiden schon erwähnten Bahnen zur Amygdala: die schnelle, direkte Bahn und die indirekte, langsamere Bahn, die einen Umweg über den auditorischen Kortex nimmt. Beide Wege können die Angstkonditionierung auf einfache Töne weiterleiten, und solange nur eine der beiden unterbrochen ist, läuft die Angstkonditionierung weiter (Pinel, 1997; Pritzel et al., 2003; Kandel, 2006; LeDoux, 2006). LeDoux folgert daraus, dass die Amygdala die zentrale Hirnstruktur bei der Vermittlung von Angstgefühlen ist (Pritzel et al., 2003; LeDoux, 2006).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Schaltkreis der Angstkonditionierung bei auditorischen Reizen (modifiziert nach Pinel, 1997, S. 471)
Vorhergehende Abbildung verdeutlicht den angenommenen Schaltkreis, der aller Wahrscheinlichkeit nach die Angstkonditionierung bei auditorischen Reizen steuert. Ein Tonsignal erreicht den Corpus geniculatum mediale im Thalamus. Von dort aus wird der Reiz entweder direkt an die Amygdala weitergeleitet oder indirekt über den auditorischen Kortex. In der Amygdala wird eine Beurteilung der emotionalen Bedeutung des Tons vorgenommen. Dabei orientiert sich die Amygdala an bereits mit dem Ton gemachte Erfahrungen. Anschließend werden die entsprechenden Schaltkreise für die sympathische Erregung und die Verhaltensreaktionen im Hypothalamus beziehungsweise im zentralen Höhlengrau des Mittelhirns (PAG) aktiviert (Pinel, 1997; Pritzel et al., 2003; Kandel, 2006; LeDoux, 2006).
Ein weiterer wichtiger Punkt in LeDoux’ Emotionstheorie wurde bereits angerissen. Dadurch, dass sich die Amygdala bei der Beurteilung der emotionalen Bedeutung eines Reizes an bereits gemacht Erfahrungen orientiert, wird das Gedächtnis in die Theorie hineingezogen. LeDoux nimmt an, dass die meisten Emotionen aufgrund von Lernerfahrungen entstehen. Dabei spielen nach LeDoux Langzeit- und Arbeitsgedächtnisvorgänge bei allen Emotionen die wesentliche Rolle. In Kapitel 3 werde ich gesondert auf das Gedächtnis zu sprechen kommen.
Emotionen werden nach LeDoux zuerst irgendwann einmal gelernt, dann im Langzeitgedächtnis abgespeichert und durch einen emotionsauslösenden Reiz ins Arbeitsgedächtnis geholt, wodurch die Emotion aktiviert ist (Pritzel et al., 2003; LeDoux, 2006). Für LeDoux ist Bewusstsein demnach eine Funktion des Arbeitsgedächtnisses. Erst wenn das Arbeitsgedächtnis erkennt, dass das Angstsystem aktiviert wurde, und diese Information zu den anderen Informationen aus der sinnlichen Wahrnehmung und der Erinnerung über einen Gegenstand oder eine Situation hinzufügt, wird Angst bewusst. Dennoch bleibt, so LeDoux, ein Großteil des Denkens und der Emotionserzeugung verborgen, weil er in Bereichen des Gehirns vor sich geht, die dem Bewusstsein nicht zugänglich sind. Zu diesen gehört die Amygdala, die unter anderem als Gefahrendetektor des Gehirns fungiert. Die Amygdala ist das Zentrum, das eine Information als Gefahr interpretiert und entsprechende Handlungsanweisungen an andere Abteilungen im Gehirn sendet (Wassmann, 2002; Pritzel et al., 2003; LeDoux, 2006).
1. 3. 2 Die Übertragung des Ansatzes von LeDoux auf den Menschen - Arne Öhman
LeDoux’ Erkenntnisse ergeben sich aus Untersuchungen an Ratten. Doch lassen sich diese Erkenntnisse auch auf den Menschen übertragen? Dieser Frage sind Arne Öhman und seine Kollegen am Karolinksa-Institut in Stockholm nachgegangen. Kann auch beim Menschen eine Furchtkonditionierung erfolgen, wenn die auslösenden Reize nicht bewusst wahrgenommen werden? Um es vorwegzunehmen: Die Ergebnisse von Öhman und Kollegen bejahten diese Frage. Eine Furchtkonditionierung beim Menschen ist durchaus möglich, wenn es sich um Reize handelt, die einen emotionalen Wert für den Menschen besitzen. Beispielsweise können Spinnen oder Schlangen als solche Reize dienen, aber auch ärgerliche, zornige Gesichter (Wassmann, 2002). Doch wodurch wird festgelegt, dass manche Reize einen höheren emotionalen Wert für uns besitzen als andere?
In seinen Untersuchungen ließ sich Öhman von der so genannten „Bereitschaftstheorie“ leiten, die Anfang der 70er Jahre von dem Experimentalpsychologen Martin Seligman ausgearbeitet und durch Untersuchungen von Susan Mineka bestätigt wurde (LeDoux, 2006). Nach LeDoux besagt diese Bereitschaftstheorie, dass wir „möglicherweise von der Evolution darauf vorbereitet (sind, UK), bestimmte Dinge leichter zu lernen als andere, und diese biologisch bedingten Fälle von Lernen sind besonders wirksam und nachhaltig (LeDoux, 2006, S. 254).“ Dass ein solches, durch die Evolution determiniertes Lernen tatsächlich besonders wirksam und nachhaltig ist, zeige sich, so LeDoux, bei Menschen, die unter Phobien leiden. Auch hier wird wiederum aus evolutionärer Sichtweise mit dem Ziel, Gefahren zwecks des Überlebens schnell zu erkennen, argumentiert: Auf einer frühen Entwicklungsstufe des Menschen konnte man von einer konstanten Umwelt mit gleich bleibenden Gefahrenquellen ausgehen. Durch diese Konstanz erwies es sich als sinnvoll, eine Methode zu entwickeln, mit deren Hilfe man leicht etwas über Dinge lernen konnte, die als Gefahrenquelle in Betracht kommen konnten. Diese Methode besitzen wir auch heute noch, obwohl sich die Umwelt wesentlich geändert hat. Aus diesem Grunde können wir leicht eine pathologische Angst vor Dingen oder Tieren entwickeln, die zwar in grauer Vorzeit eine besondere Gefahrenquelle darstellten, heute jedoch nicht mehr dieses eigentliche Gefahrenpotential für uns besitzen (LeDoux, 2006).
Susan Mineka unterstützte die Bereitschaftstheorie mit ihren Untersuchungen. Sie beobachtete, wie sich junge Affen mit ihren Müttern verhalten, wenn sie einer Gefahrensituation in Form einer Schlange ausgesetzt waren. Obwohl bislang davon ausgegangen wurde, Affen hätten eine angeborene Angst vor Schlangen, zeigten junge Affen, die von ihren Müttern getrennt waren und noch niemals zuvor eine Schlange gesehen hatten, keinerlei Furchtreaktionen. Erst als die jungen Affen mit ihren Müttern der Gefahrensituation gemeinsam ausgesetzt waren, übernahmen diese die Furchtreaktionen der Mütter. Die jungen Affen hatten also durch das Vorbild der Mutter sehr rasch gelernt, sich vor Schlangen zu fürchten. Wurde in der Versuchsanordnung indes die Gefahrenquelle durch ein unbedrohliches Objekt ersetzt, konnte kein schnelles und tief greifendes Beobachtungslernen festgestellt werden. Mineka schloss daraus, dass bestimmte biologisch relevante Reiz eine Eigenschaft besitzen, die das Beobachtungslernen mehr fördern als andere Reize (LeDoux, 2006).
An diesem Punkt knüpft Öhman an: Der heutige Mensch hat aus der Evolution heraus von seinen Vorfahren einen Mechanismus übernommen, durch den er leicht zu Furchtreaktionen in Situationen neigt, die sich für seine Vorfahren als bedrohlich erwiesen haben. Er hat eine Bereitschaft erlernt, Furcht vor Gefahren zu erwerben, die sich vielleicht heute nicht mehr als so bedrohlich erweisen wie in grauer Vorzeit (LeDoux, 2006).
Diese Annahme untermauerte Öhman durch Experimente, in denen er Versuchspersonen einerseits mit Objekten konfrontierte, von denen er annahm, dass diese einen bestimmten biologischen Reiz besitzen, der Menschen leicht mit Furcht reagieren lässt - beispielsweise Schlangen oder Spinnen -, andererseits sahen sich die Versuchspersonen Reizen gegenübergestellt, die diesen Reiz nicht besitzen wie zum Beispiel Blumen. So wurden in den Versuchsanordnungen Schlangen in einem Blumenbeet oder Spinnen, die sich teilweise unter Pilzen versteckt hatten, schneller erkannt als eine Blume unter Spinnen oder ein Pilz in einem Schlangennest (Wassmann, 2002). Bei Konditionierungsversuchen mit diesen furchtrelevanten und furchtirrelevanten Reizen zeigte sich, dass sich Furcht, die durch furchtrelevante Reize konditioniert wurde, als löschungsresistenter erwies als Furcht, die durch furchtirrelevante Reize konditioniert wurde (LeDoux, 2006). Wurde die Furcht mittels moderner furchtrelevanter Reize wie beispielsweise Schusswaffen konditioniert, so zeigte die Versuchsperson keinen Widerstand gegen eine Löschung, woraus Öhman schloss, die Evolution habe noch keine Zeit gehabt, diesen furchtrelevanten Reiz in den eigenen genetischen Mechanismus einzubauen (LeDoux, 2006). Ferner konnte Öhman in diesen Versuchen nachweisen, dass Menschen mit einer Spinnen- oder Schlangenphobie das Objekt ihrer Phobie besonders schnell entdeckten und stärker auf diesen Reiz reagierten als auf andere furchtrelevante Reize (Wassmann, 2002; LeDoux, 2006). Dies geschah auch dann, wenn die furchtrelevanten Reize maskiert wurden. Öhman zeigte Versuchspersonen mit einer Schlangen- oder Spinnenphobie für einen kurzen Augenblick von ein oder zwei Sekunden das Bild einer Schlange oder einer Spinne und projizierte unmittelbar danach ein neutrales Bild. Auf diese Weise wurde das vorangegangene Bild derart maskiert, dass die Versuchspersonen den furchtrelevanten Reiz nicht bewusst wahrnehmen konnten. Als Maske diente dabei das Bild der Schlange oder der Spinne, welches allerdings wie eine Art schlecht zusammengesetztes Puzzle derart verzerrt und entstellt war, dass das ursprüngliche Objekt nicht mehr erkennbar war. Dennoch zeigten die Versuchspersonen Furchtreaktionen: Das autonome Nervensystem reagierte auf diese Bilder mit Alarm, die elektrische Leitfähigkeit der Haut stieg an, ebenso die Herzfrequenz und der Blutdruck. Auch verstärkte sich der Lidschlagreflex. Nach eigenen Angaben fühlten sich die Versuchspersonen unwohler und erregter. Aus diesen Ergebnissen schloss Öhman, dass eine unterbewusste Wahrnehmung von furchtrelevanten Reizen bereits schon ausreiche, bei Phobiekern Angst auszulösen. Das Gehirn muss demnach einen Reiz nicht bewusst wahrnehmen, um mit einer Furchtreaktion zu reagieren. Es verfügt allem Anschein nach über einen Mechanismus, der für eine Furchtreaktion kein Bewusstsein benötigt, sondern schon unbewusst in Aktion tritt (Wassmann, 2002; LeDoux, 2006).
[...]
Details
- Titel
- Erkennen emotionalen Ausdrucksverhaltens bei Jugendlichen in der Adoleszenz
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2007
- Seiten
- 101
- Katalognummer
- V225723
- ISBN (eBook)
- 9783836611978
- Dateigröße
- 1007 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- emotionsforschung amygdala gedächtnis gesichtsausdruck adoleszenz
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2007, Erkennen emotionalen Ausdrucksverhaltens bei Jugendlichen in der Adoleszenz, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/225723
- Angelegt am
- 10.4.2008

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.