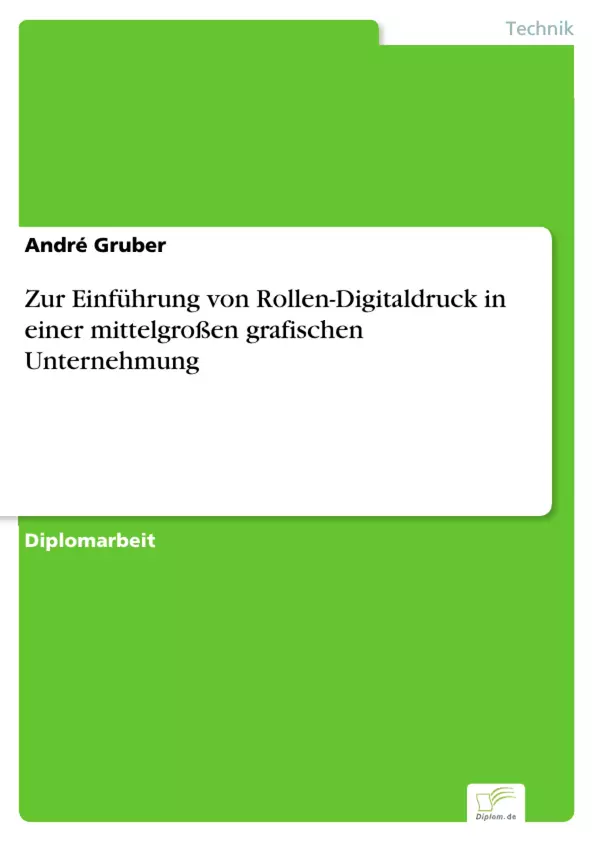Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos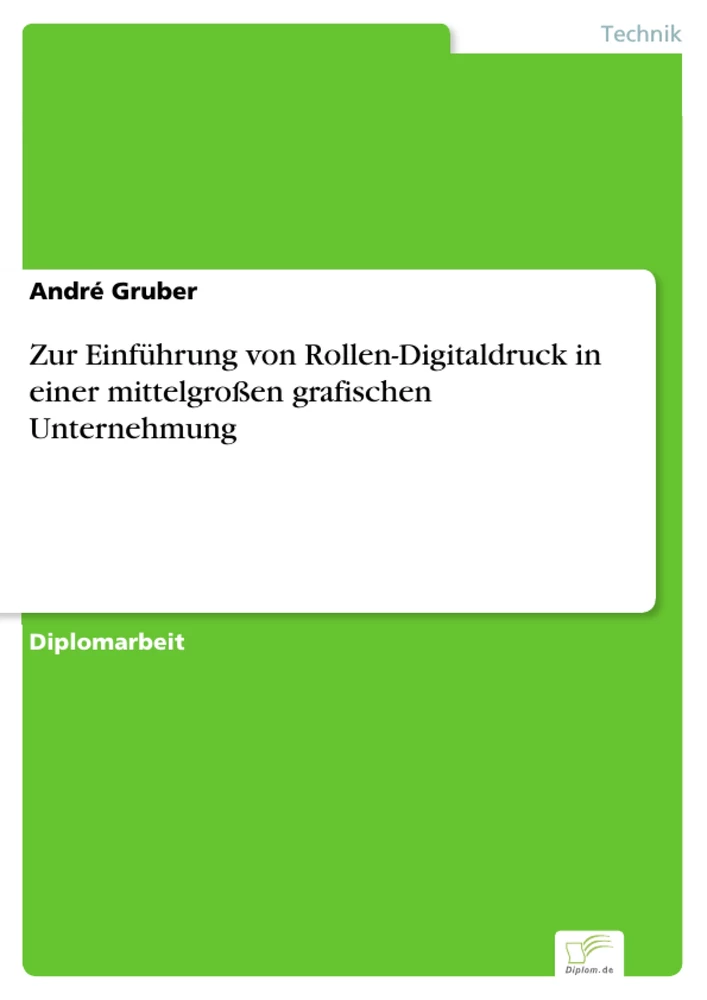
Zur Einführung von Rollen-Digitaldruck in einer mittelgroßen grafischen Unternehmung
Diplomarbeit, 2006, 107 Seiten
Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Note
2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
1 EINLEITUNG
1.1 Digitaldruck
1.1.1 Allgemeines
1.1.2 Non-Impact Verfahren
1.1.3 Funktionsprinzip
1.2 Aufgabenstellung
2 UNTERNEHMEN
2.1 Leitbild
2.2 Teilbereiche
2.2.1 Allgemeines
2.2.2 Druckvorstufe
2.2.3 Druck
2.2.4 Laserdruck
2.2.5 Druckweiterverarbeitung
2.3 Kostenzusammensetzung
2.4 SWOT-Analyse
3 UMWELT
3.1 Grundsätzliches
3.2 Markt
3.2.1 Allgemeines
3.2.2 Direktwerbung
3.3 Konkurrenz
3.4 Zielgruppe
3.5 Technologie
3.5.1 Allgemeines
3.5.2 Xerox
3.5.3 Xeikon
3.5.4 Hp Indigo
3.5.5 Océ
4 ZWISCHENBILANZ
4.1 Grundsätzliches
4.2 Anforderungskriterien
4.2.1 Datenhandling
4.2.2 Leistung
4.2.3 Qualität
4.2.4 Preis
4.3 Erkenntnis
5 EVALUATION
5.1 Grundsätzliches
5.2 Leistungskatalog Xeikon
5.2.1 Funktionsweise
5.2.2 Druckqualität
5.2.3 Kosten
5.2.4 Service und Schulung
5.2.5 Entwicklungsaussichten
5.3 Leistungskatalog Hp Indigo
5.3.1 Funktionsweise
5.3.2 Druckqualität
5.3.3 Kosten
5.3.4 Service und Schulung
5.3.5 Entwicklungsaussichten
5.4 Leistungskatalog Océ
5.4.1 Funktionsweise
5.4.2 Druckqualität
5.4.3 Kosten
5.4.4 Service und Schulung
5.4.5 Entwicklungsaussichten
5.5 Fazit
6 INVESTITIONSRECHNUNG
6.1 Grundsätzliches
6.2 Kostenvergleichsrechnung
6.2.1 Betriebs- und Kapitalkosten
6.2.2 Beurteilung
6.2.3 Kreuzungsstellen
6.3 Szenario
7 SCHLUSSFOLGERUNGEN
7.1 Entscheidungsfindung
7.2 Beschaffungsantrag
SCHLUSSWORT
ANHANG
Glossar
Quellenverzeichnis
Lebenslauf
Bestätigung
Dank
VORWORT
Seit der Vorstellung der ersten Digitaldrucksysteme im Herbst 1993 dürfte es jedem in der Branche bewusst geworden sein, dass eine neue Dimension in der Grafischen Industrie erreicht wurde und zwar die des digitalen Drucks. Die Euphorie der ersten Jahre ist zwar abgeschwächt, dennoch sind kontinuierlich wachsende Umsätze und die steigende Anzahl der Anwender an der Tagesordnung. Das Potential und die Möglichkeiten des Digitaldrucks sind enorm, trotzdem ist man sich nicht einig, wie die Zukunft wohl aussehen wird.
Ich denke, die Kommunikationslandschaft wird durch die fortschreitende Digitalisierung sehr verändert, dabei werden aber auch stets neue Medien und Märkte generiert, welche es für die bestehenden Unternehmen zu nutzen gilt. Die Druckindustrie hat diese Vorteile der digitalen Veränderungen für ihre Kunden zum Glück früh erkannt, denn «Print on Demand» ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor der heutigen Printproduktion.
Die digitalen Farbdrucksysteme zeigen sich im Vergleich zu den konventionellen Druckmaschinen im Bereich der Kleinstauflagen viel produktiver, ökonomischer und einfacher im Handling. Ihr Erwerb birgt aber auch Risiken und Gefahren, welche bei meiner ausführlichen Projektstudie erheblich reduziert werden sollen. Dabei muss ich etliche Faktoren des Marktes berücksichtigen und sollte mir bewusst sein, dass die digitale Produktion keine Ablösung des traditionellen Drucks bedeutet, sondern in der Gegenwart eher eine innovative Ergänzung dieser Dienstleistung im Bereich von Kleinstauflagen ist.
Die Herausforderung in der Zukunft liegt darin, die Kommunikation mit Printmedien durch den Digitaldruck zum dynamischen Bestandteil der Wertschöpfung eines Unternehmens oder einer Organisation zu machen. Als wichtigste Vorraussetzung gilt es, die Konsumenteninteressen optimal zu berücksichtigen, so dass die individuellen Druckerzeugnisse zum Erfolgsfaktor werden und der direkte Dialog mit unseren Kunden weiterhin gepflegt werden kann.
1. EINLEITUNG
1.1 DIGITALDRUCK
1.1.1 ALLGEMEINES
Der Digitaldruck ist ein Druckverfahren, bei dem das Druckbild direkt von einem Computer in eine Druckmaschine übertragen wird. Die Herstellung von Printmedien mit personalisier- und individualisierbaren Inhalten kann somit in kürzester Zeit realisiert werden, ohne dass sich die Druckqualität vom gewohnten klassischen Offsetdruck unterscheidet. Da die tonerbasierten Systeme keinen Punktezuwachs aufweisen, zeigen sie auf unterschiedlichen Papieren (gestrichen/ungestrichen) mehr Konstanz bezüglich Farben und Tonwerten. Es handelt sich meist um ein elektrofotografisches Drucksystem wie einen Laserdrucker oder auch anderen NIP-Verfahren, welche keine festen Druckformen benötigen und somit jeden Bogen anders bedrucken können. Neben der aufwändigen Herstellung der Offsetdruckplatten erübrigt sich auch das «Proofen» für das Gut zum Druck. Es braucht hier keine zeitraubende Simulation des späteren Druckverfahrens, sondern man druckt einfach auf dem Digitalsystem eine Seite aus und legt sie dem Kunden vor.
Digitaler Aufbau einer Druckseite
Grafik 1
Das ermöglicht auch bei kleinsten Auflagen kostengünstig variable Drucke wie Rechnungen, Kontoauszüge oder auch gezielt auf den Empfänger abgestimmte Werbung im Direktmarketing wirtschaftlich zu produzieren. Die Digitalisierung bringt in allen Bereichen mehr Effizienz, kurze Produktionszeiten und vor allem auch einen verbesserten Umweltschutz, denn die Materialeinsparungen und Recyclingmöglichkeiten in jeglichen Prozessen sind sehr gross.
Es erstaunt nicht, dass sich der Digitaldruck seinen eigentlichen Markt im «Print on Demand» oder «1:1-Marketing» geschaffen hat. Dieser wird künftig weiter wachsen und dabei entstehen auch neue Wettbewerbsvorteile gegenüber dem konventionellen Druck, welche für die Geschäfts-Beziehungen sehr interessant sein dürften. Beispielsweise können die Korrekturen in Text und Bild noch kurz vor der Produktion ausgeführt werden, ohne dass ein grosser Zeitverlust entsteht und deshalb jederzeit eine hohe Flexibilität gewährleistet werden kann. Mit zusätzlichen Inline-Fertigungsmöglichkeiten wie das Schneiden, Falzen und Stanzen werden weniger Arbeitsgänge benötigt und die Lieferfristen dabei enorm verkürzt. Somit muss nur nach Bedarf gedruckt werden und hohe Lager- sowie Entsorgungskosten entfallen, was sich folglich positiv auf den Verkaufspreis auswirkt. Der eigentliche USP dieses Systems ist aber der variable Druck mit Text und Bild, welcher neue Perspektiven und Chancen ermöglicht und das Marketing noch wirkungsvoller zu gestalten vermag. Die Geschäftskommunikation ist im Wandel und diese Entwicklung hat zur Folge, dass «Digital» zum bestimmenden Thema der Grafischen Branche geworden ist.
1.1.2 NON-IMPACT VERFAHREN
Die dominante und erfolgreichste digitale Drucktechnik im Hochleistungsbereich ist die Elektrofotografie. Sie ist auch als Xerografie bekannt und überzeugt den Markt mit ihrer Zuverlässigkeit, der erreichbaren Druckqualität und den tiefen Produktionskosten. Daneben sind auf der Grafik die anderen NIP-Technologien zu sehen, welche aber für diese Arbeit weniger relevant sein dürften.
Grafik 2
1.1.3 FUNKTIONSPRINZIP
Auf der folgenden Abbildung werden die Funktionseinheiten auf Basis der Non-Impact Drucktechnologien ersichtlich. Es wird mit der Ausnahme des Ink-Jet Verfahrens ein latentes (verborgenes) Zwischenbild benutzt. Deshalb kommen hier Toner zum Einsatz, die entsprechend den physikalischen Eigenschaften beim Aufbau des latenten Bildes angepasst sind. Man unterscheidet Pudertoner (Trockentoner) und Flüssigtoner von Hp-Indigo voneinander und diese besitzen folgende Eigenschaften:
Tonersysteme für NIP-Technologien
Grafik 3
Pudertoner
Grafik 4
a) durch mechanische Prozesse hergestellter Toner (Agfa)
b) über chemischen Prozess hergestellter Toner (OKI Data)
c) Zwei-/Mehr-Komponenten-Toner-System: Tonerpartikel auf Carrier-Partikel (Carrier-Durchmesser ca. 80 Mikrometer)
Der in der Druckindustrie überwiegend eingesetzte Mehrkomponenten-Toner hat im Gegensatz zu den Einkomponenten-Toner den Vorteil nicht zu Stauben, eine Erhöhung der Druckgeschwindigkeit und die kontinuierliche Gleichmässigkeit bei grösseren Farbflächen.
Flüssigtoner
Der vor allem von der Firma HP (Hewlett Packard) eingesetzte Flüssigtoner besteht aus Tonerteilchen und einer Trägerflüssigkeit. Diese Flüssigkeit hat eine bessere Transporteigenschaft als der Pudertoner und deshalb können die Teilchen auch kleiner sein. Dadurch entsteht ein klarer Vorteil gegenüber des Pudertoners, denn besonders hinsichtlich der Wiedergabe kleiner Details ist die Qualität hervorragend.
Prinzip der Druckeinheit für Computer to Print (NIP-Technologie)
Grafik 5
1. Bebilderung
2. Einfärbung
3. Tonerübertragung (Druck)
4. Tonerfixierung
5. Reinigung (Konditionierung)
1.2 AUFGABENSTELLUNG
Die Geschäftsleitung der Conzett + Walter AG ist stets bestrebt, die Kundenbedürfnisse in Einklang mit den betrieblich wirtschaftlichen Möglichkeiten der Unternehmung zu bringen. Die wegweisende Richtung der Grafischen Industrie ist dabei entscheidend und an dieser Stelle ist das grosse Wachstumspotenzial des Digitaldrucks nicht zu übersehen. Diese verlockende Perspektive ist für jedes KMU nüchtern zu betrachten, aber der springende Punkt bleibt, dass die Branche unter saisonalen Überkapazitäten sowie Preiserosion leidet. Deshalb hat C +W im Herbst 2005 das Projekt «Rollen-Digitaldruck» lanciert. Um dabei aber Fehlinvestitionen zu verhindern wird zur Erreichbarkeit des Projektzieles eine vorsorgliche Machbarkeitsstudie durchgeführt. Diese soll in erster Linie eventuelle Widersprüche zwischen diesen quantifizierten Anforderungen und bestehenden Erkenntnissen aufdecken. Vielfach leiten sich schon während der Arbeit neue Lösungswege oder Möglichkeiten für kundenspezifische Produkte und Dienstleistungen ab, die in der Folge noch gewinnbringend in das Angebot eingeführt werden können.
Zu Beginn der Machbarkeitsstudie, welche nach DIN 69905 den korrekten Begriff «Projektstudie» erhält, wird die Unternehmung und ihre Teilbereiche analysiert. Dazu werden sämtliche relevanten Messgrössen untersucht, um diese in einer späteren Phase den gewonnenen Kennzahlen des Digitaldrucks gegenüberzustellen. Aber auch die Umwelt darf nicht außer Acht gelassen werden, denn die Konkurrenz schläft bekanntlich nie und die neuen technologischen Trends sind ebenso wichtig wie die allgemeine Marktbeurteilung. Eine Umfrage bei der anvisierten Zielgruppe sollte dann noch einige Informationen über die Akzeptanz bezüglich Druckqualität des neuen Verfahrens liefern, bevor eine Zwischenbilanz gezogen wird und mit der eigentlichen Evaluation der verschiedenen Maschinenherstellernund ihren Leistungskatalogen begonnen werden kann. Anschliessend soll eine Investitionsrechnung neue Erkenntnisse bringen, welche die Entscheidung der Geschäftsleitung erleichtert und die Datengrundlage für ein realistisches Risikomanagement an den Tag legt.
Das Ziel ist es, eine erfolgreiche Produktion und Supply Chain zu erreichen, die durch Optimierung in der Anfangsphase perfektioniert wird. Das bedeutet für die Conzett + Walter AG die Durchlaufzeiten zu verkürzen, die Flexibilität zu erhöhen, perfekte Qualität zu liefern und damit gleichzeitig die Kosten zu senken.
[...]
Details
- Titel
- Zur Einführung von Rollen-Digitaldruck in einer mittelgroßen grafischen Unternehmung
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 107
- Katalognummer
- V224892
- ISBN (eBook)
- 9783832499952
- ISBN (Buch)
- 9783838699950
- Dateigröße
- 1800 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- technik verlag digitaldruck werbung kosten
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2006, Zur Einführung von Rollen-Digitaldruck in einer mittelgroßen grafischen Unternehmung, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/224892
- Angelegt am
- 30.11.2006

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.