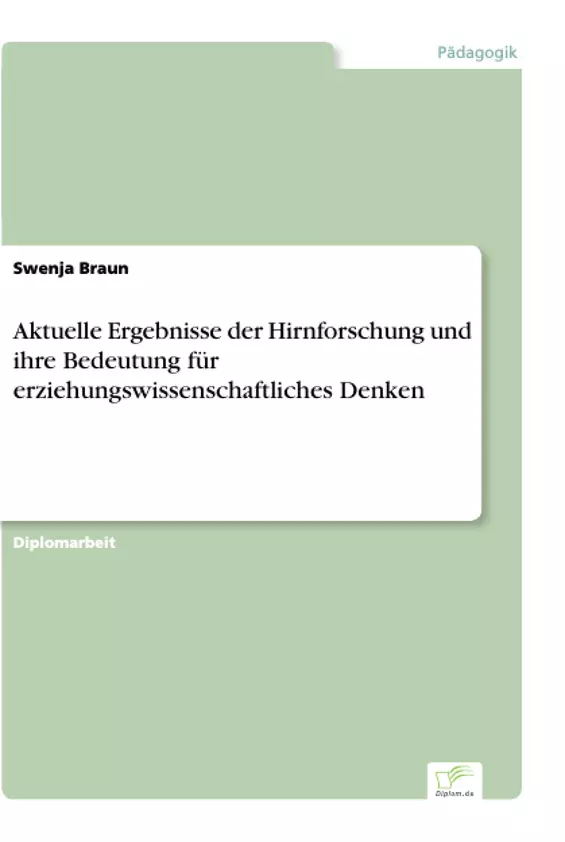Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos
Aktuelle Ergebnisse der Hirnforschung und ihre Bedeutung für erziehungswissenschaftliches Denken
Diplomarbeit, 2005, 92 Seiten
Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Universität Vechta; früher Hochschule Vechta (unbekannt, Erziehungswissenschaft)
Note
1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Die Natur des menschlichen Gehirns aus Sicht des Neurophysiologen Wolf Singer
1.1 Die Evolution des menschlichen Gehirns
1.1.1 Biologische Evolution
1.1.2 Kulturelle Evolution
1.2 Die Bindung des Gehirns
1.2.1 Wahrnehmung - Bewusstsein - Empfindung - Ich-Identität
1.2.2 Bindungsprobleme
1.2.3 Der freie Wille
2 Aspekte der Interdisziplinarität anhand eines Exkurses in die Natur- Geistes- und Sozialwissenschaften
2.1 Biochemie
2.1.1 Anatomie und Funktionen des Nervensystems
2.1.2 Bezugnahme zu Ergebnissen der Neurophysiologie
2.2 Philosophie
2.2.1 Freier Wille
2.2.2 Bezugnahme zu Ergebnissen der Neurophysiologie
2.3 Psychologie
2.3.1 Entwicklung, Lernen, Motivation
2.3.2 Bezugnahme zu Ergebnissen der Neurophysiologie
2.4 Soziologe
2.4.1 Systeme
2.4.2 Bezugnahme zu Ergebnissen der Neurophysiologie
2.5 Zwischenbilanz
3 Rückschlüsse auf erziehungswissenschaftliches Denken
3.1 Erziehung
3.1.1 Neurowissenschaftliche Forderungen
3.1.2 Konzeptionelle Perspektiven
3.2 Bildung
3.2.1 Neurowissenschaftliche Forderungen
3.2.2 Konzeptionelle Perspektiven
Fazit
Glossar
Literaturverzeichnis
Einleitung
Die vorliegende Arbeit findet ihren Anlass in den gegenwärtigen Diskussionen und Kontroversen[1] um die aktuellen Erkenntnissen der Hirnforschung. Unter Betrachtung der Forschungsergebnisse deutet sich die Notwendigkeit an, Paradigmen aus Nachbarwissenschaften zu hinterfragen, denn, „...wie schon mehrmals in der Wissenschaftsgeschichte scheint auch hier die Macht des Faktischen zusammen mit dem Drang nach logisch konsistenten Interpretationen die für unverrückbar gehaltenen Kategoriegrenzen zu erodieren.“[2]
Die gedankliche Konsequenz „ ... die Grenzen zwischen Beschreibungssystemen für neuronale und psychische Prozess überbrücken ...“[3] zu wollen wird von den Nachbardisziplinen tendenziell skeptisch gewertet. Als besondere Herausforderung in den zur Zeit geführten Diskussionen stellt sich demnach die wissenschaftstheoretische Frage, ob es überhaupt möglich ist, die jeweiligen spezifischen Termini und Grundlagen reduktionistisch in einer Basiswissenschaft zu definieren.
Der Frankfurter Neurophysiologe Wolf Singer hält einen interdisziplinären Brückenschlag langfristig gesehen für unumgänglich., damit die Erkenntnisse, die in Geistes- und Naturwissenschaften gewonnen werden, dienlich und überprüfbar werden. Das Resultat dieses Paradigmenwechsels könnte die gleichwertige Partizipation der beteiligten Wissenschaftszweige sein. „Es gab Zeiten, da waren die Wissenschaften eins und empfanden sich mit den Künsten den gleichen Fragen verpflichtet: die unselige Aufspaltung in Geistes- und Naturwissenschaften, an die wir uns gewöhnt haben, als entspräche sie einem Naturgesetz, wäre noch für Leibniz oder Kant unvorstellbar gewesen.“[4]
In der vorliegenden Arbeit wird das Ziel verfolgt diesen interdisziplinären Brückenschlag aus dem erziehungswissenschaftlichen Fokus zu betrachten. Das Fundament bilden dabei die Ergebnisse der Hirnforschung, wie sie Wolf Singer in seinem Buch „Beobachter im Gehirn“[5] dargestellt hat.
Im ersten Teil der Arbeit werden die für die Erziehungswissenschaft relevanten Kerngedanken und Forschungsergebnisse der Neurobiologie und Neurologie extrahiert und dargestellt. Dabei wird auf einen historischen Exkurs[6] in die Entwicklung der Hirnforschung verzichtet, um den Rahmen einer Diplomarbeit nicht zu überschreiten.
Stattdessen liegt der Fokus auf der spezifisch menschlichen Evolution, die – als einzige – sowohl eine biologische, als auch eine kulturelle Entwicklung umfasst. Im weiteren Verlauf wird die Betrachtung insofern ausgeweitet, als dass Grenzüberschreitungen zu benachbarten Wissenschaftsdisziplinen aus den Texten extrahiert werden. Dabei liegt der Fokus ausschließlich auf Erkenntnissen, die auch aus erziehungswissenschaftlicher Sicht relevant erscheinen.
Die im ersten Teil destillierten Aussagen legen den Grenzen überschreitenden Exkurs in die wissenschaftlichen Disziplinen nahe, die sich aus ihrer Tradition heraus mit Fragestellungen, wie beispielsweise der Frage nach dem freien Willen, der Entwicklung menschlicher Kultur oder der Verarbeitung von Umwelteinflüssen auseinander gesetzt haben und die nun auch das Gebiet der Hirnforschung betreffen .
Deshalb werden im zweiten Teil zunächst ebendiese überschneidenden Aspekte aufgegriffen und aus dem Fokus derjenigen Wissenschaften betrachtet, die sich aus der historischen Tradition heraus mit diesen Fragestellungen beschäftigt haben. Im weiteren Verlauf werden Diskrepanzen und Gemeinsamkeiten zwischen den Erkenntnissen der jeweiligen Traditionswissenschaften und denen der Hirnforschung zusammenfassend dargestellt. Dabei kann im Rahmen dieser Arbeit nicht über den Einbezug exemplarisch ausgewählter Theorien, beziehungsweise deren Vertreter, hinausgegangen werden.
Im dritten Teil dieser Abhandlung werden Forderungen an die Erziehungswissenschaft zusammengestellt. Dazu werden die sich aus dem ersten und zweiten Teil der vorliegenden Arbeit ergebenden Schlussfolgerungen, sowie Singers eigene Stellungsnahmen zur Erziehung und Bildung zunächst formuliert und im Anschluss auf ihre Brauchbarkeit für eine Neuformulierung erziehungswissenschaftlicher Sichtweisen überprüft.
Mit der vorliegenden Untersuchung wird demnach der Anspruch verfolgt, den Anregungen und Erkenntnissen der aktuellen Hirnforschung insofern Rechnung zu tragen, als eine interdisziplinäre Öffnung der Erziehungswissenschaft auf der Basis neurowissenschaftlicher Erkenntnisse bemüht wird.
Dabei bietet es sich an pragmatisch vorzugehen, weshalb das komplexe Themenfeld der Hirnforschung umrissen und eingegrenzt wird. Das wissenschaftliche Umfeld wird – soweit erforderlich – einbezogen, um schlussendlich brauchbare Konturen zu gewinnen, die den von Singer geforderten Brückenschlag zwischen den Wissenschaftsdisziplinen in einem eng vorgegebenen Kontext zu ermöglichen.
Diese Arbeit erhebt demnach nicht den Anspruch auf Emergenz, angestrebt wird lediglich die Ableitung von Rahmenbedingungen, innerhalb derer erziehungswissenschaftliche Grundbegriffe, unter Einbezug neurologischer und neurobiologischer Gesichtspunkte, perspektivisch neu definiert werden können.
1 Die Natur des menschlichen gehirns aus sicht des Neurophysiologen Wolf singer
In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit relevanten Erkenntnisse über die Strukturen und Funktionen des menschlichen Gehirns zusammengefasst. Grundsätzlich ist die Evolution bei der Entwicklung des Gehirns konservativ[7] vorgegangen, denn die Gehirnstruktur von Säugetieren unterscheidet sich im wesentlichen kaum. Die spezifisch menschliche Weiterentwicklung ist demnach in der Betrachtung der kulturellen Evolution zu suchen.[8]
1.1 Die Evolution des menschlichen Gehirns
Innerhalb der Zusammenfassung der biologischen Evolution werden sowohl strukturelle Merkmale als auch konventionelle Funktionen des Gehirns erörtert. Durch das Explizieren der kulturellen Evolution lassen sich im Anschluss innovative, typisch menschliche Verhaltenseigenschaften deuten, die im weiteren Verlauf der Arbeit als Erklärung für sozialisiertes humanes Verhalten gelten sollen.
1.1.1 Biologische Evolution
Die Struktur des Gehirns ergibt sich – beim Menschen ebenso wie beim Tier – aus einem Entwicklungsprozess, in dem sich, unter dem Druck der Selektion eine natürliche Ausdifferenzierung vollzieht.[9] Die über Millionen von Jahren beibehaltene strukturelle Entwicklung des Gehirns lässt physikalische Reize in neuronale Aktivität umwandeln. Damit ist grob die Basisfunktion aller Nervensysteme beschrieben.
Ebenso ist die Funktionsweise von Nervensystemen nahezu identisch geblieben. Die Kommunikation findet über biochemische Signale statt. Um große Strecken ohne Informationseinbußen zu überbrücken, werden elektrische Signale eingesetzt.
Die Weiterentwicklung der Hirnleistung ist im Grunde lediglich auf den Differenziertheitsgrad und die Komplexität der Nervennetze zurück zu führen, in denen die Nervenzellen miteinander verschaltet sind.
Demnach vermehren sich die vorhandenen Strukturen lediglich quantitativ, um sich qualitativ zu verbessern. Diese Vermehrung ist beim Menschen hauptsächlich an der Großhirnrinde festzustellen. Die Großhirnrinde expandierte und mit ihr die Zahl der Nervenzellen. Schließlich entwickelten sich eigene Areale, die sich mit spezifischen Aufgaben befassen konnten, um die Zunahme an Komplexität zu strukturieren.[10]
Alles das, was den Menschen ausmacht, muss demnach auf der Basis dieser immer gleich ablaufenden Prozesse und Strukturierungen erklärt werden, die konventionell geblieben sind, seit sich die Meeresschnecke evolutionär entwickelte.
Es stellt sich nun die Frage, wie durch die quantitative Vermehrung der immer gleichen Struktur eine qualitative Veränderung erreicht werden kann, so wie sie dem menschlichen Großhirn zueigen ist.
Singer nimmt an, dass dieses Phänomen durch Metarepräsentationen[11] erklärt werden kann. Metarepräsentationen werden, wie im nächsten Kapitel noch genauer dargestellt wird, als die Wiederanwendung eines Prozesses auf sich selbst beschrieben. Dieser Hypothese zufolge haben hoch entwickelte Gehirne Areale ausgebildet, die nicht mehr in direktem Kontakt zu den Sinnesorganen stehen. Diese neuen Areale reagieren so auf die vorhandenen alten Areale wie ebendiese auf die Sinnesorgane reagieren.[12] Diese neuen Areale erlauben eine Erweiterung des Verhaltensrepertoires, indem sie Signale „... indirekt über die bereits vorhandenen, stammesgeschichtlich älteren primären sensorischen Hirnareale beziehen“.[13] Die neueren Areale sind bei Ratten, Katzen, Hunden und in besonderem Maße bei Primaten festzustellen.
Wir tun gut daran, uns „... das Gehirn als distributiv organisiertes, hochdynamisches System vorzustellen, das sich selbst organisiert, anstatt seine Funktionen zu einer zentralistischen Bewertungs- und Entscheidungsinstanz unterzuordnen.“[14] Diese Aussage Singers zum menschlichen Gehirn ist zu erläutern.
Das hoch entwickelte Gehirn arbeitet zwar mit den gleichen Strategien und Verarbeitungsprinzipien wie die Gehirne niederer Lebewesen es tun, aber es ist zu einer neuen Qualität der Selbstorganisation herangewachsen. Darüber haben sich Sprache, Bewusstsein und Kreativität entwickelt Die neuen Areale arbeiten in geschlossenen Systemen und sind in ihrer Kommunikation eng miteinander verknüpft. Die zu verarbeitenden internen Inhalte der neuen Hirnareale werden laut Singers Hypothese über raum-zeitliche Erregungsmuster[15] repräsentiert, um den informationsverarbeitenden Prozess zu aktivieren. Die raum-zeitlichen Muster werden bereits vorhandenen kognitiven Mustern unterworfen und verglichen. Somit entstehen Metarepräsentationen.
„Wenn die Ergebnisse primärer kognitiver Prozesse erneut einer Analyse unterzogen werden, kommt dies der Reflexion eigener Wahrnehmungsprozesse gleich. Zieht man in Betracht, daß die Ergebnisse dieser kognitiven Operationen höherer Ordnung ihrerseits wiederum miteinander verglichen und verrechnet werden, und daß die Ergebnisse dieser transmodalen wiederum in neu hinzugekommenen Hirnarealen eine abstrakte Kodierung erfahren können, dann läßt sich erahnen, wie phänomenales Bewusstsein, das Sich-Gewahrsein von Wahrnehmungen und Empfindungen, entstanden sein können.“[16]
Metabeschreibungen bieten also die Möglichkeit der Abstraktion im Sinne einer symbolischen Beschreibung und des episodischen Gedächtnisses.[17] Das Gehirn ist durch diese Art der Verarbeitung in der Lage ein phänomenales Bewusstsein zu entwickeln, denn: „Das System beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selbst; 80 bis 90% der Verbindungen sind dem inneren Monolog gewidmet.“[18] Dies ist eine Erklärung dafür, weshalb Menschen einen Gegenstand nicht nur ertasten, erblicken oder hören, sondern ihn auch in ihrer Vorstellung gewahr werden können.
Da der Informationsaustausch in der Großhirnrinde stets wieder nach dem oben genannten Prinzip erfolgt, können Reaktionen oder Verhaltensstrategien durch Metarepräsentationen abstrahiert werden. Bewusst- und Gewahrwerdung erfolgt also in höheren Gehirnen, indem diese sich bei der Verarbeitung durch Rückkopplungen selbst überprüfen und reflektieren können.[19]
Bis hierhin kann festgehalten werden, dass hochentwickelte Gehirne über drei Mechanismen verfügen, sich Wissen anzueignen. Das Gehirn nutzt genetisch gespeicherte Informationen, in der frühen Ontogenese erworbenes Erfahrungswissen und durch Lernen erworbenes Wissen. Die beiden zunächst genannten Mechanismen beziehen sich auf strukturelle Veränderungen im Gehirn, der zuletzt genannte Mechanismus birgt funktionelle Veränderungen.[20]
Neben gelerntem Wissen und Erfahrungswissen ist, gerade aus erziehungswissenschaftlicher Sicht, das Augenmerk auf Singers Annahmen über genetisch verankertes Vorwissen, dass hoch entwickelte Gehirne im Verlauf der biologischen Evolution angelegt haben, zu richten.
Bei der Klärung dieser Frage arbeitet Singer mit der beispielhaften Erläuterung der visuellen Wahrnehmung.[21] Er kommt letztlich zu dem Schluss, dass drei Faktoren für die kognitive Individualentwicklung von Bedeutung sind. Neben dem in der frühkindlichen Ontogenese erworbenen Erfahrungswissen und dem durch Lernen erworbenen Wissen wird als dritter Mechanismus das während der Evolution erworbene Wissen über die Welt eingebracht.
„Die Informationen, die zur Ausbildung dieser Architekturen während der Individualentwicklung führt, ist in den Genen gespeichert und wird mit nur geringfügigen Variationen von Generation zu Generation weitergegeben.“[22]
Jedoch sollte behutsam mit der Erkenntnis über das Vorhandensein der genetischen Dispositionen, die aus der biologischen Evolution hervor gegangen sind, umgegangen werden. Denn Singer betont auch, „... dass das Hirn genetisch vorprogrammiert ist für ganz bestimmte Leistungen, aber beim Menschen, weil sich die Entwicklung der Hardware über so lange Zeit nach der Geburt erstreckt, kann die Architektur durch Erfahrung verändert und ein Teil des Programms installiert werden.“[23]
Eine dieser genetisch verankerten urmenschlichen Eigenschaften ist das Neugierverhalten. Es liegt jedem kreativen Schaffen, der Kunst und der Lernmotivation zugrunde. Das obige Zitat verweist jedoch auf einen weiteren Aspekt, der zumindest Teilen der evolutionären Disposition zugrunde liegt. Deutlich betont Singer die Bedeutung der „ kritischen Phasen“[24], innerhalb derer eine besonders hohe Lernbereitschaft vorhanden ist. Verstreichen diese Phasen, ohne dass die Ausprägung der dafür vorgesehenen Gehirnarchitektur durch die Umwelt angeregt wird, entstehen zum Teil irreversible Defizite, da die ungenutzten neuronalen Anlagen gelöscht werden. Singer weist dabei nicht nur auf Untersuchungen hin, die sich mit dem Sehsystem befassen, sondern überträgt diese Art der Deprivation auch auf das kreative Schaffen, dem er eine hohe Bedeutung für ein funktionierendes Gesellschaftssystem beimisst, wenn er meint, ... es könnte also sein, daß wir ein Entwicklungsstadium erreicht haben, in welchem eine Fähigkeit [gemeint sind künstlerische Erkenntnis und Ausdrucksfähigkeit] , die zunächst als Epiphänomen bestimmter adaptiver Funktionen entstanden ist, plötzlich eine wichtige, möglicherweise arterhaltende Funktion bekommen hat“[25]
Mit ebendiesem Argument bietet es sich an, die kulturelle Evolution eingehender zu betrachten.
1.1.2 Kulturelle Evolution
In der Zusammenschau Singers Aussagen zur kulturellen Evolution stößt man immer wieder auf den Begriff der Neugier, denn das Explorationsverhalten liegt allem kreativen Schaffen und so jeder künstlerischen Erkenntnis und Ausdrucksfähigkeit zugrunde. Wie bereits erwähnt, ist das Neugierverhalten genetisch verankert. „ Es ist dies eine Verhaltensdisposition, die sich im Laufe der biologischen Evolution herausgebildet hat, weil sie dem Überleben dient.“[26] Dabei ist die Motivation Neues zu entdecken ungerichtet, denn noch nicht Entdecktes kann auch nicht vorher gewusst werden. Der Mensch versucht über Exploration die Umwelt, in der er sich zurecht finden muss, zu verstehen. „Der spielerische Umgang mit Vorgefundenem, die Suche nach Überraschungen, oft auch die angstdurchsetzte Lust am Fremden, führen zur Entdeckung neuer Phänomene.“[27]
Das Glücksgefühl über eine neue Entdeckung setzt Dopamin frei, dieser Botenstoff regt das Gehirn zur Informationsverarbeitung an und ebendieser Mechanismus liegt auch der Neugier zugrunde. Durch Dopamin beeinflusst kann das Gehirn Zusammenhänge herstellen. Die Freude über den Erfolg setzt wiederum Dopamin frei und das Gehirn wird erneut dazu angeregt, in der Welt und den Lebensbezügen einen Sinn zu suchen. Mit diesem Motor wird der Kreislauf der menschlichen Exploration und Kreativität in Gang gehalten.[28]. Die Anreize zur Dopaminausschüttung können demnach sowohl von außen, als auch von innen ausgelöst werden. Singer erwähnt im Fall der selbst inszenierten Erregung Kontrollsysteme, die selbst erzeugte Aktivität „offenbar mit angenehmen Empfindungen assoziieren“[29].
Singer beschreibt drei prägnante Träger der kulturellen Evolution des Menschen[30].
Eine der typisch menschlichen Eigenschaften ist, wie bereits erwähnt, das Reflexionsvermögen. Mit Hilfe dieser Eigenschaft sind kognitive Prozesse und mentale Verläufe des Inneren erfassbar und können in der Folge symbolisch repräsentiert und schließlich in rationaler Sprache nach außen transportiert werden.
Ein weiterer Träger der kulturellen Evolution ist die Empathie. Menschen sind in der Lage ein Fremdbild von ihrem Gegenüber zu erstellen, aus dem heraus sie eine der Situation des Anderen angemessene „Theorie des Geistes“[31] entwickeln können.
Als dritte Grundlage der kulturellen Evolution schildert Singer „unsere Gabe, zu Lebzeiten erworbenes Wissen über die Welt so zu speichern und zu kodieren, daß es durch Belehrung und Erziehung auf die nächste Generation tradierbar wird.“[32] In diesem Träger unserer kulturellen Evolution sieht Singer auch die Kunst verankert, welche die menschliche Kultur zu immer neuen Erkenntnissen gebracht hat. Seit der Entwicklung und des erfolgreichen Einsatzes des Neugierverhaltens hat der Mensch begonnen, seine Zukunft selbst zu gestalten. Diesen Eingriff in das eigene Dasein, bezeichnet Singer sowohl als „ Sündenfall“[33] wie auch als natürlich menschlichen Prozess: „Doch Kultur, Zivilisation, Wissenschaft und auch Werkzeuge sind die Folge eines evolutiven Prozesses, der genauso natürlich ist wie die Evolution selbst.“[34]
Steigerten kreative Prozesse zunächst die Überlebenschancen, könnte doch später „der kommunikative Charakter der Erzeugnisse künstlerischer Aktivität“[35] eine verbindende Funktion für das soziale Leben und den Zusammenhalt einer Gruppe dargestellt haben. Über die gemeinsame Kultur, die wesentlich durch verbindende Kunst ausgedrückt, gefestigt und tradiert wurde, könnten identifikationsstiftende Funktionen entstanden sein. Sollte dies der Fall sein, so müsste es laut Singer gewisse ästhetischen Übereinstimmungen geben. Zur Bestätigung solcher künstlerischer phylogenetischer Universalien führt Singer die Symmetrien des Goldenen Schnitts, Moll- und Durakkorde, Farbkontraste sowie Quinten und Terze an.[36]
Wird die Existenz ästhetischer Regeln angenommen, so muss in der Folge nach der Prägbarkeit eben dieser Regeln gefragt werden. Singer orientiert sich bei der Beantwortung dieser Fragestellung am Spracherwerb, da dieser Vorgang eine andere Variante der menschlichen Enkulturation darstellt. In bezug auf den Spracherwerb kann festgehalten werden, dass Sprachstrukturen im Vorwissen des Gehirns bereits unspezifisch verankert sind. Wird die Analogie zur Sprache beibehalten, so muss allerdings hinzugefügt werden, dass ein Niveau der Differenziertheit und der Abstraktion innerhalb der gebrauchten Sprache erst zu erlernen ist.[37]
Bei diesem Vorgang ist das Gehirn jedoch nicht beliebig modifizierbar. Veränderungen innerhalb der Nervenzellverbände bleiben aus, wenn diese den Erwartungen des internen Kontroll- oder Bewertungssystems nicht entsprechen, beziehungsweise wenn nicht genügend Aufmerksamkeit vorhanden ist. Singer fasst diesen relevanten Sachverhalt wie folgt zusammen: „Es lassen sich keine Funktionen instruieren, für die keine präformierte Akzeptanz vorliegt.“[38] Anzumerken ist, dass Singer keinen Widerspruch in dem Faktum sieht, dass einerseits Umweltfaktoren strukturierend auf die Hirnentwicklung einwirken und andererseits von ästhetischen Universalien ausgegangen werden kann. Singer begründet die Möglichkeit der Existenzberechtigung beider Hypothesen durch ähnliche Umwelten, in denen Menschen aufwachsen und dadurch, dass „erfahrungsabhängige Modifikationen nur im Rahmen genetisch vorgegebener Hypothesen erfolgen“ kann.[39]
Zur erfahrungsabhängigen Modifikation ist anzumerken, dass zunächst zirka 30 – 40% mehr Verbindungen im Nervensystem angelegt sind, als letztlich im ausgereiften Gehirn übrig bleiben. Verbindungen, die sich im erfahrungsabhängigen Entwicklungsprozess als ungenutzt und somit als überflüssig erweisen, werden gelöscht.[40]
„Deshalb kann man sagen, dass das Hirn genetisch vorprogrammiert ist für ganz bestimmte Leistungen, aber beim Menschen, weil sich die Entwicklung der Hardware über so lange Zeit nach der Geburt erstreckt, kann die Architektur durch Erfahrung verändert und ein Teil des Programms installiert werden.“[41]
Das „Dilemma“[42] an der kulturellen Evolution ist nun jedoch darin zu sehen, dass der Mensch gewaltige Wissensmengen zusammengetragen hat, durch die er quasi in den Zugzwang geraten ist, über seine eigene Zukunft entscheiden zu müssen. Das in rasanter Geschwindigkeit durch die kulturelle Evolution erfahrene Wissen übersteigt jene Kapazitäten, welche das menschliche Gehirn im Verlauf der
biologischen Evolution ausprägen konnte, da vieles von dem, was gewusst werden müsste, um verantwortungsvoll zu handeln und zu entscheiden, demnach jenseits dessen liegt, was der Mensch verarbeiten kann.
1.2 Die Bindung des Gehirns
Innerhalb dieses Abschnitts wird erläutert, wie die Welt vom Gehirn interpretiert wird und wie Verhaltensstrategien entstehen können, wie Entscheidungen zustande kommen und vor welchen Herausforderungen die Hirnforschung steht, wenn sie die Koordination dieses zentralnervösen Prozesse zu erklären sucht.
1.2.1 Wahrnehmung – Bewusstsein – Empfindung – Ich-Identität
Das Wissen über die Welt entsteht aus zwei unterschiedlichen Erfahrungssystemen. Einerseits bezieht der Mensch seine Wahrnehmung über die Sinnesorgane, also von außen, andererseits aus der Introspektion, also der Sicht auf ihn selbst. Diese subjektive Selbstbeobachtung wird als immateriell mental empfunden, sie resultiert aus einem geistigen Prozess.[43] Dieser geistige Prozess entsteht in Verbindung mit den bereits beschriebenen Metarepräsentationen, innerhalb derer Rückkopplungsschleifen gebildet werden.[44] Hypothesen über den funktionalen Verlauf dieser Prozesse werden genauer in dem Kapitel erläutert, das sich mit Bindungsproblemen befasst.
Im Gehirn sind Areale vorzufinden, die allein bei der Entwicklung von Vorstellungen, also bei der Repräsentation von Mustern, aktiv werden. „Gehirne, die dies vermögen, können Reaktionen auf Reize zurückstellen und Handlungsentscheidungen abwägen. Sie können interne Modelle aufbauen und den erwarteten Erfolg von Aktionen an diesen messen.“[45]
Das Bewusstsein ist vorbereitenden Prozessen nachgeordnet, denn um etwas bewusst zu machen, muss zunächst einmal ein hinreichendes Maß an Konsistenz der inneren Prozesse erreicht sein. Die rationalen Erklärungen, die im Bewusstsein als Handlungsgrundlage gefunden werden, sind demnach nicht die eigentlich bewusst entstandenen Handlungsmotive.[46]
Wie der Mensch aus komplexen raum-zeitlichen Aktivierungsmustern, durch die Aktivität von Nervenzellen – also einem materiellen Gewebe – Empfindungen wahrnehmen kann, stellt noch immer eine der großen Herausforderungen an die Hirnforschung dar.[47]
Jedoch äußert sich Singer im Kontext von Metarepräsentationen und Bewusstsein zu der Fähigkeit Empfindungen wahrzunehmen. „Wir bezweifeln nicht, daß sich höhere Säugetiere und insbesondere alle Primaten ihrer Empfindungen gewahr sein können und daß dieses Gewahrsein handlungsrelevant ist.“[48] Begründet wird diese Annahme durch das Vorhandensein des episodischen Gedächtnisses, welches für die Steuerung von Aufmerksamkeit und die Speicherung von Wahrnehmungsinhalten zuständig ist. Bewusstwerdung funktioniert, durch selektive Wahrnehmung und Reflexion.
Die Qualia, also die subjektive Empfindung von Schmerz, Stimmung und dergleichen, ist nur jedoch schwierig auf Wechselwirkungen zwischen materiellen und mentalen Komponenten zurück zu führen.[49]
Eine nachgewiesene Bedeutung für die Entstehung von subjektivem Glücksempfinden und somit im weiteren Verlauf der Entstehung von intrinsischen Motivation kann den Neurotransmittern zugewiesen werden, wie bereits im Abschnitt über die Erklärung des Explorationsverhaltens in der Abhandlung über die kulturelle Evolution verdeutlicht werden konnte. Neurotransmitter werden an den synaptischen Enden der Nervenzellen gebildet. Diese Botenstoffe werden bei der Erregungsübertragung frei gesetzt. Neben Dopamin lassen sich eine Reihe Botenstoffe aufführen, wie beispielsweise Adrenalin und Serotonin. Als Neurotransmitter wirken auch Aminosäureketten, wie beispielsweise Endorphine. Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch, dass die Wirkung der meisten Drogen und Rauschmittel auf der Basis von Botenstoffen beruht. Es ist nun zwar möglich die biochemischen Wirkungsweisen von Neurotransmitterausschüttungen zu konstatieren, jedoch bietet sich der Hirnforschung bislang noch keine Operationalisierungsmethode, um die Metamorphose zwischen materieller und immaterielle Energie zu untersuchen.[50]
Das Gehirn bezieht sich für die Programmierung der Hirnfunktionen, neben genetischen Dispositionen, auf Informationen, die es während der frühen Entwicklung sammelt. Dabei werden nicht nur eigene Erfahrungen einbezogen, sondern auch Interaktionen, die von der Umwelt initiiert werden. Die Entwicklung der Hirnarchitektur ist ungefähr in der Phase der Pubertät abgeschlossen. Danach bleibt der Mensch zwar lernfähig, aber das Gehirn ist insofern starr, als weder Wachstum noch Verdichtung der manifestierten Nervenzellen eintritt. Da sich die Identität eines Individuums durch die Ausprägung der Gehirnstruktur manifestiert, wird das Ich also aus der Art der Beziehungen, die das Individuum zu seiner Umwelt hat und aus der genetischen Disposition gebildet. Demnach ist die Identität von den beiden Strukturmerkmalen abhängig, die dem menschlichen Gehirn auch zur Wissensaneignung verfügbar sind.[51]
Um die eigene Identität konstant zu halten, bedient sich der Mensch der eigenen Reflexionen, die als Schleifen von abstrakten Repräsentationen über Beziehungen definiert werden können.[52]
„[So] ... können prädikative Modelle über die Umwelt, über den Organismus selbst und über dynamische Interaktionen des Organismus mit der Umwelt gebildet werden.“[53]
Es ist also festzuhalten, dass der Mensch sein Ich wesentlich die Interaktion mit der Umwelt ausprägt und konstant hält. Damit wird deutlich, dass die Erfahrung, ein unabhängiges und subjektives Ich zu sein, auf Konstrukten beruht, die der kulturellen Evolution entstammen. Nur durch die Reflexionsfähigkeit durch die eine Annahme zu wissen, was in anderen Menschen vorgeht, entwickeln wir eine Identität. Singer legt bei seinen Ausführungen über die Ich-Identität großes Augenmerk darauf, dass Kinder in den ersten Lebensjahren noch nicht über ein episodisches Gedächtnis verfügen. Das heißt: Sie erleben Handlungsanweisungen und daraus resultierende Handlungen die ihnen Selbstverantwortung suggerieren, ohne raum-zeitliche Bezüge. Laut Singer ist dieser Umstand dafür verantwortlich, dass Menschen das soziale Konstrukt der Ich-Identität qualitativ anders bewerten als andere soziale Konstrukte, gerade weil das Ich in einer Entwicklungsphase installiert wird, an die sich das Individuum nicht erinnern kann. Die eigene Identität kann nur als selbstverständlich gegeben und nicht als Konstrukt aus der Erste-Person-Perspektive betrachtet werden. Es ist dem Menschen also nicht möglich, auf sich selbst die Dritte-Person-Perspektive anzulegen.[54]
1.2.2 Bindungsprobleme
Durch die bisherigen Ausführungen wurde verdeutlicht, was Gehirne von höher entwickelten Lebewesen leisten. Das wirft die Frage auf, wie die in verschiedenen Hirnrindenarealen, distributiv organisierten, gleichzeitig ablaufenden Verarbeitungsprozesse so koordiniert werden, dass Sinnessignale kohärent interpretiert werden können, um daraus sinnvolle Handlungsoptionen und Reaktionen abzuleiten. Es muss also eine Erklärung für die Struktur von Repräsentationen gefunden werden, da diese das Ich ausmachen. Die Frage nach der einheitlichen Interpretation der umgebenden Welt und der daraus abgeleiteten koordinierten Verhaltensstrategien, wird als Bindungsproblem bezeichnet.[55]
Bei der Lösungssuche dieser Bindungsproblematik kann auf verschiedene Hypothesen zurückgegriffen werden.
Lange Zeit ging die Wissenschaft von einem Konvergenzzentrum im Gehirn aus. Laut dieser Hypothese wäre das Gehirn hierarchisch strukturiert. Es gäbe eine Art übergeordnetes Management.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist dieses intuitiv logische Modell jedoch nicht haltbar. „Schaltdiagramme der Vernetzung der Hirnrindenareale lassen jeden Hinweis auf die Existenz eines singulären Konvergenzzentrums vermissen. Es gibt keine Kommandozentrale, in der entschieden werden könnte, in der das „Ich“ sich konstituieren könnte. Hochentwickelte Wirbeltiergehirne stellen sich vielmehr als hochvernetzte, distributiv organisierte Systeme dar, in denen eine riesige Zahl von Operationen gleichzeitig ablaufen.“[56]
Als Alternative ging die Wissenschaft nach dieser Erkenntnis zunächst von der Existenz verschiedener Nervenzellenensembles aus, die eine Matrix von Merkmalen beinhalten, welche mit dem wahrgenommenen Gegenstand abgeglichen werden. Das Problem an dieser zunächst logisch anmutenden Annahme ist jedoch, dass die reizaufnehmenden Ebenen den nachfolgenden Verarbeitungsschichten im Hirn nicht übermitteln können, welche Ensembles zusammengebunden werden müssen. Eine klare Bindung und Festlegung der verschiednen Reize wäre nicht möglich.[57]
Da das Gehirn ein dezentral organisiertes System ist, welches sich trotzdem seiner Selbst bewusst werden kann, muss also nach einer anderen Erklärung gesucht werden.
Als gegenwärtig attraktivste These stellt sich die Synchronisationshypothese dar. Laut dieser Annahme kann von zwei unterschiedlichen Verarbeitungsgruppierungen ausgegangen werden.
„Die Hypothese, deren experimentelle Prüfung wir derzeit anstreben, geht davon aus, daß die Signatur für das Verbundensein von Zellen in Ensembles in Synchronizität der Aktivität der jeweils ausgewählten Nervenzellen liegt. ... Durch Synchronisation als Auswahlmechanismus ließe sich das Superpositionsproblem elegant lösen, weil sich in ganz kurzen Zeitschritten, praktisch Entladung für Entladung, definieren läßt, welche Antwort mit welcher gruppiert worden ist.“[58]
Die These besagt also, dass es zwei Gruppen von neuronalen Verbindungen gibt: Die eine Gruppe arbeitet nach der klassischen Kodierungsstrategie, in der merkmalspezifische Neuronen herausgebildet werden. Diese Neuronen leiten den eintreffenden Reiz von einer Verarbeitungsstufe zur nächsten weiter. Die erste Gruppe, über die nur ca. 10-20% der eingehenden Wahrnehmungen rekrutiert werden, ist vornehmlich den Sinnessystemen und somit der Verarbeitung von Außenreizen dienlich.
Die zweite Gruppe besteht aus Zellenensembles. Diese sind mächtiger als Gruppe als Zellen, die der klassischen Kodierungsstrategie unterliegen. Hauptsächlich sind die Zellenensembles dafür zuständig wechselseitige Neuronenverbindungen herzustellen, die der vielschichtigen Objektwahrnehmung dienen. Diese Verbindungen braucht das Gehirn, um assoziieren zu können und Erfahrungen einzuarbeiten. Die zu diesem Ensembles gehörigen Zellen werden durch kurze synaptische Reizungen aktiviert, um sich zu erregen.[59] Das Gehirn kodiert in einer zeitlichen Dimension die eintreffenden Informationen. Neuronen, die für die Repräsentation des jeweiligen Inhaltes rekrutiert werden müssen, synchronisieren ihre Entladungen über kurze Zeitspannen und erkennen sich so als zusammengehöriges Ensemble. Die zeitliche Synchronisation wird demnach als Code für die neuronale Antwort genutzt „Das neuronale Korrelat eines Wahrnehmungsinhaltes oder einer Entscheidung oder eines vorformulierten Satzes wäre dann ein komplexes raum-zeitliches Muster synchron aktiver Nervenzellen, das sich über hinreichend lange Zeit stabilisiert, um verhaltensrelevant zu sein oder sogar bewußt zu werden.“[60]
Was der Mensch schließlich wahrnimmt, hängt also in kritischer Weise davon ab, welchen Kriterien und Lösungen die vorbewusst ablaufenden Gruppierungsprozesse anbieten. Dabei ist aus erkenntnistheoretischer Sicht besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass innere interpretative Vorgänge zumeist unbewusst verlaufen, „bedeutet das doch, daß die Inhalte unserer bewussten Wahrnehmung von aktiven Interpretationsleistungen abhängen, deren wir uns in der Regel nicht gewahr werden und auf die wir nur wenig Einfluß haben.“[61]
Laut dieser Hypothese tut der Mensch also das, was als notwendige Folge des Vorausgegangenen erachtet wird. Dabei handelt es sich um einen dynamischen Prozess, dem einige Kriterien zugrunde liegen: Die Handlung wird also bestimmt durch die genetische und die geprägte Architektur des Gehirns. Weiterhin spielen
Erfahrungen, Vorgeschichten und intern generierte Dispositionen – wie Hunger, Adrenalinspiegel - und wohl auch ein Quäntchen Zufall, den Singer als „thermisches Rauschen “[62] bezeichnet, eine Rolle.
1.2.3 Der freie Wille
Bereits im vorangegangenen Teil wurde über die menschliche Eigenschaft berichtet, durch Introspektion Wahrnehmungsprozesse zu initiieren. Diese Selbstbeschau ist ein innerer Blick auf die eigene Identität. Dieser einzigartige Fokus lässt das Individuum zu dem Schluss kommen, dass es ein frei und intentional agierendes Wesen ist. Diese Art der Selbstbetrachtung ist, wie oben erläutert, innerhalb der kulturellen Evolution verankert. Dieses tradierte Wissen um eine vermeintliche Selbstverantwortlichkeit wird an das Individuum weitergegeben und lässt sich in allen Lebensbezügen latent wieder finden, von der Erziehung durch Bezugspersonen bis Rechtssystem .[63]
Kontrastierend dazu steht die Hypothese, dass alles Verhalten und Entscheiden neuronalen Vorgängen nachrangig ist, und also Verhaltens- und Entscheidungsgrundlagen unbewusster Natur sind. Das Argument einer mentalen Triebkraft ist nach Singers Auffassung schon allein deshalb nicht haltbar, weil physikalische Gründe dagegen sprechen. Singer streitet das Vorhandensein mentaler Energie nicht ab, diese bildet jedoch aus folgenden Gründen einen Kontrast, einen Gegenpol zur materiellen Energie: Mentales besitzt in der physikalischen Betrachtungsweise keine materielle Energie, denn wenn es materielle Energie besäße, wäre es nichts Mentales mehr, sondern etwas Materielles.[64]
Aber auch umgekehrt stellt sich ein Problem. Die vorhandene mentale Kraft ist auf das Nervensystem angewiesen. Der Mensch ist in der Lage, sich kraft seiner Gedanken, ein Bild von der Welt zu machen, dazu ist er jedoch auf die Introspektion angewiesen, die sich wiederum – wie oben erläutert - aus dem Nervensystem erschließt.[65]
Laut Singer zeigen Forschungsergebnisse, dass die intuitiven menschlichen Vorstellungen weder aus neurobiologischer Sicht noch als Rechtfertigung für die Willensfreiheit haltbar sind.[66] „Innerhalb neurobiologischer Beschreibungssysteme wäre das, was wir als freie Entscheidung erfahren , nichts anderes als eine nachträgliche Begründung von Zustandsänderungen, die ohnehin erfolgt wären, deren tatsächliches Verursachungen für uns aber in der Regel nicht in ihrer Gesamtheit fassbar sind“[67] Dieser Umstand legt es nahe eine interessante Unterscheidung der Rechtsprechung genauer zu betrachten. Innerhalb der Gerichtsbarkeit werden Urteil und Strafmaß eines Vergehens danach bestimmt, ob das Individuum im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte gehandelt hat und somit zur Verantwortung gezogen werden kann. Es ist jedoch fraglich, ob die Schuldfrage nicht neu überdacht werden muss, wenn man die Konsequenzen aus den Erkenntnissen der Hirnforschung berücksichtigt. Unbewusste Motive, wie sie in der forensischen Psychiatrie zu finden sind, Affekthandlungen und Taten unter Drogeneinfluss wurden bisher milder betrachtet und entschuldigt. Aus Sicht der Neurobiologen ist eine kategorische Unterscheidung zwischen Schuldfähigkeit und Schuldunfähigkeit kaum mehr haltbar, da jeder Art von Handlung, die gleichen internen Prozessen vorgeschaltet sind. Das, was der Triebstruktur am ehesten entspricht und konsistent genug ist, setzt sich durch. Mit anderen Worten: Alles was bewusst verhandelt wird, wurde bereits im Vorfeld unbewusst neuronal verhandelt.[68]
Das Problem lässt sich noch deutlicher darstellen: Wird einem Delinquenten ein organischer Defekt im Gehirn nachgewiesen, wird dieser für weniger verantwortlich gehalten, als wären eine genetische Disposition oder mangelnde Sozialisation die Auslöser gewesen. Das Substrat, aus dem heraus die Tat begangen wurde, ist jedoch in beiden Fällen identisch. Bislang gilt ein Gehirntumor als Grund für eine verminderte Schuldfähigkeit, eine Fehlverschaltung jedoch nicht.[69]
Abschließend soll auf ein wissenschaftstheoretisches Problem hingewiesen werden, mit dem sich die Hirnforschung im bezug auf die Willensfreiheit derzeit konfrontiert sieht. Der freie Wille war bislang ein Gegenstand, der – wissenschaftlich gesehen – stets aus der Erste-Person-Perspektive betrachtet wurde. Nun stellt sich die Frage, ob den Naturwissenschaften als aus der Dritten-Person-Perspektive untersuchenden Wissenschaften überhaupt zugetraut werden kann, diesen Gegenstand zu untersuchen. Der Einwand von kulturwissenschaftlicher Seite zielt auf die Befürchtung ab, es könnten Kategorie-Fehler unterlaufen und eine Einheitswissenschaft sei nicht umzusetzen. Singer jedoch sieht dieses Problem nicht als Blockade an, wenn er sagt: “Ich denke, dass hier nichts anderes vorliegt, als in allen anderen Situationen, in denen man zwischen verschiedenen Beschreibungssystemen hin und her wechselt. Das ist uns doch geläufig, gerade innerhalb der Naturwissenschaften. Sehr oft sind Phänomene, die es zu erklären gilt, in anderen Beschreibungssystemen erfasst als die elementaren Prozesse, die den jeweiligen Prozessen zugrunde liegen.“[70] Deshalb fordert Singer die Abschaffung der Brückentheorien, die sich in der Wissenschaft entwickelt haben und die in seinen Augen einzig der Aufrechterhaltung logisch konsistenter Interpretationen dienen.[71]
[...]
[1] Singer (a) 2003 S.9ff / Schnabel 2005/Assheuer 2002 / Geyer 2004
[2] Singer 2002 S.177
[3] Singer 2002 S.178
[4] Singer 2002 S.183
[5] Singer 2002
[6] Singer 2002 S.9ff
[7] Singer (b) 2003 Track 1-2
[8] Singer (b) 2003 Track 1-2
[9] Singer (b) 2003 Track 1-2
[10] Singer (b) 2003 Track 1-2
[11] vgl. Glossar
[12] Singer (b) 2003 Track 1-2
[13] Singer 2004 S.42
[14] Singer (a) 2003 S.111
[15] vgl. Glossar
[16] Singer 2004 S.42
[17] Singer 2004 S.43
[18] Singer 2002 S.103
[19] Singer (b) 2003 Track 1-2
[20] Singer 2002 S.95
[21] Singer 2002 S.87ff
[22] Singer 2002 S.89
[23] Singer (a) 2003 S.97
[24] Singer 2002 S.126ff
[25] Singer 2002 S.234
[26] Singer 2002 S.189
[27] Singer 2002 S.181
[28] Klein 2003 S.119f
[29] Singer 2002 S.218
[30] Singer 2002 S.191
[31] Singer 2002 S.191
[32] Singer 2002 S.191
[33] Singer 2002 S.181
[34] Singer 2002 S.186
[35] Singer 2002 S.225
[36] Singer 2002 S.224ff
[37] Singer 2002 S.228
[38] Singer 2002 S.231
[39] Singer 2002 S.231
[40] Singer (a) 2003 S.92
[41] Singer (a) 2003 S.97
[42] Singer 2002 S.196
[43] Singer (b) 2003 Track 5
[44] Singer (b) 2003 Track 1-2
[45] Singer 2002 S.71
[46] Singer (b) 2003 Track 6-7
[47] Singer (b) 2003 Track 3-4
[48] Singer 2004 S.42
[49] Singer 2002 S.39
[50] Singer 2002 S.38ff
[51] vgl. dazu S.9
[52] Singer 2002 S.93ff, 214
[53] Singer 2002 S.218
[54] Singer 2002 S.73ff
[55] Singer 2002 S.205
[56] Singer 2004 S.43
[57] Singer 2002 S.95ff
[58] Singer 2002 S.102
[59] Singer 2002 S.101ff
[60] Singer 2004 S.44
[61] Singer 2002 S.152
[62] Singer (b) 2003 Track 6
[63] Singer (b) 2003 Track 6-7
[64] Singer (b) 2003 Track 6-7
[65] Singer (b) 2003 Track 6-7
[66] Singer (b) 2003 Track 6-7
[67] Singer 2002 S.75
[68] Singer (b) 2003 Track 6-7
[69] Singer (b) 2003 Track 6-7
[70] Singer (a) 2003 S.27f
[71] Singer 2002 S.174f
Details
- Titel
- Aktuelle Ergebnisse der Hirnforschung und ihre Bedeutung für erziehungswissenschaftliches Denken
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Seiten
- 92
- Katalognummer
- V224280
- ISBN (eBook)
- 9783832491536
- ISBN (Buch)
- 9783838691534
- Dateigröße
- 566 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- pädogik neurophysiologie konzept willensfreiheit
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2005, Aktuelle Ergebnisse der Hirnforschung und ihre Bedeutung für erziehungswissenschaftliches Denken, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/224280
- Angelegt am
- 7.12.2005

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.