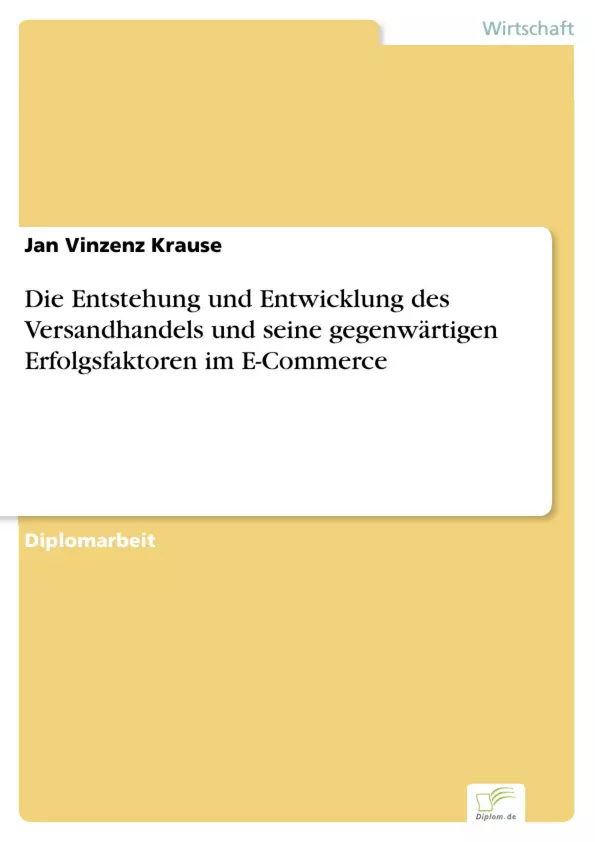Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos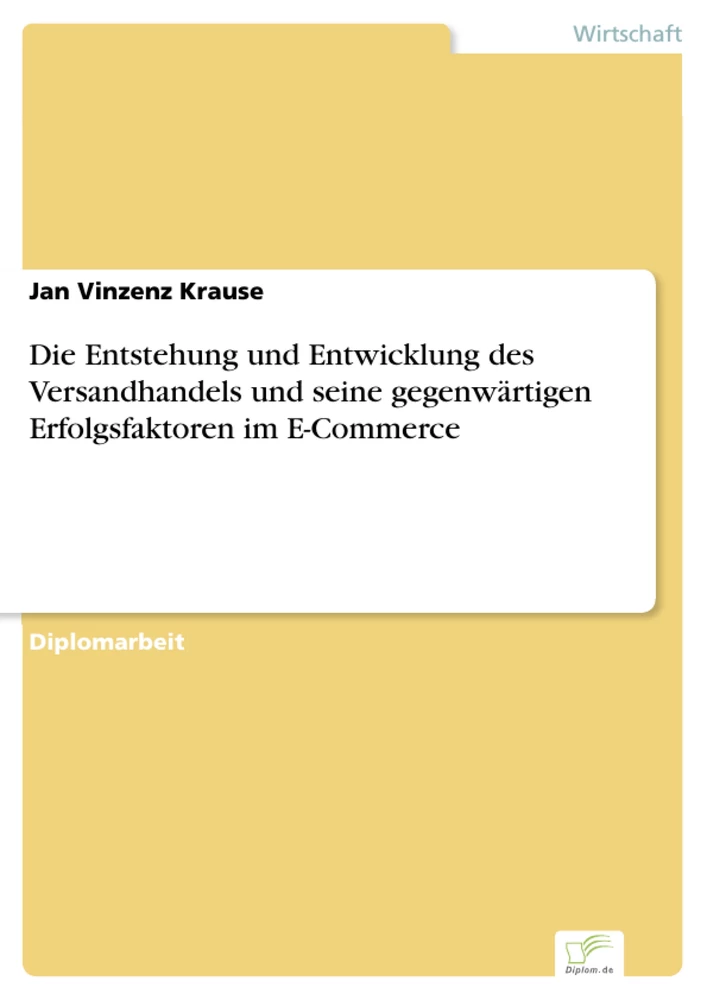
Die Entstehung und Entwicklung des Versandhandels und seine gegenwärtigen Erfolgsfaktoren im E-Commerce
Diplomarbeit, 2004, 86 Seiten
Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät)
Note
1,3
Leseprobe
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Einleitung
1 Markt und Handel
1.1 Charakterisierung des Handels
1.2 Betriebsformen des Einzelhandels
1.3 Größenordnung des Einzelhandels
2 Versandhandelsgeschäfte
2.1 Definition und Charakterisierung
2.2 Vor- und Nachteile des Vertriebswegs
2.2.1 Perspektive der Unternehmen
2.2.2 Perspektive der Konsumenten
2.3 Die Entstehung und Entwicklung des Versandhandels
2.3.1 Erste Ansätze in der Frühen Neuzeit
2.3.2 Voraussetzungen für die Entstehung der Versandgeschäfte
2.3.3 Die Entwicklung von 1871 bis 1914
2.3.4 Die Entwicklung während der Weimarer Republik
2.3.5 Die Entwicklung von 1933 bis 1945
2.3.6 Die Entwicklung von 1948 bis 1970
2.3.7 Die Entwicklung seit den 1970er Jahren bis zur Internetökonomie
2.4 Bedeutung des Versandhandels in Deutschland und Europa
2.5 Ursachen für unterschiedliche Pro-Kopf-Umsätze
2.5.1 Modellformulierung
2.5.2 Allgemeine Regressionsfunktion
2.5.3 Regressionsanalysen
2.5.4 Ergebnis
3 Aspekte der Internetökonomie für Versandgeschäfte
3.1 Definition und Charakterisierung der Internetökonomie
3.2 Electronic Business und Electronic Commerce
3.3 Auswirkungen des Internets auf den Versandhandel
3.4 Gegenwärtige Bedeutung und Entwicklungsperspektiven
4 Erfolgsfaktoren von Versandgeschäften im E-Commerce
4.1 Erfolgsverständnis und Erfolgskomponenten
4.2 Forschungsstand
4.3 Erfolgsfaktoren im Kaufprozess
4.3.1 Erfolgsfaktoren in der Kontaktphase
4.3.2 Erfolgsfaktoren in der Besuchsphase
4.3.3 Erfolgsfaktoren in der Transaktionsphase
4.3.4 Erfolgsfaktoren in der After-Sales-Phase
4.4 Ansatzpunkt für weiterführende Forschungsarbeiten
5 Zusammenfassung
6 Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1-1: Einzelhandelsumsatz 1993 bis 2003
Abbildung 2-1: Eingang von Bestellungen nach Uhrzeit im Versandhandel
Abbildung 2-2: Winterkatalog 1869 / 70 von Deux Macots
Abbildung 2-3: Anteil des Versandhandels am Einzelhandel (Deutschland)
Abbildung 2-4: Pro-Kopf-Umsatz im Versandhandel 2002
Abbildung 2-5: Entwicklung des Versandhandelsumsatz pro Kopf (1990 bis 2002)
Abbildung 2-6: Handelsdichte
Abbildung 2-7: Einwohnerdichte
Abbildung 2-8: Urbanisierungsgrad
Abbildung 2-9: PKW Dichte
Abbildung 2-10: Postgebühren für 2-kg Pakete
Abbildung 2-11: Beförderungsgeschwindigkeit
Abbildung 2-12: Öffnungszeiten von Ladengeschäften
Abbildung 2-13: Pro-Kopf-Umsätze in Europa im Versandhandel (Mittelwerte)
Abbildung 2-14: reales BIP pro Kopf in Europa (Mittelwerte)
Abbildung 2-15: Prüfung auf Multikollinearität
Abbildung 2-16: Streudiagramm Urbanisierungsgrad - Einwohnerdichte
Abbildung 2-17: Streudiagramm zur Überprüfung von Heteroskedastie
Abbildung 3-1: Bestellung im Versandhandel
Abbildung 3-2: Umsätze im B2C E-Commerce nach HDE
Abbildung 3-3: Umsätze und Wachstumsraten im Versandhandel
Abbildung 3-4: Größenordnung des elektronischen Versandhandels
Abbildung 4-1: Phasenmodell der Erfolgsfaktoren
Abbildung 4-2: Wahl der Zahlungsmethoden nach der Bestellhäufigkeit
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Betriebsformen des Einzelhandels nach der Kontaktanbahnung
Tabelle 2: Paneldatensatz für 1998 bis 2002 – Modell (1)
Tabelle 3: Querschnitt 1998 – Modell (2) und (3)
Tabelle 4: Querschnitt 1998 – Modell (4)
Tabelle 5: Paneldatensatz 1990 bis 2002 – Modell (5) und (6)
Tabelle 6: Paneldatensatz für 1998 bis 2002 – Modell (7) und (8)
Tabelle 7: Vergleich – Klassischer und elektronischer Versandhandel
Einleitung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der historischen Entwicklung des Versandhandels seit seiner Entstehung im 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Einen Schwerpunkt der Betrachtung bildet dabei der Zeitraum von 1995 bis 2004, in dem das Internet populär wurde und der Versandhandelsbranche neue Darstellung- und Kommunikationsformen bot. Angesichts der zunehmenden Bedeutung des E-Commerce setzt sich diese Arbeit mit den Erfolgsfaktoren von Versandgeschäften im E-Commerce auseinander.
Dabei geht der Autor wie folgt vor. Das erste Kapitel leitet die Arbeit mit einer Charakterisierung und Auseinandersetzung der Funktion des Handels ein. Des Weiteren werden die Betriebsformen des Einzelhandels vorgestellt und der Versandhandel dem Distanzprinzip zugeordnet.
Nach diesem eher allgemeinen Teil wird der Autor im zweiten Kapitel konkreter und geht sehr speziell auf die Betriebsform des Versandhandels ein. Dieser wird charakterisiert und seine Vor- und Nachteile werden aus Sicht der Unternehmer und Konsumenten beschrieben.
Im Anschluß daran zeigt der Autor, welche Voraussetzungen für die Entstehung dieser Betriebsform notwendig waren und wie sich die Branche bis in die Gegenwart entwickelt hat.
Da der Versandhandel in der heutigen Zeit in verschiedenen europäischen Ländern eine unterschiedliche Rolle - gemessen am Pro-Kopf-Umsatz - spielt, versucht der Autor mit Hilfe einer multiplen Regressionsanalyse die Gründe dafür zu erklären.
Im dritten Kapitel beschäftigt sich der Autor mit Aspekten der Internetökonomie für Versandgeschäfte und zeigt, welche Auswirkungen das Internet auf die Branche hat. Außerdem setzt sich der Autor sehr kritisch mit der gegenwärtigen und zukünftigen Bedeutung des Versandhandels auseinander und zeigt, dass der Anteil des Versandhandels am Einzelhandel von zurzeit knapp 6 Prozent die tatsächliche Bedeutung dieser Betriebsform im E-Commerce Zeitalter nicht widerspiegelt.
Das letzte und vierte Kapitel behandelt die Erfolgsfaktoren von Versandgeschäften im E-Commerce. Der Autor entwickelt in diesem Abschnitt ein Phasenmodell der Erfolgsfaktoren im Verlauf eines Kaufprozesses.
Da diese Arbeit am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeschichte an der Universität Tübingen bei Professor Dr. Jörg Baten geschrieben wurde, hat der Autor für die Erstellung dieser Arbeit neben jüngerer Literatur auch „ältere“ und vielleicht schon vergessene Autoren und Meinungen recherchiert. So zum Beispiel die Tübinger Dissertation von Weißburger aus dem Jahre 1935 oder den noch älteren Beitrag von Werner von 1932. Auch wenn diese Arbeiten bereits vor über 70 Jahren geschrieben und erschienen sind, sind deren Aussagen für die heutige Zeit und das E-Commerce immer noch relevant.
Neben den theoretischen Erkenntnissen konnte der Autor durch seine Tätigkeit als Versandhändler an einigen Stellen in dieser Arbeit immer wieder praktische Erfahrungen einfließen lassen. Des Weiteren hatte der Autor Zugang zu zahlreichen internen Zahlen und Statistiken, die in diese Arbeit eingeflossen sind.
1 Markt und Handel
Der Ort, an dem Angebot und Nachfrage zusammentreffen, wird als Markt bezeichnet. Der Preis übernimmt in einer Marktwirtschaft die zentrale Steuerungsfunktion und stimmt die Einzelpläne der Haushalte und der Unternehmungen aufeinander ab.
Geprägt wird das Marktgeschehen durch sieben Gruppen von Akteuren, zu denen der Staat, Bedarfsträger, Anbieter, Absatzmittler, Absatzhelfer, Lieferanten und die Infrastruktur zählen.[1]
Der Autor befasst sich in dieser Arbeit mit dem Akteur „Absatzmittler“ und im spezielleren mit der Betriebsform des Versandhandels.
Der nächste Abschnitt beschäftigt sich zunächst mit dem Handel an sich. Im Anschluß geht der Autor auf den Versandhandel ein.
1.1 Charakterisierung des Handels
In Handelsbetrieben finden im Gegensatz zu Industriebetrieben keine transformatorischen Prozesse statt, wenn man von Arbeitsschritten, wie der Sortierung, Mischung oder Verpackung einmal absieht. Der Handelsbetrieb offeriert dem Konsumenten vielfältige Dienstleistungen, die nach Barth/Hartmann/Schröder aus einer Kombination verschiedener sachlicher und personeller Produktionsfaktoren erstellt werden. Die Wertschöpfung der Handelsbetriebe besteht darin, dass die noch nicht verwendungsreifen Sachleistungen der Industrie durch Umhüllung mit handelsspezifischen Dienstleistungen einer werterhöhenden Verwendungseignung zuzuführen.[2] Diese allgemeinen Aussagen konkretisiert Müller-Hagedorn, indem er die Funktion des Handels im Austausch von Gütern und Dienstleistungen verbunden mit der Darbietung von Service, Beratung und Marktschließung sieht.[3]
Lerchenmüller sieht neben der räumlichen und zeitlichen Überbrückung eine weitere wichtige Handelsaufgabe in der Zerlegung produktionsgerechter Großmengen in abnehmergerechte Kleinmengen, sowie der Preisbildung und Markterschließung. Des Weiteren weist der Autor auf die Kommunikations- und Sozialfunktion des Einzelhandels hin, wobei diese wohl eher für stationäre Handelseinrichtungen gilt, nicht aber für den unpersönlichen Versandhandel.[4]
Im folgenden Abschnitt beschäftigt sich der Autor mit den verschiedenen Betriebsformen des Einzelhandels und schlägt so den Bogen zum Versandhandel. Auf den Großhandel wird nicht eingegangen.
1.2 Betriebsformen des Einzelhandels
Bei der Distribution von Konsumwaren an den Endverbraucher kommt es zur Einschaltung von Einzelhandelsbetrieben, da die Versorgung des privaten Verbrauchers aufgrund des hohen Grades der Dezentralisation des Absatzes nur schwer von den Herstellern durchgeführt werden kann.[5] Die Aufgabe des Austausches von Gütern und Dienstleistungen zwischen den Wirtschaftsmitgliedern kann durch eine Vielzahl von verschiedenen Einzelhandelsformen, wie zum Beispiel dem Kaufhaus, Supermarkt oder Versandhandel gestaltet werden.[6]
Will man die verschiedenen Betriebsformen des Einzelhandels systematisieren, gestaltet sich diese Aufgabe als durchaus schwierig. Die einschlägigen Handelslehrbücher von Müller-Hagedorn, Barth und Lerchenmüller weisen unterschiedliche Systematiken auf, die abhängig vom Zweck nach verschiedenen Merkmalen gegliedert werden.[7]
Die unterschiedlichen Systematiken machen es daher unmöglich einen, allgemeingültigen Ansatz zu entwickeln. Letztendlich kommt es auf den Verwendungszweck an. Da sich diese Arbeit mit dem Versandhandel beschäftigt, hält der Autor eine Systematisierung nach dem Merkmal der Kontaktanbahnung für besonders geeignet.[8] Die Systematisierung nach der Kontaktanbahnung wird vor allem für die später noch zu untersuchende Beziehung zwischen dem Versandhandel und dem E-Commerce eine wichtige Rolle spielen. Bei der Kontaktanbahnung lassen sich folgende Prinzipien unterscheiden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Betriebsformen des Einzelhandels nach der Kontaktanbahnung[9]
Der Versandhandel ist eine Betriebsform des Einzelhandels, die in das Distanzprinzip einzuordnen ist. Eine Charakterisierung und Beschreibung des Versandhandels folgt im 2. Kapitel.
1.3 Größenordnung des Einzelhandels
Im Jahr 2002 betrug der Umsatz im Einzelhandel 371 Milliarden Euro. Dieser Betrag entspricht 40,9 % der privaten Konsumausgaben in Deutschland. Die Zahl der Beschäftigten im Einzelhandel hat in den letzten Jahrzehnten abgenommen und beläuft sich für 2002 auf 2.801.000.[10]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1-1: Einzelhandelsumsatz 1993 bis 2003[11]
2 Versandhandelsgeschäfte
Nach einer Einordnung des Versandhandels in die Betriebsformen des Einzelhandels, beschäftigt sich das folgende Kapitel intensiv mit dieser Betriebsform.
2.1 Definition und Charakterisierung
In der Literatur finden sich zahlreiche und voneinander abweichende Definitionen zum Begriff „Versandhandel“.[12] Einige Autoren haben immer wieder versucht, sämtliche Erscheinungsformen des Versandhandels in die Begriffsbestimmung mit aufzunehmen. Dies führte zu einer Vielzahl von unübersichtlichen Definitionen.[13]
Einigkeit besteht lediglich darüber, dass der Versandhandel eine Form des Distanzhandels ist. Dieser ist durch eine räumliche Trennung von Anbietern und Nachfragern gekennzeichnet und durch Unternehmen, die den Informations-, Waren- und Geldverkehr für den Versandhändler übernehmen (z.B.: Post, Kurierdienste und Banken). Der Nachfrager ist somit nicht wie beim Residenz-, und Treffprinzip an einen bestimmten Ort gebunden, um das Angebot zu sichten und Waren auszuwählen.
Diese Definitionen sind aber noch sehr allgemein gehalten und es erscheint daher sinnvoll, den Versandhandel anhand seiner wesensbestimmenden Charakteristika zu beschreiben.
Meya kennzeichnet den Versandhandel als Institution, der Güter an private Haushalte absetzt, und somit konsumreife Waren verkauft.[14] Diese Definition trägt zur Charakterisierung des Versandhandels wenig bei, da sie sich allgemein auf den Einzelhandel bezieht und ebenso für Kaufhäuser und Supermärkte gilt.
Nach Werner und Nieschlag unterscheiden sich die Versandgeschäfte von Ladengeschäften darin, dass der Versandhandel über keine offenen Verkaufsstellen verfügt, sondern seine Angebote entweder schriftlich oder mündlich unterbreitet und die bestellten Waren den Käufern durch die Post direkt ins Haus liefert.[15]
Die bisher zitierten Autoren beschreiben einzelne Aspekte des Versandhandels, die erst im Zusammenspiel dem komplexen Begriff des Versandhandels zwar nahe kommen, jedoch sind die Definitionen nicht ausreichend.
Eine umfassende Charakterisierung des Versandhandels versucht der Bundesverband des Deutschen Versandhandels.[16] Dieser nennt drei grundsätzliche Charakteristika. Versandhandel bedeutet, dass
- Waren oder Dienstleistungen mittels eines medialen Angebots der privaten oder gewerblichen Nachfrage offeriert werden. Dieses Angebot kann durch Katalog, Anzeige, Prospekte, Internet, TV, Vertreter oder andere Formen der Direktwerbung an den Kunden herangetragen werden.
- der Kauf auf Distanz erfolgt. Der Versandhandel überwindet die räumliche Trennung zwischen Anbieter und Besteller durch schriftliche, telefonische oder elektronischen Auftrag.
- die bestellte Ware per Post, über versandhauseigene Zustellunternehmen, private Paketdienste oder auf anderen Wegen versandt wird.
Das Angebot findet also nicht am Ort der Nachfrage statt. Waren oder Dienstleistungen werden nicht, wie im Ladengeschäft sofort ausgehändigt, sondern mit einer zeitlichen Verzögerung zugestellt. Aus diesem Grund ist der Versandhandel auf das Vorhandensein moderner Transport- und Kommunikationssysteme angewiesen, die eine räumliche Trennung zwischen Versandunternehmen und Kunden ermöglichen.
Will man die vorherigen Überlegungen in einer kurzen und knappen Definition bündeln, so schlägt Stratmann folgende Formulierung vor:[17]
„Versandhandel wird von Unternehmen betrieben, die nicht nur gelegentlich, sondern gezielt und fortwährend der Zielgruppe Güter und Dienstleistungen auf schriftlichem und oder mündlichen beziehungsweise elektronischem Wege direkt oder indirekt anbieten, die Bestellungen schriftlich oder mündlich beziehungsweise elektronisch, direkt oder indirekt entgegennehmen und die bestellten Waren durch Transportunternehmen beziehungsweise eigene Transportmittel oder über Vermittler an den Käufer ausliefern.“
Aus den Charakteristika ergeben sich für den Versandhandel Vor- und Nachteile, auf die der Autor im nächsten Kapitel eingeht.
2.2 Vor- und Nachteile des Vertriebswegs
Will man die Eigenart des Versandhandels jedoch als Ganzes verstehen, so ist es notwendig, sich mit den Vor- und Nachteilen dieser Betriebsform aus der Sicht des Verbrauchers und der Versandunternehmen zu beschäftigen.
Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen ein besseres Verständnis der Erfolgsfaktoren im Versandhandel, da die Auseinandersetzung mit den Eigenarten und die sich daraus ergebenden Vor- und Nachteile dem Unternehmer wichtige Impulse für die Gestaltung der Kundenbeziehung liefern können. Nach Überzeugung des Autors können klassische Nachteile des Versandhandels, wie zum Beispiel die fehlende Möglichkeit, das Produkt vor Kauf zu begutachten, durch gezielte Maßnahmen gemindert werden, was dazu beiträgt, dass der Einkauf im Versandhandel, der ja auch immer in Konkurrenz mit andere Betriebsformen steht, für den Konsumenten vorteilhafter und attraktiver wird.
Zunächst betrachtet der Autor die Vor- und Nachteile des Versandhandels aus der Perspektive der Unternehmen, danach aus der Perspektive der Konsumenten.
2.2.1 Perspektive der Unternehmen
Die Versandgeschäfte sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht im Vergleich zu Ladengeschäften eine günstige Distributionsform des Einzelhandels. Zu diesem Schluss kommen verschiedene Autoren.
Werner zählt verschiedene Kostenverursacher auf, die dem Versandhändler nicht entstehen. Dazu zählt er vor allem die Ladenmieten in Stadtzentren, so wie die Personalkosten für das Verkaufspersonal. Daneben entstehen den Versandgeschäften keine Kosten für die Ladenausstattung, wie zum Beispiel für Anschaffung von Kassen und Präsentationsmittel. Auch bedarf es keiner Schaufensterdekoration.
Auf der anderen Seite sieht sich der Versandhandel vor allem mit sehr hohen Werbekosten besonders für die Gewinnung neuer Kunden im Internet konfrontiert. Diese Kosten werden in der Regel weit unterschätzt und sind nur dann tragbar, wenn der ersten Bestellung weitere Aufträge erfolgen. Die Gewinnung neuer Kunden und der Aufbau von Stammkunden sind entscheidend für das Überleben des Versandgeschäfts. Gelingt es dem Unternehmer nicht, seinen Namen und das Angebot in größerem Umfang zügig bekannt zu machen, ist sein Betrieb zum Scheitern verurteilt.[18]
Gerade hinsichtlich der Werbung bedarf es besonderer Anstrengungen bezüglich der Neuartigkeit und des Ideenreichtums, da durch das Fehlen der persönlichen Beziehung mit dem Kunden der Versandhändler keinen Einfluß auf diesen nehmen kann, um zum Beispiel die Verwendungsmöglichkeit zu demonstrieren.[19] Um diesen Nachteil zu reduzieren, haben große Versandhandelshäuser, wie zum Beispiel Quelle, veranlasst, stationäre Verkaufsstellen einzurichten, in denen das Sortiment besichtigt und bestellt werden kann. Auf weitere Gestaltungsmöglichkeiten, die die Nachteile des Versandhandels kompensieren können, wird später ausführlich im Kapitel 4 eingegangen. Dazu zählen zum Beispiel Maßnahmen, die Kaufhemmungen und Vorurteile von Kunden abbauen sollen.
Ein Vorteil aus der Eigenschaft des Versandgeschäftes ergibt sich aus der Tatsache, dass der Händler durch die Geschäftsbeziehung personenbezogene Daten des Kunden erhält, die es ihm erlauben, ein zielgruppenspezifisches Marketing zu betreiben. So können Streuverluste reduziert werden.[20]
Die Lagerhaltung kann der Versandhändler je nach Geschäftsbeziehung und Vertragsgestaltung in erheblichem Umfang auf den Produzenten oder den Großhändler abwälzen, indem er bei diesem bestellt, sobald er eine Bestellung erhalten hat. Somit benötigt diese Betriebsform eine geringere Kapitalausstattung und reduziert damit das Risiko des Unternehmers bei einem eventuellen Konkurs.[21]
Ebenso reduziert sich das Risiko für den Jungunternehmer, wenn dieser den Aufbau seines Versandgeschäftes zunächst aus der eigenen Wohnung her betreibt. Als Lager- und Büroraum eignet sich fast jede Räumlichkeit.
Nieschlag beschäftigt sich ausführlich mit dem Verkaufspersonal von Versandgeschäften und geht insbesondere auf dessen Auslastung ein. Jede Betriebsform des Einzelhandels unterliegt zeitlichen Umsatzschwankungen, die sich aus den Kaufgewohnheiten und den Kaufmöglichkeiten ergeben und eine entsprechende Disposition von Personal notwendig machen. Diese Schwankungen spielen für den Versandhandel jedoch eine geringere Rolle als bei den stationären Geschäften, da die eingehenden Aufträge auf den gesamten Arbeitstag gleichmäßig verteilt werden können, ohne dass dem Kunden dadurch Nachteile entstehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2-1: Eingang von Bestellungen nach Uhrzeit im Versandhandel[22]
Ohnehin wird der Betriebsapparat durch die Auswahltätigkeit und die Überlegungen der Kunden, vor allem auch durch erfolglose Verkaufsverhandlungen nicht in Anspruch genommen.[23] Natürlich haben auch die Versandgeschäfte auf zahlreiche Kundenanfragen zu reagieren, aber eine Reaktion und Antwort muss nicht unbedingt unmittelbar bei Eingang geschehen, sondern die Arbeit kann auf den Tag verteilt werden, wenn die Anfrage per E-Mail, Fax oder Brief eingeht.
Neben den besseren Möglichkeiten der Auslastung kommt hinzu, dass die Anforderungen an das Personal viel geringer sein können. Versandgeschäfte müssen keine Verkaufsgespräche mit dem Kunden führen. Daher benötigen die Mitarbeiter keine besonderen Schulungen oder ein ansprechendes Aussehen, so dass ungelernte und kostengünstigere Hilfskräfte für die Zusammenstellung der Sendungen eingestellt werden können.[24]
Einen weiteren Vorteil besitzt das Versandgeschäft hinsichtlich der Größe des Kundenpotentials. Während die Kunden der Ladengeschäfte überwiegend aus der näheren Umgebung stammen, kann der Versandhändler Kunden weltweit beliefern.
Jedoch muss man diese Aussage einschränken. Auch die Versandgeschäfte unterliegen Restriktionen, die sich darin begründen, dass es beim grenzüberschreitenden Warenverkehr zu Schwierigkeiten mit der Sprache und den unterschiedlichen Rechtssystemen kommen kann. Gerade bei Sendungen, die verloren gehen oder beschädigt werden, stellt sich die Frage der Haftung. Nachlieferung und Retouren erzeugen hohe Transaktionskosten für Versand- und Bankgebühren. Diese Risiken werden jedoch für Versandhändler in der Europäischen Union durch die weitere Integration des Binnenmarkts, die sich zum Beispiel durch eine gemeinsame Währung und ein einheitliches Rechtssystem ausdrückt, mehr und mehr reduziert. Das Sprachproblem bleibt jedoch langfristig bestehen und der Autor sieht darin den Hauptgrund, weshalb sich das Absatzgebiet des Versandhandels - insbesondere von kleinen Händlern - auf den heimischen Markt konzentriert.
2.2.2 Perspektive der Konsumenten
Obwohl der Konsument vor dem Einkauf im Versandhandel die Ware weder anfassen noch ausprobieren kann, bestellen in Deutschland jedes Jahr über 23 Millionen Bürger – also knapp 30 Prozent der Gesamtbevölkerung - im Versandhandel.[25] Welche Gründe gibt es dafür?
Der Bundesverband des Versandhandels (bvh) hat in einer Umfrage die wesentlichen Vorzüge seiner Branche ermittelt und in fünf Punkten zusammengefasst.[26]
Dabei stellt die Convenience, zu Deutsch die Bequemlichkeit, das wichtigste Argument für den Versandhandel dar, denn diese ermöglicht einen bequemen und ungestörten Einkauf von zu Hause aus. Während dem Kunden beim Einkauf im stationären Handel Kosten für das Aufsuchen des Anbieters entstehen, wie zum Beispiel Kosten für den Parkplatz oder für öffentliche Verkehrsmittel, so entstehen diese Kosten im Versandhandel nicht, da der Händler die Ware direkt an den Kunden liefert. Dieser Vorteil kommt nach Nieschlag vor allem Personen zugute, die entlegen wohnen und daher behauptet er, dass die Landbevölkerung eine wichtige Kundengruppe des Versandhandels darstellt.[27] Ob dieses Argument heute noch gültig ist, wird später quantitativ überprüft. Unter den Punkt der Bequemlichkeit verbucht der Bundesverband des Versandhandels auch besondere Serviceleistungen, wie beispielsweise Telefon-Hotlines, Raten- und Teilzahlung, Terminlieferung, Installation vor Ort und Rücknahme von Altgeräten.
Neben der Bequemlichkeit liegt ein zweiter Vorteil nach Meinung des Verbands in der Zeitersparnis. Unter diesen Punkt fasst dieser die Möglichkeit, dass man im Versandhandel rund um die Uhr und nach einem selbst gewählten Zeitpunkt einkaufen kann, wobei Barth/Hartmann/Schröder darauf hinweisen, dass die Bestellungen nicht umgehend bearbeitet und ausgeliefert werden.[28] Der Kunde ist trotzdem unabhängig von den Geschäftszeiten und kann seine Auswahl und Entscheidungen auf Feierabende und Feiertage legen.
Der bvh nennt neben diesen beiden sehr wichtigen Vorzügen drei weitere, die hier nur kurz genannt werden sollen, da sie der Autor als weniger relevant erachtet und der Ansicht ist, dass diese Vorteile auch für andere Betriebsformen des Einzelhandels gelten und damit den Versandhandel vom stationären Handel nicht abgrenzen.
So sieht der bvh eine Stärke des Versandhandels in dessen Kompetenz und meint damit die große Sortimentsbreite sowie die spezialisierten Angebote für einen speziellen Adressatenkreis. Doch diese Vorteile findet der Verbraucher auch beim Fachgeschäft.
Auch den Punkt „Kauf ohne Risiko“, worunter der bvh das Rückgaberecht versteht, gewährleisten nicht nur Versandgeschäfte. Ob sich aus der Stabilität der Preise über einen längeren Zeitraum vor allem beim Katalogversandhandel ein Vorteil für den Kunden ergibt, soll hier nicht diskutiert werden. Nur die Preistransparenz - vor allem im Internet - bietet aus Sicht des Autors einen wichtigen Vorteil für den Kunden, da dieser sehr leicht über Preisportale und Suchmaschinen den günstigsten Anbieter finden kann.[29]
Einen wesentlichen Vorteil des Versandhandels, den der Autor in der Anonymität sieht, vergisst der bvh ganz. Der unpersönliche Verkauf erweist sich als großer Vorteil für das Versandgeschäft, da gerade bestimmte Artikel, wie Kondome, Erotikartikel, Filme oder bestimmte Buchtitel nur ungern persönlich eingekauft werden.
Weißburger weist auf einen interessanten Punkt hin, den wir in den Ausführungen des bvh nicht finden. Nach seiner Ansicht brauchen die Kunden ihre Kaufentscheidung nicht voreilig zu treffen, sondern können sich ihre Entscheidung reichlich überlegen.[30] Daher vermutet der Autor, dass es wenige Impulskäufe gibt. Ebenso besteht im Versandhandel nicht die Gefahr, dass geschulte Verkäufer durch ihre suggestiven Fragen oder ihr Zureden den Kunden zum Kauf drängen.
Die bisherigen Ausführungen haben bisher nur die Vorteile der Versandgeschäfte dargelegt und so mag der Eindruck entstehen, dass diese Betriebsform nur Vorzüge besitzt. Der Versandhandel sieht sich jedoch mit einer Reihe von Nachteilen konfrontiert, die im Folgenden beschrieben werden.
Ein wesentlicher Nachteil des Versandhandels besteht darin, dass der Konsument die Ware vor dem Kauf weder anfassen, prüfen noch ausprobieren kann.
Ein weiterer Grund sind die Versandkosten, was in zahlreichen Fällen dazu führen dürfte, dass Probebestellungen unterbleiben, obwohl diese für den Händler eine gute Möglichkeit wären, sich und seinen Service dem Kunden vorzustellen, um so Hemmungen des Kunden abzubauen. Obwohl dem Kunden, wie oben erwähnt, auch Kosten für den Besuch eines Ladengeschäftes entstehen (Parkgebühren, Zeit und Fahrtkosten für Auto oder Bus), kann davon ausgegangen werden, dass die Verbraucher diese „versteckten Kosten“ im Gegensatz zu den Portokosten, die im Versandhandel entstehen, in seine Kalkulation selten mit aufnimmt und daher das Ladengeschäft vorzieht. Dazu kommen natürlich auch noch andere Gründe, wie das fehlende Einkaufserlebnis im Versandhandel. Während das Ladengeschäft einen emotionalen und kommunikativen Mehrwert bietet, lässt sich der Versandhandel durch Funktionalität, Bequemlichkeit und Anonymität charakterisieren.
Außerdem wirkt sich nachteilig aus, dass die Ware, die im Versandgeschäft gekauft wird, erst nach einigen Tagen zur Verfügung steht, während sie im Ladengeschäft im Allgemeinen sofort mitgenommen werden kann.[31] Auf die Geschwindigkeit der Auslieferung hat der Versandhändler zwar einen Einfluß, indem er seine eigene Logistik optimiert, jedoch wird die Transportzeit vor allem durch das Logistikunternehmen bestimmt.
Ein weiterer nicht zu unterschätzender Zeitaufwand ergibt sich für den Kunden, wenn die Ware nicht den Vorstellungen entspricht und daher umgetauscht werden muss. Für den Kunden bedeutet das eine längere Wartezeit und die Notwendigkeit, die Sendung wieder zu verpacken und in einer Postfiliale abzuliefern.
2.3 Die Entstehung und Entwicklung des Versandhandels
Wer an den Versandhandel denkt, dem fallen meistens zuerst Unternehmen wie Otto oder Quelle ein, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges - begünstigt durch das zerstörte Warenverteilungssystem und dem Bedarf an Konsumgütern - entstanden sind.
Jedoch reichen die Wurzeln des Versandhandels weiter zurück als bis in die 1950er Jahre. Die Entstehung des Versandhandels der Neuzeit datieren deutsche Autoren in die 1870er Jahre.[32]
Weißburger begnügt sich mit der Feststellung, dass er kein Versandgeschäft gefunden hat, das als Versandgeschäft weiter zurückreicht als bis in die 1870er Jahre. Er merkt zwar richtig an, dass die Angabe eines Gründungsjahres für die ersten Versandhaus-Unternehmungen ohnehin schwer möglich ist, weil sie sich aus bestehenden, andersgearteten Betrieben allmählich entwickelt haben.[33] Jedoch ist die Ansicht, dass sich Versandhandelsgeschäfte erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausgebildet haben, nach Meinung des Autors nicht vollständig. Im Folgenden zeigt der Autor, welche Entwicklungsprozesse seit dem 15. Jahrhundert verliefen, die der Entstehung und Entwicklung des modernen Versandhandels wichtige Impulse gaben.
2.3.1 Erste Ansätze in der Frühen Neuzeit
Nach der Erfindung des Buchdruckes durch Johannes Gutenberg im Jahr 1455[34], setzte bereits kurz danach eine rege Publikationstätigkeit ein. Neben den Druckwerken produzierten die Buchdrucker erstmals auch schriftliche Aufstellungen ihrer lieferbaren Titel, um damit potentielle Kunden in entfernten Regionen über ihr Sortiment zu informieren. Diese Druckerzeugnisse kann man als die Vorläufer heutiger Hochglanzkataloge von Versandhäusern ansehen. 1498 veröffentlichte Aldus Manutius aus Venedig einen textorientierten Produktkatalog mit 15 Seiten und dieser gilt bei vielen Historikern als ältester Versandhändler der Welt.
Die Warenzustellung im ausgehenden 15. Jahrhundert fand aber noch nicht wie heute durch moderne Logistikunternehmen, wie die Post oder Kurierdienste statt, sondern wurde von Mitarbeitern der Druckerei oder externen Mitarbeitern ausgeführt, die von Stadt zu Stadt zogen und ihre Ware mit sich führten. Auf öffentlichen Plätzen hingen sie ihre Produktlisten aus und warteten in Wirtschaften auf ihre Kunden. Erst im 16. Jahrhundert nutzten neben den Buchdruckern auch andere Branchen die Technologie des Buchdrucks, um ihre Waren weiter entfernten Käufern anbieten zu können.
In Deutschland lassen sich erste Anzeichen für die Entstehung des Versandhandels in dieser Zeit ausmachen, als Nürnberger Kaufleute ihre Waren mit Hilfe von gedruckten Listen an Kunden in Norddeutschland offerierten. So verbreitete sich der Distanzverkauf schrittweise in ganz Europa und 1667 publizierte in Großbritannien William Lucas den ersten gedruckten Katalog mit Abbildungen. Für das 18. Jahrhundert konnte der Autor keine Beispiele finden.
Der Entwicklungsstand derartiger Versandhandelsgeschäfte seit dem 15. Jahrhundert weist jedoch einen wesentlichen Unterschied zu den modernen Versandunternehmen des 19. und 20. Jahrhunderts auf. Das Postwesen ist neben dem Katalog die zweite wesentliche Bedingung für einen funktionierenden Versandhandel und war damals regional organisiert und ineffizient. Als Transportmittel dienten bis zur Erfindung der Eisenbahn Pferde und Kutschen. Zudem behinderten Zollbarrieren und andere Handelshemmnisse, wie beispielsweise die Straßenmaut, den Versandhandel.
Gewiss kann man darüber streiten, ob die beschriebenen Unternehmen des 15. Jahrhunderts schon als Versandunternehmen bezeichnet werden dürfen. Dem Autor ist wichtig, dass die Entstehung und Entwicklung des Versandhandels schon früher einsetzte, als im 19. Jahrhundert und dass dieser Prozess nicht plötzlich, sondern in langen Zeiträumen stattfand. Die Erfindung des Buchdrucks ermöglichte die Entstehung von Versandgeschäften im 15. Jahrhundert erst. Das Postwesen stellt die zweite wichtige Bedingung für die Entstehung des Versandhandels da. Diese und weitere Gründe, die der Autor im nächsten Kapitel beschreibt, trugen dazu bei, dass der Versandhandel erst in den 1870er Jahren einen entscheidenden Entwicklungsschub erfuhr.
2.3.2 Voraussetzungen für die Entstehung der Versandgeschäfte
Für die Entstehung der Versandgeschäfte genügte es aber nicht, dass die eine oder die andere der zwei beschriebenen Voraussetzungen vorhanden war. Ein funktionierendes Postwesen und ein Katalogwesen schaffen noch nicht die Grundlage für die Entwicklung heutiger Versandgeschäfte.
Die Existenz des Versandgeschäftes ist in viel stärkerem Maße als die der stationären Ladengeschäfte an bestimmte Vorbedingungen geknüpft. Diese Vorbedingungen ergeben sich unmittelbar aus der Eigenart des Versandgeschäftes, die in Kapitel 2.1 beschrieben wurden.
Damit der Versandhandel in seiner damaligen Form überhaupt entstehen konnte, sind folgende Voraussetzungen notwendig:
- Kommunikationssystem: Katalog, Zeitung, und Telegraphenwesen
- Transportwesen: Post und Eisenbahn
- Transaktionswesen: Zahlungsverkehr
- Realeinkommen, Zeit und Alphabetisierung
- Politische Faktoren
Das Vorhandensein dieser Faktoren findet sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und soll nun im Einzelnen erläutert werden.
Werner nennt vier Faktoren, die er für die Entstehung des Versandhandels als wichtig erachtet. Danach muss für den Kunden die Möglichkeit bestehen, auf einfachem und billigem Wege seine Bestellungen vorzunehmen. Außerdem müssen Warenproben und Drucksachen, die Hauptmittel der Kundenwerbung, billig und schnell verschickt werden können. Darüber hinaus erleichtern verschiedene Zahlungsarten, wie Postscheck oder Nachnahme den Geschäftsverkehr.[35]
Das Versandgeschäft wird in hohem Maße von den Versandkosten determiniert, denn von ihnen hängt es im Wesentlichen ab, ob das Versandgeschäft mit den anderen Handelsformen konkurrieren kann. Der Versandhandel steht und fällt mit den günstigen Tarifen für Pakete, Mustersendungen und Drucksachen. Nach seiner Meinung haben nicht so sehr die modernen Verkehrsmittel, wie die Eisenbahn, zur Entwicklung der Versandgeschäfte beigetragen, sondern vielmehr die Tarifpolitik der Post.
Diese Bedingungen erklären die verhältnismäßig späte Entstehung des Versandgeschäftes in den 1870er Jahren. Erst die moderne Verkehrsentwicklung vermochte nach seiner Ansicht diesen Geschäftstypus zu schaffen.[36]
Seyffert setzt sich intensiv mit dem Postwesen auseinander und nennt das am 1. Januar 1874 eingeführte Einheitsporto von 50 Pfennig für 5 kg Pakete als den offenbar entscheidenden Grund für das Aufstreben der deutschen Versandgeschäfte. Außerdem weist Seyffert darauf hin, dass die Versandgeschäfte besonders von den Leistungen der Post abhängig sind. Als Beispiel nennt er die in den 1880er Jahren entstandenen Butterversandgeschäfte in Schleswig Holstein, für die spezielle Kühlwagen nötig waren, um die Ware zum Konsumenten zu transportieren.[37]
Nieschlag sieht in den 1870er Jahren deutliche Verbesserungen im Postverkehr und beschreibt dieselben Neuerungen auf diesem Gebiet. Ebenso große Bedeutung wie das Einheitsporto für 5 kg Pakete rechnet der Autor der Einführung des 5 Pfennig Tarifs für Postkarten, der Einführung des Postanweisungsverkehrs (1865), dem Nachnahmeverkehr (1878), der Einführung von Postschecks (1909) sowie die Zulassung von Zeitungs- und Zeitschriftenbeilagen gegen eine niedrige Gebühr zu.[38]
Spiekermann betrachtet die Geschichte der Versandgeschäfte als Verkehrsgeschichte. Ohne die tief greifenden Veränderungen des Postverkehrs in den 1860er und 1870er Jahren ist das Versandgeschäft als Vertriebsform des Einzelhandels kaum denkbar.[39]
Neben den günstigen Posttarifen ermöglichte die Ausdehnung und die Entwicklung der Tagespresse und das Inseratenwesen eine billige und an die Masse gerichtete Werbung. Hinzu kam noch der ständige Fortschritt der Vervielfältigung- und Reproduktionstechnik, der erst eine umfangreiche Werbung möglich machte. Eine große Rolle spielten dabei vor allem die neuen Möglichkeiten bildlicher Wiedergabe (z.B. Fotografie).[40]
Weißburger weist darauf hin, dass die Entfaltung des Zeitungswesens auch den Bildungsstand breiter Volksschichten gehoben hat und dazu beitrug, dass die Werbung des Versandgeschäftes auf einen empfänglichen Boden fallen konnte und so die Bevölkerung erst als Versandkäufer in Frage kommen ließ.[41] Ähnlich argumentiert Nieschlag, der das Lesen und Schreiben als eine Vorbedingung für den Versandhandel charakterisiert.[42]
Ein weiterer Gesichtspunkt, der einen Einfluß auf die Entstehung des Versandhandels ausübte, kann in der Entfaltung eines modernen Verkehrswesens, wie Eisenbahn und Dampfschifffahrt gesehen werden. Land- und Wasserstraßen verbesserten die Kommunikations- und Transportbedingungen und förderten die Marktverbindungen. So konnten Produkte überregional verteilt werden.[43]
Wie die Eisenbahn veränderten auch die Dampfschiffe das Verkehrswesen. Allerdings spielte die Schifffahrt für den Versandhandel eher eine untergeordnete Rolle, da die Eisenbahn vor allem nationale, das Dampfschiff globale Märkte bediente. Erst durch die Kolonialisierung Mitte der 1880er Jahre gewann das Dampfschiff an Bedeutung für den Versandhandel. Es ermöglichte die Versorgung deutscher Staatsbürger in den afrikanischen Kolonien mit heimischen Waren.[44]
Telegraphenlinien (ab den 1840er Jahren) und Fernsprecher (um 1880) sorgten für eine Erhöhung der Handelsgeschwindigkeit und Verbesserung der Kommunikation. Beide Erfindungen erlaubten dem Hersteller und Händler, das System von Bestellung und Lieferung besser aufeinander abzustimmen.[45]
[...]
[1] Vgl. Nieschlag (1972), S. 33.
[2] Vgl. Barth/Hartmann/Schröder (2002), S. 2.
[3] Vgl. Müller-Hagedorn (1998), S. 107 f.
[4] Vgl. Lerchenmüller (1992), S. 45.
[5] Vgl. Barth/Hartmann/Schröder (2002), S. 2.
[6] Einen Überblick über die verschiedenen Einzelhandelsformen gibt Tietz (1992), S. 30-32.
[7] Vgl. Barth/ Hartmann/Schröder (2002), S. 93; Müller Hagedorn (1998), S. 41; Lerchenmüller (1992), S. 15.
[8] Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (1997), S. 1691.
[9] Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (1997), S. 1691.
[10] Vgl. Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e.V. (2003), S. 51.
[11] Quelle: Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e.V. (2003), S. 51.
[12] Die Begriffe Versandhandelsbetriebe, Versandbetriebe, Versandgeschäfte und Versandhäuser werden synonym verwendet.
[13] Vgl. Eli/Laumer (1970), S.13.
[14] Vgl. Meya (1967), S. 7.
[15] Vgl. Werner (1932), S. 114; Nieschlag (1939), S. 9.
[16] Vgl. Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V. (2002), S. 22.
[17] Stratmann (1996), S. 7.
[18] Vgl. Werner (1932), S. 18.
[19] Ebenda, S. 121.
[20] Vgl. Barth/Hartmann/Schröder (2002), S. 102.
[21] Vgl. Werner (1932), S. 18.
[22] Quelle: Eigene Berechnungen. Auswertung von 3.756 Bestellungen, die bei Vinico im Zeitraum Januar 2003 bis Februar 2004 eingegangen sind.
[23] Vgl. Nieschlag (1939), S. 43.
[24] Ebenda, S. 43.
[25] Vgl. Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V. (2002), S. 30.
[26] Ebenda, S. 30.
[27] Vgl. Nieschlag (1972), S. 204.
[28] Vgl. Barth/Hartmann/Schröder (2002), S. 102.
[29] Vgl. Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V. (2002), S. 30-31.
[30] Vgl. Weißburger (1935), S. 15-16.
[31] Vgl. Nieschlag (1939), S. 49.
[32] Vgl. Nieschlag (1939); Weißburger (1935); Werner (1932).
[33] Vgl. Weißburger (1935), S. 22.
[34] Vgl. European Mail Order and Distance Selling Trade Association, http://www.emota.org, Verfügbarkeitsdatum: 23.01.2004.
[35] Vgl. Werner, (1932) S. 116.
[36] Vgl. Werner, (1932) S. 116.
[37] Vgl. Seyffert (1961), S. 273.
[38] Vgl. Nieschlag (1939), S. 20.
[39] Vgl. Spiekermann (1999), S.296.
[40] Vgl. Werner (1932), S. 116.
[41] Vgl. Weißburger (1935), S. 19f.
[42] Vgl. Nieschlag (1971), S. 197.
[43] Vgl. Haupt (2003), S. 45.
[44] Vgl. König (2000), S. 91.
[45] Vgl. Hesse (2002), S. 11-21.
Details
- Titel
- Die Entstehung und Entwicklung des Versandhandels und seine gegenwärtigen Erfolgsfaktoren im E-Commerce
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2004
- Seiten
- 86
- Katalognummer
- V223367
- ISBN (eBook)
- 9783832481438
- ISBN (Buch)
- 9783838681436
- Dateigröße
- 539 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- versandgeschäft vertriebsform e-business einzelhandel
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2004, Die Entstehung und Entwicklung des Versandhandels und seine gegenwärtigen Erfolgsfaktoren im E-Commerce, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/223367
- Angelegt am
- 22.7.2004

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.