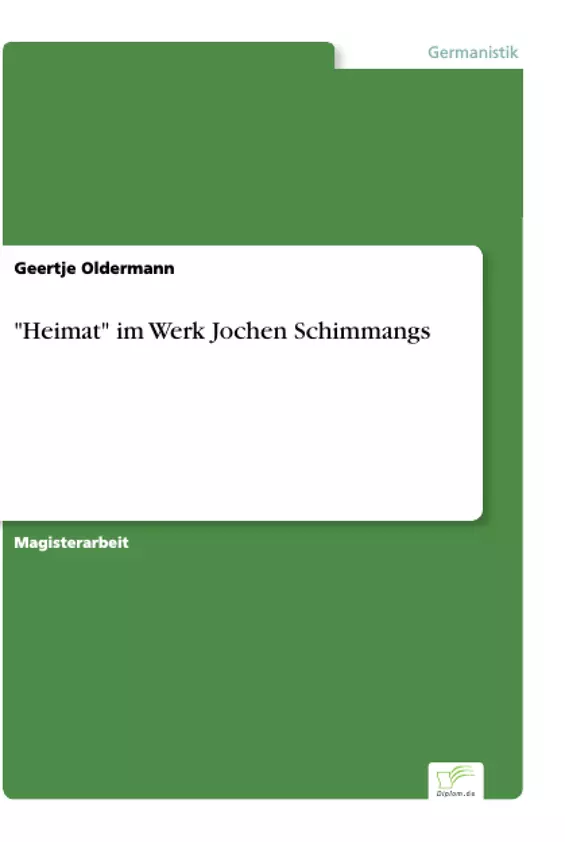Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos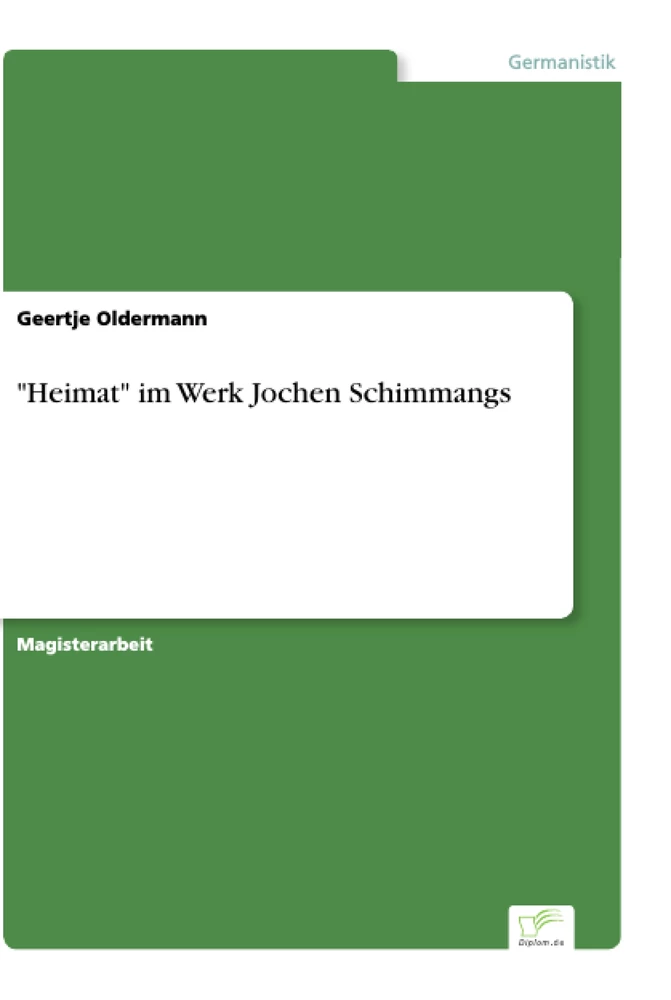
"Heimat" im Werk Jochen Schimmangs
Magisterarbeit, 2003, 78 Seiten
Kategorie
Magisterarbeit
Institution / Hochschule
Note
2,3
Leseprobe
A Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem literarischen Werk Jochen Schimmangs unter dem speziellen Aspekt von ‚Heimat’[1].
Seine Romane und Erzählungen sind dabei Ausgangspunkt und Grundlage für die Untersuchung und Sichtbarmachung des darin transferierten Heimatbegriffs. Im Mittelpunkt stehen das subjektive Erleben in der Wechselwirkung der Beziehung von Protagonist und Heimatraum und das dadurch vermittelte Verständnis von ‚Heimat’.
Der Heimatdiskurs ist ein Thema, das in den letzten Jahren wieder vermehrt auch in den Fokus der Literaturwissenschaftler gerückt ist.[2],[3] Erschwerend für eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Begriff ‚Heimat’ ist, dass dieser „bis zur Unkenntlichkeit ideologisiert, verkitscht und stilisiert worden ist.“[4] Hinzu kommt, dass, wer immer sich über ‚Heimat’ äußert, durch persönliche Erfahrungen gewissermaßen vorbelastet ist.[5]
Im Bewusstsein dieser Problematik gliedert sich die Arbeit in zwei Teile:
In der Heranführung wird in die Thematik ‚Heimat’ eingeleitet und eine Einführung in die Komplexität dieses Begriffsfeldes gegeben. Zudem gibt es einen kurzen Überblick über die einschlägige Sekundärliteratur zum Heimatbegriff und zu ‚Heimat’ in der Literatur, insbesondere der Siebziger Jahre.
Im zweiten Teil, der Durchführung, werden die Hauptwerke Schimmangs hinsichtlich der dort ausgedrückten Vorstellungen von ‚Heimat’ untersucht.
Ziel dieser thematisch orientierten Textanalyse ist der Nachweis, dass Schimmangs Verständnis von Heimat sehr komplex und in jedem Werk auch durch den Protagonisten individuell geprägt ist. Durch die Herausarbeitung von poetologischen Kategorien soll jedoch gezeigt werden, dass es daneben auch einheitliche Konzepte gibt, die der literarischen Gestaltung von ‚Heimat’ in allen Werken Schimmangs zugrunde liegen.
B Heranführung
1. Annäherungen an einen Heimatbegriff
1.1 Anmerkungen zur Terminologie
Wie in den nachfolgenden Ausführungen deutlich wird, vereint der Ausdruck ‚Heimat’ eine ganze Reihe unterschiedlicher Bedeutungsnuancen, so dass das Wort polysemantischen Charakter besitzt.
Um Missverständnisse zu vermeiden, wird in der vorliegenden Arbeit statt ‚Heimat’ der Terminus ‚Heimatbegriff’ verwendet. Gerade im Zusammenhang von dem allgemeinen, semantisch überladenen Terminus ‚Heimat’ und dem individuellen Verständnis von ‚Heimat’, das Jochen Schimmang durch sein Werk vermittelt, ist diese begriffliche Unterscheidung von größter Wichtigkeit.
Diese Differenzierung macht bewusst, dass bei der Verwendung des Ausdrucks ‚Heimat’ allgemeine und zum Teil ideologisierte Konnotationen und Vorstellungen mitklingen. Mit Hilfe des in Abgrenzung dazu verwendeten Terminus ‚Heimatbegriff’ soll verdeutlicht werden, dass es sich dabei um eine subjektive Konstruktion handelt und dass jeder individuell über ein eigenes Verständnis von ‚Heimat’ und damit auch über einen eigenen Heimatbegriff verfügt.
Die Verwendung des Terminus ‚Heimatbegriff’ bewirkt eine Distanzierung, die einen differenzierten Umgang mit ‚Heimat’ ermöglicht. Ist das Bewusstsein für die Unterschiede in der Begrifflichkeit geschärft, kann auch der Begriff ‚Heimat’ dementsprechend verwendet werden.
1.2 Die Bedeutung des Wortes ‚Heimat’
Eine ausführliche Darstellung der Bedeutungsentwicklung des Ausdrucks ‚Heimat’ würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Daher ist es nötig, Erklärung und Etymologie auf das Wesentliche zu beschränken.
Eine Heranführung an diesen komplexen Begriff könnten die Definitionsversuche in Nachschlagewerken bieten, da sie um eine weit gefächerte Klärung bemüht sind. In den Lexikonartikeln zu dem Begriff ‚Heimat’ lassen sich einige Gemeinsamkeiten erkennen: Der Ort der Geburt, der Kindheit und der Wohnort sind laut Lexikondefinition für die Konstitution eines Heimatbegriffs von Bedeutung.
Dennoch vermag keiner der Artikel[6] das Bedeutungsfeld umfassend abzudecken. Die überzeugendste Darstellung liefert noch das Grimmsche Wörterbuch, da es auf einer großen Bandbreite von Textbelegen beruht.[7] So bietet der Eintrag zwar eine Annäherung aus mehreren Richtungen, doch fehlt den genannten Aspekten die Tiefendimension.
1) heimat, das land oder auch nur der landstrich, in dem man geboren ist oder bleibenden aufenthalt hat: […].
2) heimat, der geburtsort oder ständige wohnort: […].
3) selbst das elterliche haus oder besitzthum heiszt so, in Baiern. […]. woraus der sinn haus und hof, besitzthum überhaupt ausbildet, auszer in Baiern namentlich auch in der Schweiz: […].
4) heimat in freierer anwendung.
a) dem christen ist der himmel die heimat, im gegensatz zur erde, auf der er als gast oder fremdling weilt: […]
b) dichterisch:
der entrückt nun den gefahren,
wie Ulyss nach zwanzig jahren,
in der wünsche heimath ruht. BÜRGER 72b
c) redensarten. in Baiern heiszt ein zweckloses, ungegründetes geschwätz ein schmaz, der keine heimat hat. SCHM. 2, 193;
etwas kommt einem von heimat aus, aus sich selbst; [8]
Ein Beispiel für einen Artikel aus dem Universallexikon ist die letztlich unbefriedigende Definition der Brockhaus Enzyklopädie.[9] Wie der in Anmerkung 8 zitierte Auszug zeigt, werden hier zwar einige Aspekte genannt, jedoch fehlt es auch hier an der nötigen Tiefe und Ausdifferenzierung der Bedeutungsnuancen.
Offensichtlich ist die Bedeutung von ‚Heimat’ derart komplex, dass die durch Kürze bestechenden Lexikonartikel wenig hilfreich für die Darstellung der mit ‚Heimat’ verknüpften Vorstellungen sind. Dennoch geben ihre inhaltlichen Gemeinsamkeiten (Ort, wo jemand zu Hause ist, sich heimisch fühlt; woher jemand stammt, wo jemand seine Kindheit und Jugendzeit verbracht hat; wo man sich niederlässt, Lager) eine Art Bedeutungsrahmen vor, aus dem man schlecht ausbrechen kann. So bleibt auch Schimmangs Heimatbegriff innerhalb dieses Bereichs. Ja, es finden sich sogar auffällige Übereinstimmungen zwischen Heimat, wie sie Schimmang in seinen Werken schildert und den konventionellen ‚Heimat’-Definitionen.
1.3 Heimat – eine wechselhafte Begriffsgeschichte
Es gibt Begriffe, bei denen eine Jahrhunderte lange Verwendung nicht dazu geführt hat, dass Nebenbedeutungen zurücktreten, Konnotationen verblassen und der substantielle semantische Gehalt massiert hervortritt. Stattdessen sind diese Wörter, wie auch der Begriff ‚Heimat’, gekennzeichnet durch Unschärfe und Mehrdeutigkeit.[10]
Der Verlust des konkreten Bezuges wird durch verstärkte Emotionalisierung aufgefangen. [...] Emotionalisierung und Abstraktheit der neuen Bedeutungsvarianten machen den Begriff anfällig für politische Manipulationen.[11]
So geschehen auch in der Zeit des Nationalsozialismus, als über „scheinbar gänzlich unpolitischen Gehalte […] militante nationalistische Ideologien vermittelt wurden.“[12]
Auf den Missbrauch des Heimatbegriffs durch die Nationalsozialisten[13] folgt unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, wie auch schon nach dem Ersten, eine Rückbesinnung auf ‚Heimat’ im Sinne von Herkunftsort. Grund dafür ist die Einteilung des ‚Vaterlandes’ in kleinere Einheiten wie Besatzungszonen und die anschließende Föderalisierung. Eine weitere Erklärung für die wachsende Bedeutung des Heimatraumes liegt im Heimatverlust zahlreicher Flüchtlinge und Umsiedler begründet. So wird der Wert von Heimat als Territorium, das Satisfaktion und Geborgenheit vermittelt, besonders hervorgehoben.
In seiner Darstellung einer Begriffgeschichte stellt Hermann Bausinger fest, dass diese Heimateuphorie im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg jedoch recht schnell wieder verflog, da in der Wachstums- und Planungsphase über regionale Grenzen hinweg „eine von den traditionellen Zwängen und Bindungen befreite und weithin einheitliche Gesellschaft anvisiert“[14] wurde. Zudem war der Heimatbegriff (noch) nicht von den Belastungen des Netionalsozialismus befreit. Erst mit einer zunehmenden Urbanisierung der Landschaft und einer fortschreitenden Industrialisierung kam es zu einer „erneute[n] ‚Heimatkonjunktur’“[15].
Zwei Aspekte führten zu diesem neuen Heimatverständnis. Zum einen ist Heimat nicht mehr „ein ausgesprochenes Freizeit- und Kompensationsphänomen“[16], sondern hat „durch die massiven Eingriffe in die unmittelbare Umgebung jedes einzelnen [...] mit dem Alltag zu tun“[17]. Daraus resultiert ein Verständnis von Heimat, das durch Aktivität, Selbstverwirklichung und „Verantwortung für den Ort“[18] gekennzeichnet ist.
Eckhart Prahl zeigt in seiner Studie[19], dass die in der Entwicklung der Wortbedeutung angelegte und im Nationalsozialismus missbrauchte Gleichsetzung von ‚Heimat’ und ‚Staat’[20] in ganz ähnlicher Weise ebenso zur Zeit des Sozialismus in der ehemaligen DDR stattgefunden hat. Auch dort ist nach dem Zusammenbruch des Staatsapparates eine „Rückkehr zu einer Identifikation mit historisch gewachsenen Regionen“[21] zu beobachten.
Die Bedeutungsgeschichte des Wortes ‚Heimat’ ist also einem stetigen Wandel unterworfen, dessen Ende nicht abzusehen ist.[22]
1.4 Konstitutive Elemente des Heimatbegriffs
In der Konstitution des Heimatbegriffs wirken verschiedene Komponenten zusammen. Andrea Bastian nennt in ihrer begriffsgeschichtlichen Untersuchung des Ausdrucks ‚Heimat’ vier Faktoren, aus denen der Heimatbegriff zusammengesetzt ist: „soziale, räumliche, situative und zeitliche“[23]. Zur Ergänzung führt sie eine emotionale Kategorie ein, „um das Phänomen von ‚Heimatgefühl’ [...] miteinbeziehen zu können“[24].
Benannt mit dem Terminus „Gemeinschaft“, beinhaltet die „soziale Kategorie“ auch Faktoren, die zur Erhaltung und Entstehung dieser Gemeinschaft, z.B. der Familie beitragen, wie Sitten und Gebräuche. Weiter gehören der „sozialen Kategorie“ ebenfalls Beziehungen an, die auf gesellschaftlicher Ebene angesiedelt sind, wie z.B. in Beruf und Verein.
Die „räumliche Kategorie“ definiert sie als „Territorium“, worunter eng gefasst der Wohnraum oder im weiteren Sinne die Landschaft zu verstehen sind, die den begrenzten Heimatraum bilden.
Insgesamt ist für Bastian das Zusammenspiel der oben genannten Faktoren wichtig, um ein Verständnis von ‚Heimat’ zu bekommen.
‚Heimatgefühl’ richtet sich auf Landschaften, Orte, Gebäude (räumliche Elemente) und soziale Beziehungen, die als einmalig empfunden werden. Als Vertrautheitsfaktor wirkt ein bestimmter Raum, in dem sich soziale Bindungen, Gemeinschaft und Tradition verwirklichen können.[25]
Für die Soziologin Ina-Maria Greverus steht zwar der territoriale Aspekt des Heimatbegriffs im Vordergrund, die Frage nach der Bedeutung des Raumes für den Menschen, „da sich alles menschliche Handeln, selbst nur das gedachte und geplante Handeln, in einem konkreten oder vorgestellten Raum abspielt.“[26] Dennoch sieht auch sie die Affektivität der Beziehung zwischen Mensch und Heimat.
[Eine] emotionale Bezogenheit der Subjekte auf einen soziokulturellen Raum, in dem ihnen Identität, Sicherheit und aktive Lebensgestaltung möglich ist oder scheint. Und dieser Raum ist eben nicht für alle Bürger der gleiche, sondern ist objektiv nur Heimat in der Satisfaktion der Subjekte.[27]
Eine Reduzierung auf den räumlichen Bereich erscheint aufgrund der Komplexität des Heimatbegriffs unangemessen. Zur Konstitution eines Heimatbegriffs gehören vertraute menschliche Beziehungen, Familie und Freunde, wie auch vertraute Gewohnheiten und Traditionen. Diese geben aufgrund der Bereitstellung von Verhaltensmustern Sicherheit.[28] Dauerhafte Objektbeziehungen geben der menschlichen Umwelt Konstanz und somit auch dem Menschen selbst.[29]
Auch der Soziologe Friedrich Bülow erachtet räumliche und soziale Faktoren als gleichermaßen wichtig.
Heimat ist nicht ein geographischer Raum an sich [...] sondern eine Verbundenheit, die sich auch noch aus der Ferne und in späterer Zeit des Lebens [...] fühlbar macht [...]. Aber die Raumbezogenheit dessen, was wir Heimat nennen, wird erst erfüllt und gewinnt Leben durch die sozialen Verbundenheiten, die sich im Sinne gemeinsamer Heimat manchmal als stärker erweisen als alle anderen.[30]
Hier wird ein Aspekt genannt, der auch in den Werken Schimmangs eine wesentliche Rolle spielt: Das immerwährende Gefühl von Verbundenheit mit dem Heimatraum der Kinder- und Jugendzeit, das auch nach langer Zeit nicht vergeht. In Form von regelmäßigen Besuchen in ihrer Heimatstadt geben Schimmangs Protagonisten dieser Empfindung nach.[31] Unter Umständen gipfelt ihre Heimatsehnsucht in der Rückkehr in die Heimat.[32]
Ebenfalls einen Beitrag zu den Definitionsversuchen von ‚Heimat’ liefert der Psychologe Alexander Mitscherlich, indem er von ‚Heimat’ als Ort spricht, an dem sich Risiko und Abenteuer mit einem Gefühl von Sicherheit verbunden haben. Als entscheidend benennt er dabei die Möglichkeit des Rückzugs, wenn man sich in Gefahr wähnt.[33]
Auf diese Nuance komme ich in der Auseinandersetzung mit ‚Heimat’ in Schimmangs Werk zurück.
1.5 Die Verwendung des Begriffes Heimat in der Gegenwart
Es wird deutlich, dass der Heimatbegriff in der Realität zwei scheinbar gegensätzliche Tendenzen in sich vereint. Zum einen bietet Heimat einen Ruhepunkt, einen (wie auch immer) begrenzten Ort der Sicherheit und des Rückzugs. Dieser Aspekt spielt auch für den Heimatbegriff Schimmangs zunehmend eine Rolle. Insbesondere in seinem letzten Werk Die Murnausche Lücke zeigt der Autor, wie wichtig ihm dieser Punkt ist.
Zum anderen wird unter Heimat eine Umgebung subsumiert, die der Mensch aktiv mitgestaltet. „Heimat ist [...] Medium und Ziel praktischer Auseinandersetzung.“[34] Kein Ort der „Sonntagsgefühle“[35], sondern des „Alltag[s] und [der] alltäglichen Lebensmöglichkeiten“[36]. Auch dieser Aspekt findet sich in Schimmangs Werken wieder. Ein Beispiel für den Zusammenhang von Heimatraum und Alltäglichkeit findet sich in Die Murnausche Lücke, wenn Protagonist Murnau nach der Rückkehr in seine Heimatstadt einen Einkaufsbummel schildert.[37] Auch die ausführliche Beschreibung der unterschiedlichen Anforderungen, die Menschen an ihren Heimatraum haben[38], verdeutlicht den Praxisbezug des Lebensraumes.
Im Zuge der zunehmenden Mobilität und des Wandels in unserer Gesellschaft erfährt der Heimatbegriff in der heutigen Zeit eine weitere Akzentuierung: Die Erschaffung von Heimat, sowohl in räumlicher als auch in sozialer Hinsicht. Alexander Mitscherlich beschreibt in diesem Zusammenhang den Menschen als Wesen, das unaufhörlich damit beschäftigt ist, „seine Umwelt aus den natürlichen Gegebenheiten, die er vorfindet, zu schaffen.“[39] Er ist der Ansicht, dass es „keine definitive, keine endgültige Umwelt“[40] gibt, sondern der Mensch sich seine Umwelten, materiell wie sozial, immer wieder neu entwirft.[41]
Dabei kann Heimat nicht mehr auf eine Stadt oder gar nur den Geburtsort eingeschränkt werden. „Es gehör[t] vielmehr die immer wieder als Ausgleichsraum aufgesuchte Wahlheimat [...] dazu.“[42] Dies trifft auch für ‚Heimat’ bei Jochen Schimmang zu. In seinem Erstlingswerk Der schöne Vogel Phönix übernimmt der Ort Tübingen, den Protagonist Murnau nie bewohnt hat, aber immer wieder gern besucht, die Rolle einer Ersatzheimat.
Dennoch ist mir nie der Gedanke gekommen, mich dort anzusiedeln. Das Paradies verliert von seinem Zauber, wenn man ständig darin leben muss, und eine endgültige Übersiedlung hätte sehr schnell das Ende einer Sehnsucht nach sich gezogen.[43]
Es scheint also, dass Heimat viele Orte haben kann, ebenso wie andersherum viele Orte Heimat sein können. Dennoch sind die Voraussetzungen, die vorhanden sein müssen, um sich heimisch zu fühlen, nach wie vor die gleichen. „Heimat ist die menschliche wie landschaftliche Umwelt, an die wir uns rational wie emotional gebunden fühlen, die Identität gibt.“[44]
Diese Aspekte vereint auch Eckhart Prahl in seiner Definition:
Heimat ist der Raum, in dem sich Identität satisfaktionierend entwickeln kann. Das Konzept ‚Heimat’ ist ein Produkt des subjektiven Bewusstseins.[45]
Der zur Zeit der Nationalsozialisten pervertierte und im Zuge der Nachkriegszeit häufig gefühlsüberladene Heimatbegriff erlebt seit den Siebzigern eine Renaissance. Natur- und Landschaftsverbundenheit, Dichtung in Dialekten, Sehnsucht nach Provinz und Ursprünglichkeit, lokalem Traditionsbewusstsein und alternativem Lebensstil bringen eine kritisch-distanzierte, gegenüber Ideologien stets skeptische, jeglichen Idealisierungen abgewandte und vielseitige Heimatliteratur hervor.
2. Die Rückkehr des Heimatbegriffs in die Literatur zur Zeit der siebziger Jahre
Heimat spielt in der Literatur sämtlicher Epochen eine Rolle.[46] Wie „Literatur [...] immer eingebunden [ist] in den historischen und geistesgeschichtlichen Kontext ihrer Zeit“[47], unterliegt such der Heimatbegriff einem Wandel. Hinzu kommt die individuelle Prägung eines Werks durch die subjektive Wahrnehmung seines Autors.
Vor allem Probleme mit durch den Nationalsozialismus vorbelasteten Begriffen zeichneten bis Ende der sechziger Jahre verantwortlich dafür, dass es „eine signifikante Abstinenz hinsichtlich des Heimatbegriffs“[48] gab. Wer sich dennoch damit beschäftigte, war sich der Tatsache bewusst, sich auf einen Anachronismus eingelassen zu haben.[49] Mit dem in Verruf geratenen Ausdruck ‚Heimat’ schwang „die falsche Vorstellung des Dumpfen und Engen, des Beschränkten, der bösartigen Biederkeit und Langeweile“[50] mit.
Zu Beginn der siebziger Jahre begann eine Auseinandersetzung mit dem Heimatbegriff in der Öffentlichkeit stattzufinden. Max Frischs „Fragebogen Heimat“[51] von 1971 gilt als ein Umkehrpunkt, „ab dem ‚Heimat’, wenn nicht dem Begriff, so doch der Sache nach, wieder allgemein in Frage und zur Diskussion gestellt wurde.“[52]
Die Forderung, „‚Heimat’ als wesentliches Moment von Realität anzuerkennen und nicht aus dem Sprachgebrauch auszuklammern“[53], war ein Indiz für das sich verändernde Verhältnis zum ‚Heimatbegriff’. ‚Heimat’ wurde nicht mehr als politikfreier Ort der Sorglosigkeit und unbeschwerter Kindertage gesehen, „[s]ondern ‚Heimat’ wurde Chiffre, um über Probleme einer eigenen Identität [...] nachzudenken“[54].
Mit dem Ende der Protestbewegung und dem damit verbundenen Verschwinden von Utopien ging auch ein Rückgang handlungsorientierter Textproduktion einher. Dies führte zu einer Fokussierung der unmittelbar realen Umgebung und zu einer Beschränkung auf das direkt Erfahrbare. In der Literatur spiegelt sich diese Tendenz in der Rückkehr des Fiktionalen und der Produktion von stark subjektiv ausgerichteten Texten wie Tagebüchern und Autobiographien wieder.[55]
Die eigene Person tritt in den Vordergrund, an die Stelle der Suche nach politischer und gesellschaftlicher Identität tritt die Suche nach privater Identität und Empfindungsrealität.[56]
Ergebnis ist eine neue Subjektivität. Die Literatur erlebt eine Renaissance des Realismus, der in Form autobiographischer Texte, individuell geprägt ist.
Gesellschaftliche Analyse und stilistische Experimente werden abgelöst durch umfangreiche, zumeist am engen Kreis einer geographischen Region orientierte Erzählpanoramen.[57]
Dies ist auch in einigen Werken von Jochen Schimmang der Fall. Sein Romandebüt Der schöne Vogel Phönix. Erinnerungen eines Dreißigjährigen. ist ein „autobiographische[r] Bericht“[58] und auch der zuletzt vorgelegte Roman Die Murnausche Lücke ist „stark autobiographisch geprägt“[59]. Er spielt überwiegend in Ostfriesland, der alten und neuen Heimat des Autors.
Das provinzielle Leben ist durchaus Thema[60], auch wenn hier eine bewusst kritisch-distanzierte Haltung jenseits politischer Idealisierung oder politisch-konservativer Gefühlsappelle eingenommen wird. Texte, die Heimat „primär unter dem Aspekt der Deformation, Öde und Fremdheit“[61] betrachten, werden unter dem Begriff Anti-Heimatroman subsumiert. Hier verbindet sich die Thematisierung von Heimat mit der Forderung nach Realitätsnähe und Exaktheit:
Von einer Heimatgeschichte wird man Genauigkeit erwarten und nicht Unschärfe. In keinem anderen Fall ist der Schriftsteller mit seinem Gegenstand enger vertraut als im heimischen Glücksfall.[62]
Signifikant für den Heimatbegriff in der Literatur der siebziger Jahre ist sein Bedeutungswandel, weg von der Bezeichnung räumlicher Kategorien, hin zu einer Beschreibung innerer Strukturen.[63]
2.1 Poetologische Kategorien in der literarischen Ausgestaltung des Heimatbegriffs
Funktionsgemäß verdichtet sich in der Literatur die Alltagswelt zu „poetischen Mikrokosmen“[64] und eignet sich daher auch, um sich eines derart komplexen Polysems wie des Begriffs ‚Heimat’, anzunehmen. Eckhart Prahl hat in seiner Studie[65] einige poetologische Kategorien herausgearbeitet, die für die Konzeption von ‚Heimat’ in der Literatur der Siebziger wesentlich sind: „Zum einen die Begrenztheit des epischen Raumes und zum anderen die oft autobiographisch geprägte Schreibweise.“[66] Hinzu kommen kritische Reflexion als Folge des durch den Autor und die Lebenserfahrung seiner Romanfiguren subjektiv geprägten Heimatbegriffs sowie der Gegenwartsbezug.
Im Anschluss an meine Analyse von Schimmangs Texten hinsichtlich des Aspekts ‚Heimat’, werde ich untersuchen, inwiefern sich Prahls poetologische Kategorien auch in Schimmangs Werk wiederfinden lassen.
2.1.1 Regionalität
„Die Begrenztheit des epischen Raumes ist wesentliche Voraussetzung für den Erkenntnisgehalt eines Kunstwerks. Sie ist der Schlüssel zur Genauigkeit“[67] und damit ein Bürge für Glaubwürdigkeit. Der klar umrissene epische Raum, entspricht dem Bereich, in dem der Autor seine Erfahrungen gesammelt hat - wobei es für die poetologische Kategorie der Regionalität keine Rolle spielt, inwiefern der fiktive, epische mit dem realen, historischen Raum übereinstimmt. Ihre Funktion ist keine dokumentarische,
sondern bezeichnet den literarisch gestalteten fiktiven Raumausschnitt, der sich [...] in seiner Bindung an die Bewußtseinsperspektive der Figuren entschlüsselt.[68]
2.1.2 Subjektivität
Die subjektive, persönliche Erfahrung des Raumes ist Grundlage für den Heimatbegriff, der episch transportiert wird. Dementsprechend ist das Konzept ‚Heimat’ kein starres Schema, sondern das Ergebnis der individuellen Autobiographie der Romanfiguren.[69] In der literarischen Gestaltung von Heimat bedeutet Subjektivität auch, „daß das Konzept ‚Heimat’ [...] als Produkt des sich selbst entwerfenden Individuums beschrieben wird.“[70]
2.1.3 Kritische Reflexion
In der Folge der genannten ‚Subjektivität’ führt Prahl die kritische Reflexion als poetologische Kategorie zur literarischen Ausgestaltung des Heimatbegriffs ein. Indem er „das Konzept ‚Heimat’ [...] als Produkt des sich selbst entwerfenden Individuums“[71] definiert, stellt er das Subjekt der gesellschaftlichen Ordnung gegenüber. Im Gegensatz zum klassischen Heimatroman, wo aus dem gesellschaftlichen Ausbruch einer Person das kollektive System gestärkt hervor ging, sieht Prahl im ‚Anti-Heimatroman’ der Siebziger diesen Mechanismus umgekehrt: Der „schöpferische [...] Selbstentwurf des Subjekts [wird] gegenüber den Anpassungsforderungen der gesellschaftlichen Systeme ins Recht“[72] gesetzt.
2.1.4 Gegenwartsbezug
Die Beschreibung von Vergangenem findet in den modernen Heimatromanen nach einer „kritische[n] Reflexion der Heimaträume statt“[73] und ist schon aus diesem Grunde kein idyllisierter Rückblick. Heimaterfahrungen vergangener Tage stehen abgeschlossen für sich und werden aus der Gegenwart mit Distanz betrachtet.
2.2 Der Heimatbegriff in der Literaturwissenschaft
Die Beschäftigung der Literaturwissenschaft mit dem Heimatbegriff beginnt in größerem Stile ebenfalls erst einige Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. „Dies hängt damit zusammen, dass der Heimatbegriff durch seine Vereinnahmung i[m] [...] Nationalsozialismus endgültig negativ besetzt schien.“[74] Erst in der Auseinandersetzung von „Blut-und-Bodenliteratur“ und „Asphaltliteratur“[75] entwickelt sich die Grundlage für den heutigen thematisch bestimmten und wertfreien Umgang mit Heimatliteratur.
So galt die Beschäftigung mit Heimatdichtung lange Zeit als konservativ und rückschrittlich. Dazu trug auch die Polarisierung zwischen Großstadt- und Landliteratur bei, die heute jedoch weitgehend aufgelöst ist. „Heimatdichtung im umfassendsten Begriff ist im Grunde ein Großteil aller Lit[eratur], auch der Großstadtdichtung.“[76] Im Zuge der zunehmenden Modernisierung und der damit einhergehenden Zerstörung von Lebensräumen erfuhren ländliche Gegenden eine Aufwertung und damit auch die Auseinandersetzung mit dort angesiedelter Literatur.
2.2.1 Wichtige Beiträge der Sekundärliteratur zum Heimatbegriff
Die Soziologin Ina-Maria Greverus leistete mit ihren Ausführungen zur Bedeutung sprachlicher Darstellungen von Heimat für die Identität des Menschen[77] und der Untersuchung des Bedürfnisses und der Notwendigkeit von Heimat[78] einen wesentlichen Beitrag, der dem Gebrauch eines mystifizierten, rational nicht fassbaren Heimatbegriffs die Grundlage entzieht.
Sie kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass ‚Heimat’ für das Selbstverständnis des Menschen, für seine persönliche Identität von großer Bedeutung ist.[79]
Wie auch immer der beanspruchte Raum kulturenspezifisch umgrenzt werden mag (als Zimmer, als Haus, als Gemeinde, als Kanton, als Vaterland), so ist der Anspruch als solcher auf einen Identität, Sicherheit und Aktion gewährenden Raum wohl ein menschliches Konstituans.[80]
Ihre Definition von ‚Heimat’ als ‚Territorium’ befreit den Ausdruck ‚Heimat’ von seiner begrifflichen Unschärfe und führt zu einer Versachlichung.
Der neutralere ethologische Begriff der Territorialität mit seiner Definition eines auf Identität, Sicherheit und Aktivität orientierten Raumverhaltens erschien mir als günstigere Basis für die Diskussion.[81]
[...]
[1] Darüber hinaus würde sich eine Untersuchung des Zusammenhangs von Autorbiografie und
Heimatverständnis anbieten. Dieser Aspekt bleibt hier unberücksichtigt, da er den Rahmen meiner Arbeit sprengen würde.
[2] Vgl. Pott (Hrsg.): Literatur und Provinz. Das Konzept ‚Heimat’ in der Literatur.
[3] Vgl. Görner (Hrsg.): Heimat im Wort. Die Problematik eines Begriffs im 19. und 20. Jahrhundert.
[4] Ebenda S. 9.
[5] Vgl. ebenda.
[6] Zur Untersuchung herangezogen wurden:
Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 3. Band, S. 1767.
Duden Band 7. Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache, S. 330.
Duden Band 10. Bedeutungswörterbuch, S. 322.
Grimm: Deutsches Wörterbuch: Vierter Band, Zweite Abteilung, S. 864-866.
Kluge: Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, S. 365.
[7] Grimm: Deutsches Wörterbuch: Vierter Band, Zweite Abteilung, S. 864-866.
[8] Ebenda S. 865f.
[9] Brockhaus Enzyklopädie in zwanzig Bänden. Achter Band, S. 316.
„Heimat (ahd. heimoti, zu Heim), allgemein die Umwelt, mit der der einzelne durch Geburt oder Lebensumstände verwachsen ist. Bes[onders] im Deutschen begreift das Wort eine Gemütsbindung ein, das ‚Daheim-Geborgensein’. Naturnahe Verhältnisse, verkehrsferne, abgeschlossene Lage fördern das ‚Heimatgefühl’, es ist jedoch weder auf die Naturlandschaft noch etwa auf die schöne Landschaft beschränkt. Die Klein- und Mittelstadt mit lokalem Geschichtsbewusstsein bietet seit alters ein günstiges Klima für ‚Heimatliebe’ und ‚Heimattreue’. Aber auch moderne Industriestädte können zur Heimat werden. Ebenso wenig sind Familie und Herkunft für das ‚Heimatbewußtsein’ wesensnotwendig […].“
[10] Vgl. Bausinger: Auf dem Wege zu einem neuen, aktiven Heimatverständnis, S. 11.
[11] Prahl: Das Konzept ‘Heimat’, S. 12f.
[12] Bausinger: Auf dem Weg zu einem neuen, aktiven Heimatverständnis, S. 20.
[13] Der Umgang mit dem Begriff Heimat zur Zeit des Nationalsozialismus war keineswegs widerspruchsfrei. Eine genaue Widergabe dieser Problematik würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Daher nur so viel: Nicht mit allen Institutionen, die sich die Pflege von ‚Heimat’ zum Ziel gesetzt hatten, ging das nationalsozialis-tische Regime konform. Messlatte war der Beitrag für die Ziele der Nationalsozialisten. Vgl. Ebenda S. 20f.
Andererseits war Heimatideologie eine Reaktion auf Modernisierungsprozesse, die wiederum von den Nationalsozialisten vorangetrieben wurden.
[14] Ebenda S. 21.
[15] Ebenda S. 22.
[16] Ebenda
[17] Ebenda S. 22f.
[18] Ebenda S. 23.
[19] Eckhart Prahl: Das Konzept ‚Heimat’. Eine Studie zu deutschsprachigen Romanen der 70er Jahre unter besonderer Berücksichtigung der Werke Martin Walsers. Frankfurt / Main 1993.
[20] Stowasser. lateinisch-deutsches Schulwörterbuch, S. 366. ‚patria’ (Lat.) – ‚Vaterland’ (Dt.)
[21] Prahl: Das Konzept ‘Heimat’, S. 13.
[22] Zu einem weiteren Beispiel für Rückstoßeffekte im Sinne von Heimatbewusstsein könnte sich die momentane Globalisierung entwickeln. Dieser Prozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Daher ist es an dieser Stelle nur möglich, auf die Globalisierungsdiskussion zu verweisen.
[23] Bastian: Der Heimat-Begriff, S. 25.
[24] Ebenda S. 218.
[25] Ebenda S. 24.
[26] Greverus: Der territoriale Mensch, S. 50.
[27] Greverus: Auf der Suche nach Heimat, S. 13.
[28] Vgl. Bollnow: Der Mensch braucht heimatliche Geborgenheit, S. 29.
[29] Vgl. Mitscherlich: Die Unwirtlichkeit unserer Städte. S. 128f.
[30] Bülow: Heimat, S. 415.
[31] Vgl. Schimmang: Der schöne Vogel Phönix; Der Norden leuchtet; u.a.
[32] Vgl. Schimmang: Die Murnausche Lücke.
[33] Mitscherlich: Vom möglichen Nutzen der Sozialpsychologie für die Stadtplanung. S. 41.
[34] Bausinger: Auf dem Wege zu einem neuen, aktiven Heimatverständnis, S. 23.
[35] Ebenda S. 22.
[36] Ebenda S. 24.
[37] Vgl. Schimmang: Die Murnausche Lücke, S. 44.
[38] Ebenda S. 41f.
[39] Mitscherlich: Vom möglichen Nutzen zur Sozialpsychologie der Stadtplanung. S. 23.
[40] Ebenda S. 35.
[41] Vgl. ebenda.
[42] Buchwald: Heimat heute: Wege aus der Entfremdung, S. 42.
[43] Schimmang: Der schöne Vogel Phönix, S. 147.
[44] Buchwald: Heimat heute: Wege aus der Entfremdung, S. 54.
[45] Prahl: Das Konzept ‚Heimat’, S. 18.
[46] Vgl. Bastian: Der Heimat-Begriff, S. 174.
[47] Prahl: Das Konzept ‚Heimat’, S. 39.
[48] Bolten: Heimat im Aufwind, S. 26.
[49] Vgl. ebenda.
[50] Baden: Kein Grass ohne Danzig.
[51] Frisch: Gesammelte Werke. Band 11, S. 355-358.
[52] Bolten: Heimat im Aufwind, S. 27.
[53] Ebenda S. 26.
[54] Ebenda S. 28.
[55] Vgl. ebenda S. 28.
[56] Cepl-Kaufmann: Verlust oder poetische Rettung?, S. 64.
[57] Prahl: Das Konzept ‚Heimat’, S. 42.
[58] Schimmang: Der schöne Vogel Phönix, Klappentext.
[59] Hoffmann: Die Murnausche Lücke.
[60] Vgl. Jochen Schimmang: Der schöne Vogel Phönix. Erinnerungen eines Dreißigjährigen (1979); Peter Handke: Kurzer Brief zum langen Abschied (1972); Günter Grass: Aus dem Tagebuch einer Schnecke (1972).
[61] Bolten: Heimat im Aufwind, S. 30.
[62] Brandstetter: Daheim ist daheim, S. 7.
[63] Vgl. Bolten: Heimat im Aufwind, S. 29.
[64] Bastian: Der Heimat-Begriff, S. 219.
[65] Prahl: Das Konzept ‚Heimat’.
[66] Ebenda S. 42f.
[67] Ebenda S. 115.
[68] Ebenda S. 116.
[69] Vgl. ebenda S. 117.
[70] Ebenda S. 117.
[71] Ebenda
[72] Ebenda S. 118.
[73] Ebenda S. 119.
[74] Bongartz: Der Heimatbegriff bei Martin Walser, S. 33.
[75] von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur, Artikel: Blut und Boden-Dichtung, S. 109:
„Sammelb[e]z[eichnung für die polit[isch]- völk[isch] tendenziöse Heimatdichtung und Bauerndichtung unter dem Nationalsozialismus [...]. Sie unterscheidet sich von der bloßen Heimatlit[eratur] [...] einerseits durch die weltanschaul[iche] Überhöhung des Blutsgedankens in Rasse- und Artbewußtsein, den Begriff der Blutsgemeinschaft e[ines] Volkes und ablehnende Verachtung des Rassefremden, andererseits durch melodramat[ische] Pathetisierung des Boden- (Schollen-) Begriffs zu e[iner] betont antizivilisator[ischen] Haltung gegen Verstädterung.“
Artikel Asphaltliteratur, S. 55: „[V]on der NS-Propaganda aufgegriffenes [...] abqualifizierendes Schlagwort für die als entartet, volksfremd, wurzellos und internationalistisch verpönte Großstadtliteratur.“
[76] von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur, S. 363.
[77] Greverus: Der territoriale Mensch.
[78] Greverus: Auf der Suche nach Heimat.
[79] Vgl. Greverus: Auf der Suche nach Heimat, S. 28.
[80] Greverus: Der territoriale Mensch, S. 51.
[81] Greverus: Auf der Suche nach Heimat, S. 28.
Details
- Titel
- "Heimat" im Werk Jochen Schimmangs
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 78
- Katalognummer
- V223092
- ISBN (eBook)
- 9783832478346
- ISBN (Buch)
- 9783838678344
- Dateigröße
- 621 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- gegenwartsliteratur ostfriesland autobiographie literaturwissenschaft nachkriegsliteratur
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2003, "Heimat" im Werk Jochen Schimmangs, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/223092
- Angelegt am
- 24.3.2004

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.