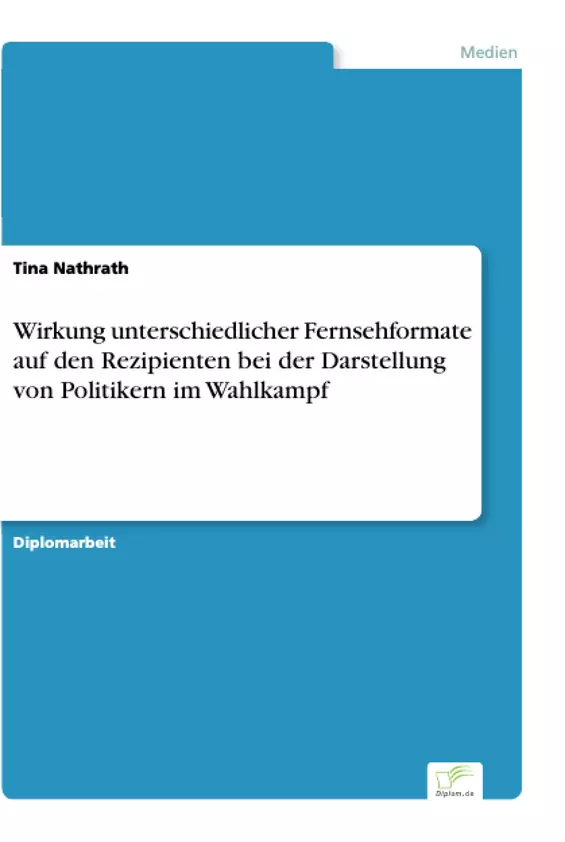Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos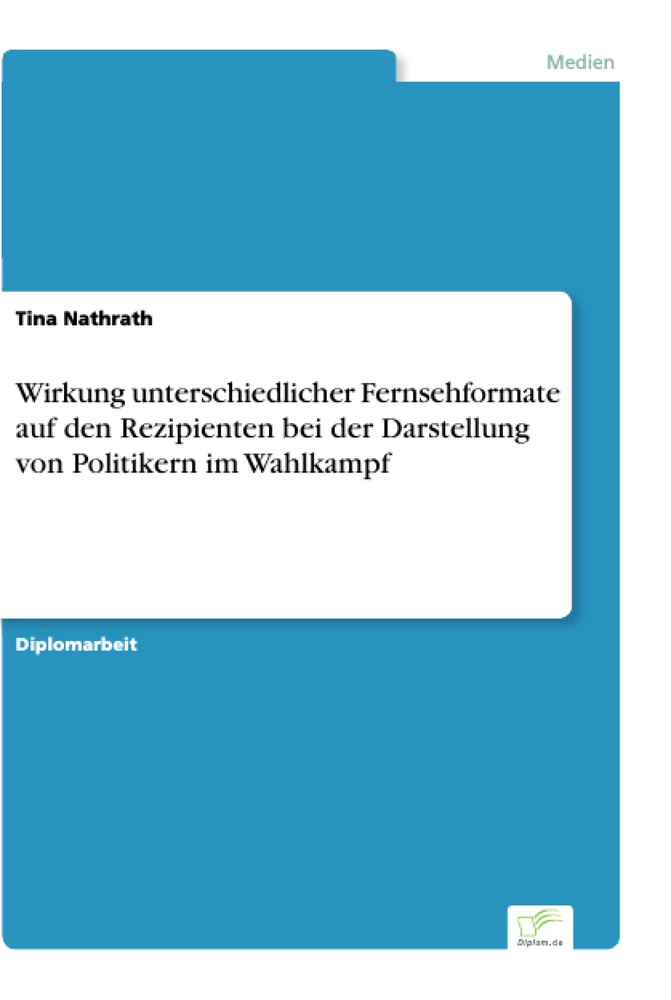
Wirkung unterschiedlicher Fernsehformate auf den Rezipienten bei der Darstellung von Politikern im Wahlkampf
Diplomarbeit, 2003, 136 Seiten
Autor

Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Note
1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Tabellenverzeichnis Haupttext
Tabellenverzeichnis Anhang
Abbildungsverzeichnis Haupttext
Abbildungsverzeichnis Anhang
1. Einleitung
2. Theoretischer Hintergrund
2.1. Trends politischer Fernsehformate
2.1.1. „Personalisierung“ des Wahlkampfs in Deutschland?
2.1.2. Inszenierung von Politik im Fernsehen
2.1.3. Der Formatbegriff
2.2. Die Framing-Theorie
2.2.1. Die Framing-Theorie in der Medienwirkungsforschung
2.2.2. Relevanz der Framing-Theorie für die Untersuchung der Darstellungsweisen von Fernsehformaten
2.3. Die Schema-Theorie
2.3.1. Die Schema-Theorie in der Medienwirkungsforschung
2.3.2. Relevanz der Schema-Theorie für die Untersuchung der Wirkungen von Politikerdarstellungen auf den Rezipienten
3. Fernseh-Wahlkampf aus Sicht der Framing- und Schema-Theorie
3.1. Abgrenzung der Fernsehformate als Frames
3.1.1. Talkshow-Format: Der Polit-Talk
3.1.2. Interview-Format: Politisches Interview
3.1.3. Mischform: Talk-Interview
3.1.4. Gegenüberstellung der untersuchten Formate
3.2. Kategorien der Kandidatenwahrnehmung
3.2.1. Empirische Befunde vorangegangener Studien
3.2.2. Entwicklung eines Befragungsmoduls
3.3. Der Prozess der Wahrnehmung eines Politikers in unterschiedlichen Fernsehformaten
4. Methodik der Untersuchung
4.1. Methodische Zielsetzungen
4.1.1. Erhebungsmethode
4.1.2. Messung
4.2. Untersuchungsanlage
4.2.1. Pre-Test
4.2.2. Durchführung
4.3. Beschreibung der Medienstimuli
4.3.1. Boulevard Bio
4.3.2. Maischberger
4.3.3. Sommer-Interview
5. Ergebnisse
5.1. Beschreibung der Stichprobe
5.1.1. Sozialstrukturelle Daten
5.1.2. Wahlabsicht
5.1.3. Erst- und Zweitstimmen
5.1.4. Kanzlerpräferenz
5.1.5. Kandidat-Partei-Präferenz
5.2. Interpretation der Ergebnisse
5.2.1. Allgemeine Beurteilung Schröders
5.2.2. Beurteilung Schröders mittels Kategorienschema
5.3. Intervenierende Variablen
5.3.1. Änderungen in der Beurteilung nach Zweitstimmen
5.3.2. Mediennutzung, Sendung
5.3.3. TV-Nutzung, Sendung
5.4. Fazit
6. Ausblick
7. Literatur
8. Anhang
8.1. Fragebögen
8.1.1. Erste Befragung
8.1.2. Zweite Befragung
8.1.3. Änderungen aufgrund des Pretests
8.2. Ergebnisse des Experiments
8.2.1. Beschreibung der Stichprobe
8.2.2. Veränderung der Beurteilungen Schröders im Aggregat der Kategorien
8.2.3. Veränderung der Beurteilungen Schröders in den jeweiligen Kategorien
8.2.4. Veränderung der Beurteilungen Schröders nach Indikatoren
8.2.5. Intervenierende Variablen für die Veränderung der Beurteilungen Schröders
8.3. Ehrenwörtliche Erklärung
Danksagung
Hiermit möchte ich allen meinen Dank aussprechen, die an der Entstehung dieser Diplomarbeit beteiligt waren.
Mein besonderer Dank gilt Univ.-Prof. Dr. phil. habil. Gerhard Vowe, der mich mit fachlichen Ideen und Ratschlägen unterstützt hat und mir mit hilfreichen Tipps zur theoretischen Konzeption weiterhalf. Ebenso danken möchte ich Martin Emmer, M.A., der stets tatkräftige Unterstützung und wertvolle Hinweise für die empirische Auswertung meiner Studie lieferte.
Ein ganz herzliches Dankeschön möchte ich auch meinen Helfern Clara Schönnenbeck, Jennifer Disper, Marion Riedle und Christian Potthoff sagen, die mir bei der Durchführung des Experiments behilflich waren und unermüdlich Probanden rekrutierten und die Videoausschnitte vorführten. Außerdem bedanke ich mich bei meinen Eltern, meiner Schwester Birgit, meiner Oma, die jetzt eine Arbeit mehr in ihr „Enkel-Regal“ stellen kann, Clara, Jenny und Wolfgang sowie natürlich Andreas.
Tabellenverzeichnis Haupttext
Tabelle 1: Fernsehformate und ihre charakteristischen Frames
Tabelle 2a: Studien zur Wahrnehmung von Politikern
Tabelle 2b: Studien zur Wahrnehmung von Politikern
Tabelle 2c: Studien zur Wahrnehmung von Politikern
Tabelle 2d: Studien zur Wahrnehmung von Politikern
Tabelle 2e: Studien zur Wahrnehmung von Politikern
Tabelle 3: Sozialstrukturelle Zusammensetzung der Stichprobe im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, in Prozent
Tabelle 4: Beabsichtige Wahlteilnahme, in Prozent sowie Mittelwert
Tabelle 5: Verteilung von Erst- und Zweit-Stimmen in Prozent
Tabelle 6: Parteien- und Kandidaten-Präferenzen der Stichprobe und der Gesamtbevölkerung, in Prozent
Tabelle 7: Änderungen in der allgemeinen Beurteilung Schröders, differenziert nach Sendung und Zweitstimme
Tabelle 8: Varianzanalyse der Kategorien
Tabellenverzeichnis Anhang
Tabelle A-I: Zusammenhang Kandidat-Partei-Präferenz
Tabelle A-II: Aggregat des Kategorienschemas zur Beurteilung Schröders
Tabelle A-III: Veränderung der Beurteilungen Schröders nach Kategorien
Tabelle A-IV: Veränderung der Beurteilungen von Schröders Integrität
Tabelle A-V: Veränderung der Beurteilungen Schröders in der Kategorie Persönliches
Tabelle A-VI: Veränderung der Beurteilungen von Schröders Problemlösungskompetenz (1)
Tabelle A-VII: Veränderung der Beurteilungen von Schröders Problemlösungskompetenz (2)
Tabelle A-VIII: Veränderung der Beurteilungen von Schröders Managerfähigkeiten
Tabelle A-IX: Änderungen in der Beurteilung Schröders nach Parteipräferenz
Tabelle A-X: Fernseh-Nutzung und Beeinflussbarkeit
Tabelle A-XI: Nutzung Talk-Sendungen und Beeinflussbarkeit
Tabelle A-XII: Nutzung politischer Interviews und Beeinflussbarkeit
Abbildungsverzeichnis Haupttext
Abb.1: Vorgehen zur Beantwortung der Forschungsfrage
Abb.2: Das Ann-Arbor-Modell zur Erklärung des Wahlverhaltens
Abb.3: Das modifizierte sozialpsychologische Modell des Wählerverhaltens
Abb.4: Arenen und Faktoren für das Verhältnis von „Parteien“ und „Spitzenkandidaten“
Abb.5: Der Prozess der Wahrnehmung eines Politikers in unterschiedlichen Fernsehformaten
Abb.6: Zusammenhang Kandidat-Partei-Präferenz
Abb.7: Änderungen in der allgemeinen Beurteilung Schröders
Abb.8: Änderungen in der Beurteilung bezüglich Schröders Integrität
Abb.9: Änderungen in der Beurteilung bezüglich Schröders Persönlichkeit
Abb.10: Änderungen in der Beurteilung bezüglich Schröders Problemlösungskompetenz
Abb.11: Änderungen in der Beurteilung bezüglich Schröders Managerfähigkeiten
Abb.12: Änderungen in der Beurteilung Schröders nach Parteipräferenz
Abb.13: Zusammenhang Mediennutzung und Beeinflussbarkeit
Abb.14: Zusammenhang Nutzung von Talk-Sendungen und Beeinflussbarkeit
Abb.15: Zusammenhang Nutzung politischer Interviews und Beeinflussbarkeit
Abbildungsverzeichnis Anhang
Abb.A-I: Indikatoren für Integrität
Abb.A-II: Indikatoren für Persönliches (a)
Abb.A-III: Indikatoren für Persönliches (b)
Abb.A-IV: Indikatoren für Problemlösungskompetenz (a)
Abb.A-V: Indikatoren für Problemlösungskompetenz (b)
Abb.A-VI: Indikatoren für Problemlösungskompetenz (c)
Abb.A-VII: Indikatoren für Problemlösungskompetenz (d)
Abb.A-VIII: Indikatoren für Managerfähigkeiten
1. Einleitung
„Der Kandidat steht im Mittelpunkt“ (Bentele 2002) – so beschrieb Matthias Machnig, Medienberater der SPD, seine Strategie für den Wahlkampf 2002. Es gehe natürlich vor allem um Inhalte, doch könnten diese am besten über Personen – also Gerhard Schröder – umgesetzt werden (vgl. Bentele 2002). Dass Spitzenpolitiker als „Zugpferde“ ihrer Parteien fungieren und deswegen möglichst präsent in den Medien sein sollen, ist nicht erst mit Schröder populär geworden. Auch ihr Einsatz des Privaten als Strategie der Selbstdarstellung in eher unkonventionellen Fernsehformaten stellt keine wirkliche Neuheit dar (vgl. Holtz-Bacha 2002, S.23). In Talk-Shows oder anderen Unterhaltungssendungen können sie mit einem Auftritt mehr Wähler erreichen als in politischen Formaten oder durch persönliche Wahlkampftouren. Außerdem bieten Show-Formate Politikern die Möglichkeit, sich selbst als Person ausführlich darzustellen. Allerdings ist es typisch für solche Formate, dass unerwartete Themen zur Sprache kommen oder gar Überraschungsgäste auftauchen (vgl. Tenscher/ Nieland 2002, S.155-156). Daher ist es schwer für Politiker, sich auf solche Sendungen vorzubereiten. Sie laufen dabei stets Gefahr den Eindruck zu erwecken, sie wollten sich beim Publikum anbiedern. Nicht zuletzt wurde heftig darüber diskutiert, ob mit dem Auftreten der Spitzenkandidaten in Showformaten eine „Entpolitisierung“ und „Banalisierung“ der Politik (Tenscher/ Nieland 2002, S.159) stattfindet.
In welchen Sendungen ist die Chance für Politiker am höchsten, bei potenziellen Wählern eine Veränderung hinsichtlich deren vorgefertigten Meinungen zu ihren Gunsten zu bewirken? Wie wirken sich die Charakteristika der einzelnen Fernsehformate auf die Wahrnehmung durch den Rezipienten aus?
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, vor dem Hintergrund aktueller Theorien der Medienanalyse (Framing-Theorie) und der Medienwirkung (Schema-Theorie) Kausalzusammenhänge zwischen den Bedingungen unterschiedlicher Fernsehformate und der daraus resultierenden Wahrnehmung eines darin auftretenden Politikers aufzudecken. Dies soll in Bezug auf die Darstellung des Kanzlerkandidaten Gerhard Schröder im Bundestagswahlkampf 2002 überprüft werden – in welcher Weise bewirken einzelne Fernsehformate eine Einstellungsänderung beim Rezipienten und wie stark sind diese Änderungen bei einem Vergleich der Formate?
Die Forschungsfrage lautet demnach:
Wie wirken sich unterschiedliche Fernsehformate auf die Bewertungen des Kanzlerkandidaten Gerhard Schröder im Bundestagswahlkampf 2002 durch den Rezipienten aus?
Die folgende Grafik veranschaulicht das Vorgehen, das für die Beantwortung der Forschungsfrage gewählt wurde:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1: Vorgehen zur Beantwortung der Forschungsfrage
Zunächst sollen in Kapitel 2.1 aktuelle Trends in der wissenschaftlichen Diskussion um politische Fernsehformate beschrieben werden. Der immer wieder gestellten Frage nach einer „Personalisierung“ des Wahlkampfes in Deutschland soll zuerst nachgegangen werden; anschließend wird über die Bedeutung der Inszenierung von Politik im Fernsehen diskutiert. Damit das Auftreten der Spitzenkandidaten differenzierter eingeordnet werden kann, erfolgt eine Definition des Begriffs des Fernsehformats.
Um die Beziehungen zwischen Medienangebot (unterschiedliche Fernsehformate) und Medienwirkung (Wahrnehmung Schröders) untersuchen zu können, sollen die Untersuchungsgegenstände jeweils vor einem theoretischen Hintergrund genauer beschrieben werden. Eine theoretische Grundlage für die Analyse der unterschiedlichen Formate liefert die Framing-Theorie, die erklärt, in welcher Weise die Rezipienten Informationen über die Medien angeboten und aufbereitet bekommen (Kapitel 2.2). Die Wahrnehmung medienvermittelter Informationen aus Rezipientensicht wird durch die Schema-Theorie (Kapitel 2.3) näher beleuchtet.
Auf der Basis der theoretischen Erkenntnisse kann nun im Hinblick auf die Forschungsfrage ein Modell des Rezeptionsprozesses für die Wahrnehmung eines Politikers in unterschiedlichen Fernsehformaten während des Wahlkampfes entwickelt werden. Zunächst sollen daher die von den zu untersuchenden Formaten begünstigten Frames (Kapitel 3.1) sowie die Kategorien (Kapitel 3.2) beschrieben werden, anhand derer die Rezipienten politische Spitzenkandidaten beurteilen. Abschließend für dieses Kapitel verdeutlicht ein Schaubild den Zusammenhang der vorherigen Überlegungen (Kapitel 3.3).
Kapitel 4 erläutert, welche Methodik für die empirische Untersuchung gewählt wurde: Methodische Zielsetzungen (Kapitel 4.1) und die Untersuchungsanlage (Kapitel 4.2) tragen dem theoretischen Ansatz durch eine geeignete Auswahl der Erhebungsmethode Rechnung. Die als Stellvertreter ihrer Formate ausgewählten Sendungen werden in Kapitel 4.3 kurz präsentiert.
Die Ergebnisse des zuvor beschriebenen Experiments werden in Kapitel 5 vorgestellt. Neben der allgemeinen (Kapitel 5.1) und der speziellen Beurteilung (Kapitel 5.2) Schröders anhand der in Kapitel 3.2 entwickelten Kategorien sollen auch intervenierende Variablen (Kapitel 5.3) in die Interpretation miteingeschlossen werden. Die Befunde werden in einem Fazit zusammengefasst wiedergegeben (Kapitel 5.4)
In der nachfolgenden Diskussion (Kapitel 6) wird das verfolgte Forschungsziel aus einer übergeordneten Perspektive betrachtet. Schließlich wird ein Ausblick auf zukünftig wünschenswerte Forschungsprojekte eröffnet.
2. Theoretischer Hintergrund
Politische Kommunikation durch das Fernsehen spielt eine bedeutende Rolle im Wahlkampf und bietet den Spitzenkandidaten der verschiedenen Parteien eine Chance, sich den Wählern zu präsentieren. Laut Jarren und Donges (2002, S.22) ist die politische Kommunikation nicht nur ein Instrument der Politik:
Politische Kommunikation ist der zentrale Mechanismus bei der Formulierung, Aggregation, Herstellung und Durchsetzung kollektiv bindender Entscheidungen. Insofern ist politische Kommunikation nicht nur Mittel der Politik. Sie ist selbst auch Politik.
Auch die Wahlkampfkommunikation kann somit als Politik bezeichnet werden. Inwieweit sich dabei ein Spannungsfeld zwischen Kandidaten, Parteien und Themen in der Medienarena eröffnet und die Politiker den Gegebenheiten der unterschiedlichen Fernsehformate unterliegen, soll in Kapitel 2.1 beschrieben werden. Um auf einer theoretischen Basis Fernsehformate als unterschiedliche Medienangebote und ihre Wirkungen zu untersuchen, werden in Kapitel 2.2 - 2.3 Framing- und Schema-Theorie vorgestellt.
2.1. Trends politischer Fernsehformate
2.1.1. „Personalisierung“ des Wahlkampfes in Deutschland?
In welchem Ausmaß orientieren sich die Bürger bei der Wahlentscheidung an ihrer jeweiligen Bewertung der Kanzlerkandidaten? Präsentieren Medien und Wahlkampfmanager die Spitzenkandidaten auf Kosten der Erörterung politischer Themen? Und welche Zusammenhänge mit anderen relevanten Faktoren für die Wahlentscheidung gibt es?
Diese Fragen werden in der Fachliteratur vielfach unter dem Stichwort „Personalisierung“ diskutiert.[1] Dabei stellen sich die unterschiedlichen Begriffsdefinitionen als ebenso vielfältig heraus, wie auch die verschiedenen Studien hierzu ausfielen. Brettschneider (1998) identifiziert zwei generelle Auffassungen von Personalisierung:
Erstens, die individuelle Wahlentscheidung werde immer stärker von den Einstellungen zu den Kanzlerkandidaten geprägt, statt von politischen Sachpositionen. Zweitens, Kandidaten würden zunehmend aufgrund ihrer apolitischen Persönlichkeitsmerkmale beurteilt, ihre politischen Eigenschaften stünden im Hintergrund. (Brettschneider 1998, S.392)
Annahme vieler Autoren ist, Wahlentscheidungen würden im Allgemeinen nicht rational getroffen werden, sondern seien eher „Bauchentscheidungen“, die sich aufgrund ihrer Emotionalität doch eher an Kandidaten als an Themen orientierten (vgl. Graber 2001, S.47ff. sowie Kuhne 2000, S.299). Argumentiert wird damit, dass die Kommunizierung von „Politiker-Images“ besser akzeptiert würde als die doch eher komplexe Darstellung von Themen („Issues“):[2]
Das Image-Modell reflektiert die Bedürfnisse der Öffentlichkeit besser als das rationale Kampagnen-Modell. Wähler akzeptieren image-orientierte Mitteilungen einfach besser als issue-orientierte Mitteilungen. Die komplexe politische Umwelt wird auf wenige Personen reduziert. Die Kenntnis von Themen und Problemen als Grundlage für Entscheidungen verliert an Bedeutung und wird durch das einfacher strukturierte Konstrukt „Image“ ersetzt. (Kindelmann 1994, S.168)
Auch Marcinkowski und Greger (2000) sehen eine „Personalisierung“ sowohl in den PR-Strategien der Parteien als auch in der Berichterstattung der Massenmedien. Der Begriff der Personalisierung verweist auf einen Entwicklungsprozess, den Marcinkowski und Greger für den Zeitraum von 1977 bis 1998 in einer für die DFG durchgeführten Studie[3] bestätigt sahen. Für sie ist die „Personalisierung der Medienkommunikation […] kein Mythos und auch kein Schlagwort, sie ist ein Realphänomen“ (Marcinkowski und Greger 2000, S.192).
Eine positive Konnotation verbindet Sievert (1996) mit dem Begriff der Personalisierung. Er hält die Personalisierung politischer Öffentlichkeitsarbeit für „gerechtfertigt und sinnvoll“ (Sievert 1996, S.22) und sieht es als Tatsache an, dass politische Botschaften primär über Personen und nicht über Programme transportiert werden können. Seiner Meinung nach ist „Personalisierung […] zur Verbesserung der politischen Kommunikation hilfreich, sofern und solange sie im Interesse einer thematisch gebundenen, politischen Diskussion eingesetzt wird“ (Sievert 1996, S.22).
Wie zuvor bereits erwähnt, wird die Dominanz von „Images“ über „Issues“ in der Forschungsliteratur kontrovers diskutiert (vgl. Vowe und Wolling 2000, S.80ff.; Brettschneider 2002, S.23ff. sowie Johnston 1989, S.379ff.). Die Ablehnung der Personalisierungs-These beruht interessanter Weise auf zwei ganz unterschiedlichen Argumentationsweisen. Während einige Forscher die These empirisch testeten und sie in ihren Studien nicht bestätigt fanden (vgl. Rössler und Meinzolt 2000, S.278 sowie Jakubowski 1998, S.406),[4] verwarfen andere Autoren die hinter der Diskussion stehenden Theorien des Wählerverhaltens. Brettschneider spricht von einer „Scheinkontroverse ‚Kandidat oder Themen?’“ (Brettschneider 2002, S.212). Die Identifikation mit einer Partei sei eine wichtige Determinante für die Wahlentscheidung, was bei dieser Scheindebatte vernachlässigt würde. Man dürfe jedoch nicht außer Acht lassen, dass viele Studien in der „heißen Phase“ des Wahlkampfes stattfanden, also wenige Wochen vor der Wahl. Daher treten die naturgemäß eher kurzfristigen Einflüsse der Themen und der Kandidaten stärker in den Vordergrund (vgl. Brettschneider 2002, S.47), die miteinander verwoben sind (vgl. Brettschneider 2002, S.210 sowie Weaver, Graber, McCombs und Eyal 1981, S.163). Die eher längerfristig vorhandenen Parteineigungen scheinen dagegen weniger wichtig zu werden, insbesondere dann, wenn man die Medienberichterstattung isoliert betrachtet. Entscheidend ist jedoch, wie der Rezipient den Medienstimulus wahrnimmt und interpretiert. Dabei spielt die Parteiidentifikation als langfristig relativ stabiles Element des individuellen Orientierungssystems eine entscheidende Rolle, denn sie steuert in wesentlichem Umfang die Wahrnehmung von politischen Problemen, von politischen Positionen und Problemlösungsfähigkeiten der Parteien sowie der Spitzenkandidaten (vgl. Brettschneider 2002, S.50).
Vor allem Personen, die sich stark mit einer Partei identifizieren, neigen dazu, dieser Partei die Kompetenz zur Lösung politischer Probleme zuzuschreiben und sie den gegnerischen Parteien abzusprechen. Außerdem sehen sie den Kandidaten der eigenen Partei in der Regel in einem positiveren Licht als die Kandidaten der gegnerischen Parteien. (Brettschneider 2002, S.50)
Auch bei Lass (1995) findet sich ein ähnliches Grundmodell (siehe Abbildung 2), das die Parteiidentifikation den politischen Einstellungen gegenüber Kandidaten und Themen vorlagert.[5] Sie wirke als „Vereinfachungsmechanismus“, der es dem Wähler ermögliche, einen ihm vorher unbekannten Politiker zu beurteilen. Er muss „in dieser Situation nur eruieren, welcher Partei der Politiker angehört. Die generelle Einstellung zur Partei verhilft ihm dann auch zu einer Einstellung gegenüber dem Politiker“ (Lass 1995, S.22).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2: Das Ann-Arbor-Modell zur Erklärung des Wahlverhaltens Quelle: Lass 1995, S.22.
Brettschneider (2002) geht noch einen Schritt weiter und konstatiert, dass die Trennung der politischen Orientierungen in Themen und Kandidaten konzeptionell falsch angelegt sei. „Statt zwischen Themen- und Kandidatenorientierungen sollte zwischen Parteien- und Kandidatenorientierungen unterschieden werden“ (Brettschneider 2002, S.211-212). Aus Wählersicht seien dies die entscheidenden Akteure, die dann u.a. im Hinblick auf ihre Problemlösungskompetenz (also in Bezug auf politische Themen) beurteilt würden. Die Themenkompetenz eines Kandidaten sei essenziell bei der Bewertung von Politikern, aber eben nur ein Aspekt neben weiteren Beurteilungsdimensionen wie etwa Integrität, Leadership-Qualitäten oder unpolitisches Erscheinungsbild (vgl. Brettschneider 2002, S.212).[6] Man dürfe nicht Bewertungsmerkmale oder –dimensionen (wie etwa die Themenkompetenz) mit Bewertungsobjekten (Politiker, Parteien) durcheinander bringen. Außerdem würden die Parteien noch vor den Kandidaten die zentralen Beurteilungsobjekte darstellen, zumindest in parlamentarischen Demokratien. Beide Akteure könnten nach den gleichen Beurteilungsdimensionen (jedoch mit verschiedenen Ausprägungen, vgl. dazu die Gegenüberstellung Parteien – Spitzenkandidaten bei Brettschneider 2002, S.211) wahrgenommen werden. Brettschneider kommt also zu folgendem Modell des Wählerverhaltens:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.3: Das modifizierte sozialpsychologische Modell des Wählerverhaltens
Quelle: Brettschneider 2002; S.213.
Eine Begründung Brettschneiders für die Unterscheidung in Parteien- und Kandidatenorientierungen lautet, dass die „Bezeichnung der Bundesrepublik mal als Parteien demokratie, mal als Kanzler demokratie […] auf diese beiden Hauptobjekte für politische Beurteilungen“ (Brettschneider 2002, S.210) verweisen würde. Von einer Themendemokratie sei dahingegen nie die Rede.
Doch auch wenn diese Erläuterungen in Zeiten des Bundestagswahlkampfes als schlüssig erscheinen, erweist sich das Modell als problematisch, sobald der Wahlkampf vorüber ist oder politische Entschlüsse durch einen Volksentscheid gefasst werden sollen. Denn dann muss man Parteien und Spitzenpolitiker dem inhaltlichen Vorschlag, für den die Bürger stimmen können, theoretisch unterordnen. Bei Brettschneider selbst lässt sich daher auch eine gewisse Einschränkung für sein Modell finden: „Parteien und Kandidaten sind zumindest im Wahlkampf aus der Sicht der Bevölkerung die zentralen politischen Akteure“ (Brettschneider 2002, S.212; Hervorhebungen TN). Ob während oder nach einem Wahlkampf, zwischen den einzelnen Akteuren und Themen finden grundsätzlich Wechselwirkungen statt. Nicht nur die Themen sind als „Themenkompetenz“ bei der Beurteilung von Politikern diesen untergeordnet, sondern auch der umgekehrte Fall ist denkbar – bei der Wahrnehmung und Bewertung von politischen Themen kann auch eine Rolle spielen, wie sich ein beim Wähler beliebter Politiker dazu positioniert hat. Für Parteien und Themen gilt dies natürlich analog. Eine interessante Darstellung der Entwicklung des Konstrukts Parteiidentifikation findet sich bei Dahlem (2001, S.88ff.): Zu Anfang der 1960er wurde der Begriff als „durable attachment, not readily disturbed by passing events and personalities“ (Campbell, Converse, Miller, Stokes 1960, S.151, zit. nach Dahlem 2001, S.88) definiert, also als eine stabile Bindung, die nur durch außergewöhnliche Ereignisse erschüttert werden kann. Doch mit der Zeit verwarfen viele Autoren diese Auffassung zugunsten einer neuen Vorstellung von Parteiidentifikation, welche sie als Zusammenfassung früherer politischer Erfahrungen eines Individuums beschrieben, die sich mit neuen Erfahrungen und seinen gegenwärtigen Wahrnehmungen der Politik ändert. Damit kann man die Parteiidentifikation nicht mehr als der Wahrnehmung von Kandidaten oder politischen Sachfragen vorgelagert betrachten, sondern sie wird durch diese erzeugt. Fiorina bezeichnet die Parteiidentifikation als „a citizens running balance sheet on the parties“ (Fiorina 1977, S.618, zit. nach Dahlem 2001, S.89). Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Anzahl von „Wechselwählern“ spricht Dahlem sich dennoch für die Beibehaltung des Begriffs der Parteiidentifikation aus, wobei allzu starre Definitionen aufgegeben werden und durch das „running balance sheet“ ersetzt werden sollten. Ein beträchtlicher Teil der Wählerschaft besitzt eine langfristige Bindung gegenüber einer Partei, auch wenn deren Intensität sich durch aktuelle politische Probleme, neue Kandidaten oder durch die Berichterstattung der Medien ändern kann (vgl. Dahlem 2001, S.90).
Unabhängig davon, zu welchem theoretischen Konstrukt man nun tendiert, muss bei der Einordnung der empirischen Ergebnisse in jedem Falle danach differenziert werden, in welchem Bereich eine Personalisierung stattgefunden haben soll. Brettschneider (2002, S.14) bietet hierfür eine hilfreiche Unterscheidung von drei „Personalisierungs-Arenen“ an:
- Die Personalisierung des Wählerverhaltens,
- die Personalisierung der Wahlkampfführung sowie
- die Personalisierung der Medienberichterstattung.
Auch wenn tatsächlich eine Personalisierung in der Wahlkampfführung oder in den Medien stattfindet, bedeutet dies demnach nicht zwingend, dass die Rezipienten ihre Wahlentscheidung allein auf die Wahrnehmung der Spitzenpolitiker stützen.
Des Weiteren identifiziert Brettschneider (2002, S.207) Faktoren, die einen Einfluss auf die politische Kultur und damit auch auf den Grad der Personalisierung (wenn man dieses sozialwissenschaftliche Konstrukt so akzeptieren und untersuchen möchte) ausüben. Dies sind:
- Institutionelle Faktoren,
- situative Faktoren und
- individuelle Faktoren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.4: Arenen und Faktoren für das Verhältnis von Parteien und Spitzenkandidaten
Quelle: eigene Darstellung, basierend auf Brettschneider 2002, S.206ff.
Die Unterscheidung von Präsidentialismus und Parlamentarismus ist dabei der wichtigste institutionelle Faktor (vgl. Brettschneider 2002, S.207). Bei Präsidentschaftswahlen haben die Spitzenkandidaten naturgemäß einen höheren Stellenwert, da die Stimmen direkt für die Kandidaten abgegeben werden. Im Parlamentarismus sind die Parteibindungen von größerer Bedeutung, hier erlangen die Kandidaten ihren Einfluss hauptsächlich in Verbindung mit Parteibewertungen.[7] Dieser Faktor spricht also für einen eher niedrigen Personalisierungsgrad während des Bundestagswahlkampfes 2002.[8]
Zu den situativen Faktoren zählen die Popularität der Kandidaten und die Themenagenda, wobei das Ausmaß der Personalisierung davon abhängt, wie stark sich die Kandidaten in ihrer Beliebtheit unterscheiden und wie nahe sich die Parteien in ihren politischen Positionen sind (vgl. Brettschneider 2002, S.207). Schröder konnte laut diverser Umfragen der verschiedenen Institute bis zur Wahl deutlich mehr Zustimmung bei der Bevölkerung verbuchen als Stoiber, was auf einen personalisierten Wahlkampf hinweist. Inwieweit die Parteien sich in ihren Programmen unterschieden oder auch eben gerade nicht, wurde während des Wahlkampfes in den Medien kontrovers diskutiert.
Zu den individuellen Faktoren zählen das Vorhandensein und das Ausmaß langfristiger Parteibindungen bei den einzelnen Wählern (vgl. Rattinger 1994, S.272ff.). In den letzten Jahrzehnten ist eine höhere Flexibilität in Bezug auf die Wahlentscheidung festzustellen (vgl. Radunski 1996, S.35 und Dahlem 2001, S.86):
So betrug 1998 der swing zwischen Union und SPD - d. h. die Summe der prozentualen Gewinne und Verluste beider Parteien - immerhin 10,8 Prozentpunkte, mehr als je zuvor bei einer Bundestagswahl; der entsprechende Wert lag 1994 bei nur 5,3 Punkten. (Hartenstein 2002, S.40)
Aktuellen Zahlen einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage zufolge gaben kurz vor der Bundestagswahl 2002 etwa 70 Prozent der Befragten an, einer bestimmten Partei zuzuneigen, doch knapp 30 Prozent konnten sich mit keiner Partei identifizieren (vgl. Faas 2003, S.12). Auch das Stimmen-Splitting belegt nachlassende Parteibindungen. Bei der Bundestagswahl 1998 gab immerhin jeder fünfte Wähler seine beiden Stimmen verschiedenen Parteien; in den frühen achtziger Jahren war das jeder zehnte, in den frühen sechziger Jahren jeder zwanzigste Wähler (vgl. Hartenstein 2002, S.40). Dieser Umstand dürfte dazu beitragen, dass der aktuellen Berichterstattung der Medien und den damit verbundenen kurzfristigen Faktoren (Einfluss der Spitzenkandidaten und der politischen Themen) heute ein größerer Stellenwert für das Entscheidungsverhalten zumindest eines Teils der Wählerschaft zukommt als zu früheren Zeiten, in denen die klassischen Wahlstudien minimale Medieneffekte feststellten (vgl. Dahlem 2001, S.92). Damit spielt die Beurteilung der Kandidaten (im Zusammenspiel mit der Parteiidentifikation und aktuellen politischen Themen) eine mitentscheidende Rolle für den Wahlausgang.
2.1.2. Inszenierung von Politik im Fernsehen
Inwieweit eine Personalisierung des Wahlkampfes in der Medien-Arena stattgefunden hat, bleibt umstritten. Tatsache ist jedoch, dass die Spitzenkandidaten in den unterschiedlichsten Fernsehformaten auftreten, sei es in Talk-Shows, politischen Interviews oder auch in einer Daily Soap wie „GZSZ“ (Gute Zeiten – schlechte Zeiten). Radunski konstatiert: „Aus dem Parteienwahlkampf ist der Fernsehwahlkampf geworden“ (Radunski 1996, S.36). Sichtermann spricht von einer „Fernsehdemokratie“[9] (Sichtermann 1994, S.77) und Müller von einer „Telemediatisierung der Wahlkampfführung“ (Müller 2002), in der Lass (1995, S.27) den „Telepolitiker“ verortet. Dies führt oftmals zu kritischen Bemerkungen seitens der Politik- und Medienwissenschaftler, vor allem aber auch seitens der Journalisten und anderen Medienvertretern selbst. Dieses Phänomen wurde von Meyer, Ontrup und Schicha (2000, S.50ff.) aufgegriffen:
Wo immer Schröder oder auch sein Wahlkampfberater Bodo Hombach auftraten, lösten sie eine Fülle von Kommentaren aus, in denen von einem „amerikanischen Wahlkampfstil“ die Rede war und in denen massenhaft die Vokabeln „Inszenierung“ und „Selbstdarstellung“ fielen […]. Längst ist eine Paradoxie zur Selbstverständlichkeit geworden: In den Medien finden diejenigen Akteure besondere Aufmerksamkeit, die vor der Mediatisierung der Politik warnen. (Meyer, Ontrup und Schicha 2000, S.51)
Es wird behauptet, eine angebliche „Amerikanisierung“[10] des deutschen Wahlkampfes hätte zur Folge, dass es nicht mehr um politische Inhalte, sondern lediglich um eine positive Selbstdarstellung der Spitzenkandidaten ginge (zu einer kritischen Diskussion vgl. Kapitel 2.1.1). Journalisten und Politiker sehen in diesem scheinbaren Problem eine Chance für sich, vor den daraus resultierenden Gefahren für die Demokratie zu warnen und „sich dabei die alte Theaterregel zu eigen machen, dass man am schnellsten auf denjenigen hereinfällt, der vor Manipulatoren und Dunkelmännern warnt“ (Meyer, Ontrup und Schicha 2000, S.52). Auf diese Weise wollen die Medienakteure und Spitzenkandidaten den Vorwurf entkräften, sie würden mittels ihrer Auftritte zu einem Verfall der Demokratie beitragen, obwohl sie sich selbst gerade an dem beteiligen, was sie so vehement kritisieren.
Tatsächlich sind die Massenmedien – also auch das Fernsehen – das Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren in einer komplexen Umwelt;[11] die Journalisten können gar kein objektives Abbild „realer“ Ereignisse liefern (vgl. Klaus 1996, S.403). Marcinkowski konstatiert:
Die Medien können die Realität oder bestimmte Realitätsausschnitte, wie etwa das Politische der Gesellschaft, vor allem deshalb nicht umfassend spiegeln, weil gar keine allgemeingültige Repräsentation dieser faktischen Realität denkbar ist, an der sie sich dabei orientieren könnten. (Marcinkowski 1994, S.46)
Auch aus technischer Sicht sind Medien keine Mittel zur Übertragung von Informationen, sondern sie bilden nur eine Vorstruktur für das, was sie zu übertragen vorgeben (vgl. Meyer, Ontrup und Schicha 2000, S.53). Medien wie z.B. das Fernsehen „bringen also weniger durch ihre Inhalte gesellschaftliche Effekte hervor als vielmehr durch ihre spezifischen Eigenschaften“ (Meyer, Ontrup und Schicha 2000, S.53).
Wie Meyer, Ontrup und Schicha (2000) betont Pfetsch die Annahme, dass die Funktion der Medien nicht in der reinen Vermittlung von Informationen liegt, sondern darin besteht, eine (Vor-)Struktur nach zeitlichen und räumlichen Kriterien zu schaffen. Medienakteure sind nicht „’Diskjockeys’ für politische Meinungen und Handlungen, sondern sie erbringen eine eigenständige, umfassende Inszenierungsleistung“ (Meyer, Ontrup und Schicha 2000, S.60).
Selbst Live-Sendungen sollte man nicht als Wiedergabe eines Ereignisses betrachten, sie stellen bereits eine Interpretation des Ereignisses dar. Die professionelle Kameraführung etwa ist dabei ein wichtiges Stilmittel, das eigene erzählerische Qualitäten besitzt, wie auch Holly, Kühn und Püschel (1985, S.259) bestätigen: Ob überhaupt und wie etwa ein Blickkontakt oder eine Geste vom Zuschauer verstanden werden kann, hängt oftmals von der Kamera ab, die das Auge des Zuschauers lenkt. Eine unterstreichende Armgeste in Nahaufnahme ist beispielsweise stärker im Blickfeld, als wenn sie vom Zuschauer aus einem kompletten Wahrnehmungsfeld herausgepickt werden muss. Unabhängig vom Inhalt entsteht so schon rein visuell der Eindruck prägnanter überzeugender Argumentation (vgl. Holly, Kühn und Püschel 1985, S.259).
Es kommt also nicht allein darauf an, über was die Politiker reden und wie sie sich dabei verkaufen, sondern auch auf die Art und Weise, in der ihre Äußerungen und Gestik dem Zuschauer vermittelt werden. Natürlich geht die Funktion eines Formats (z.B. Talk) noch weit über die vorstrukturierte Vermittlung eines Interviews oder einer Diskussion im Sinne einer bestimmten Beleuchtung, Kameraführung oder Studiogestaltung hinaus. Die im Fernsehen gezeigten Akteure haben meist genaue Vorstellungen davon, wie sie sich in einer bestimmten Sendung zu verhalten haben und was allein aufgrund der Tatsache, dass sie in einem bestimmten Format auftreten, von ihnen erwartet wird.
Auch Auftritte von Politikern im Fernsehen werden von diesen selbst immer demonstrativer nicht nur als medien-, sondern als genrewirksame Ereignisse gestaltet. Politikersein heißt, mediale Herausforderungen zu parieren und sich unterschiedlichen Genres und Spielregeln möglichst virtuos anzupassen. (Meyer, Ontrup und Schicha 2000, S.65)
Kurt (1998, S.574) geht sogar soweit, einen „neuen Politikertypus“ in Schröder zu sehen, dessen Ausdruckstechnik für einen „Instantpolitiker“ spreche, der sich „aufgegossen mit einem heißen oder kalten Medienformat, augenblicklich und voll und ganz in dieser medialen Situation aufzulösen vermag, und in diesem aufgelösten Zustand ‚nach Politiker schmeckt’“ (Kurt 1998, S.574).
Der Grad der „Ritualisierung und Inszenierung dieser Auftritte“ (Sarcinelli und Tenscher 1998, S.308) hat beträchtliche Ausmaße angenommen; die Politiker werden auf ihre Fernsehauftritte und die dortige Umsetzung inhaltlicher Strategien genau vorbereitet. Dies wird erst durch die Tatsache ermöglicht, dass politische Fernsehgespräche für den Zuschauer inszenierte Ereignisse mit hohem Wiedererkennungswert sind. Nicht nur den Politikern, auch dem Publikum ist wohl meist bewusst, dass die Kommunikation in solchen Gesprächen „trialogisch“ statt „dialogisch“ abläuft: Die Äußerungen der Politiker scheinen zwar vordergründig an den direkt angesprochenen Gesprächspartner gerichtet zu sein, doch eigentlicher Adressat ist der Zuschauer (vgl. Sarcinelli und Tenscher 1998, S.308-309).
Dies führt letzten Endes zu der Schlussfolgerung, dass politische Fernsehdiskussionen inszeniert sind: Die Politiker diskutieren nicht wirklich, sondern führen nur eine Diskussion vor (vgl. auch Holly, Kühn und Püschel 1985, S.261):
Diskutieren vorzeigen – diese Formel kennzeichnet politische Fernsehdiskussionen nicht nur als zutiefst theatralisches Ereignis, sondern macht gleichfalls deutlich, dass das demonstrative Vorzeigen des engagierten Streitens um die Sache […] von ganz anderen Faktoren geregelt wird, die im Bereich politisch vorgeprägter und institutionalisierter Geltungsansprüche liegen. (Meyer, Ontrup und Schicha 2000, S.89)
Während ihrer Auftritte müssen die Politiker dabei versuchen, ihrem Medienprofil und Medienimage zu entsprechen, um den Erwartungen der Zuschauer gerecht zu werden. Diese gewinnen „zwangsläufig ein imaginäres Bild politischer Entscheidungsprozesse als ‚miteinander reden können’ oder sogar ‚miteinander reden müssen’ […], das eine hohe Resistenz gegenüber den tatsächlichen Prozessen der Politik aufweist“ (Meyer, Ontrup und Schicha 2000, S.90, vgl. auch Jäckel 1998, S.320-322). Übereinstimmend halten auch Sarcinelli und Tenscher (1998) fest, dass solche politischen Sendungen in den Köpfen der Wähler den Eindruck vermitteln, dass die wesentlichen Entscheidungen in einem demokratischen, freiheitlichen System aus Diskussionen hervorgehen (vgl. Sarcinelli und Tenscher 1998, S.309). Marcinkowski verweist auf ein „eher zu politikzentriertes, jedenfalls ein zu gouvernementales Bild der Politik“ in den Medien, die der „Einfachheit halber immer noch so tun, als regierten die ‚scheinbar Regierenden’ (Bourdieu)“, während in Wirklichkeit „längst in einem ‚polyzentrischen Netzwerk’ (Teubner) von Verbänden und Unternehmen regiert“ (Marcinkowski 1994, S.51) würde, die ihrerseits ebenfalls die Vorstellung pflegten, von den Regierenden regiert zu werden. Meyer, Ontrup und Schicha widersprechen allerdings der „öffentlichen Wahrnehmung“, die inszenierte Darstellung von Politik und Politikern würde die Öffentlichkeit bewusst täuschen, Manipulation betreiben und den Eindruck politischer Kompetenz suggerieren, die faktisch in vielen Fällen nicht vorhanden sei (vgl. Meyer, Ontrup und Schicha 2000, S.95).
Ob den Zuschauern ein unzutreffendes Bild von politischen Realitäten vorgespiegelt wird oder nicht, sie müssen die „Regierenden“ wählen und gewinnen einen bedeutenden Teil ihrer politischen Informationen – ob wahr oder unwahr – aus den Medien (vgl. Anfang dieses Kapitels).[12] Dabei leisten die unterschiedlichen Formate einen Beitrag zur Vermittlung von Politik mittels ihrer individuellen Regeln und Logiken, die man als eigene „Grammatik“ interpretieren kann (siehe Kapitel 2.1.3). Die Darstellung von Politikern erfolgt quasi in verschiedenen Sprachen; während der Rezipient entscheidet, von welcher er sich am ehesten angesprochen fühlt, müssen sich die Politiker dem Format anpassen, „seine Sprache sprechen“ und das „Vokabular“ kennen.
2.1.3. Der Formatbegriff
Das Fernsehen hat wie alle anderen Medien auch seine ganz eigene „Grammatik“ (vgl. Pfetsch 1998, S.650), die sich nach und nach in seinem Kulturraum (z.B. „TV-Produktionen aus Deutschland“, „deutschsprachige Sendungen“ oder „westliche Formate“[13] ) entwickelt hat. Man kann einzelne Merkmale daher nicht „universell“ festlegen, doch man kann für einen definierten Kulturraum zu einer bestimmten Zeit immer wiederkehrende Regeln ausmachen, die sich in den unterschiedlichen Formaten manifestieren. Pfetsch beschreibt diese wie folgt: “Formate bezeichnen die Gestalt, die Regeln und die Logik, welche Informationen in die erkennbare Form eines spezifischen Mediums transformieren“ (Pfetsch 1998, S.650).
Im Gegensatz zu Pfetsch, die das Medium den Formaten als „Formgeber“ zugrunde legt, geht Hickethier jedoch davon aus, dass Formate auf Genres aufbauen, die ihrerseits nicht an ein Medium gebunden sind. Er definiert Genres als inhaltlich-strukturelle Bestimmungen, die das Wissen über Erzählmuster, Themen und Motive organisieren. Als Beispiele nennt er Krimis, Western und Liebesgeschichten, die man medienübergreifend im Kino, Fernsehen, Theater oder Roman finden kann (vgl. Hickethier 2001, S.213). Das Format wiederum wird hauptsächlich für das Fernsehen entwickelt und geht von einem radikalen Marktbegriff aus: Im Unterschied zum Genre kennt es laut Hickethier (2001, S.215) keine historischen Formentraditionen, sondern sieht alle Elemente ausschließlich unter dem Aspekt ihrer aktuellen Verwertbarkeit. Während das Genre also relativ stabil bleibt, unterliegen Formate einem radikalen, dynamischen Anpassungsprozess an den Publikumsgeschmack. Das Format zielt auf eine kontinuierliche – und damit serielle – Produktion und eine ständige Anpassung an erkennbare Veränderungen dieses Publikumsgeschmacks (vgl. Hickethier 2001, S.215). McQueens Beschreibung von Genres, der diese als eine Entwicklung von Gebräuchen definiert, die durch die ständige und „Genre“-spezifische Wiederholung dem Publikum immer bekannter erscheinen, würde daher aus der Sicht Hickethiers eher für Formate zutreffen:
Genre is a French word meaning type and refers to types or categories of media products. Soap operas, situation comedies, police series, quiz shows and news programmes are just some of the genres to be found in television. […] Genres are identified by the particular conventions they use which we come to recognize through regular contact. Conventions are any elements which are repeated in such a way that they become familiar, predictable and associated in their use with a particular genre. (McQueen 1998, S.27)
Hickethier hebt Gameshows und Talkshows als nichtfiktionale, unterhaltende Sendeformate hervor, die typische Vertreter des Fernsehens der 1990er sind (wobei auch im fiktionalen Bereich eine Prägung von Formaten betrieben wurde). Bei ihrer Entwicklung werden die vorhandenen Elemente der Genres ausdifferenziert und „die auf diese Weise erweiterten Bausätze auf ihre Marktfähigkeit durchgetestet“ (Hickethier 2001, S.215). Die Einschaltquote im ausgewählten Zuschauersegment ist also letztendlich ausschlaggebend für die Durchsetzung eines bestimmten Formats. Im Falle eines Erfolgs besteht seine Aufgabe in der Schaffung gleich bleibender Standards in einer seriellen oder sequentiellen Produktion (vgl. Hickethier 2001, S.215).
Auch bei Pfetsch findet sich das Zusammenspiel zwischen der Standardisierung durch die Kommunikatoren einerseits und die Akzeptanz bei den Zuschauern andererseits (wenn auch mit stärkerem Schwerpunkt bei den Kommunikatoren):
Medien-Formate haben bei der Produktion von Medieninhalten ähnliche Funktionen wie die Grammatik in der Sprache oder die Erzählform in der Literatur. Ihre Standardisierung und Akzeptanz ergeben sich in dem Ausmaß, wie Kommunikatoren die Anforderungen im Umgang mit Informationen tradieren. (Pfetsch 1998, S.650)
Beim Fernsehen können solche Anforderungen z.B. die Zugänglichkeit zu Informationen, ihre Visualisierbarkeit, ihre Dramatisierbarkeit, die Kohärenz der Information oder auch das vom Kommunikator unterstellte Publikumsinteresse sein (vgl. Pfetsch 1998, S.650). Ihnen muss von den Medienproduzenten unter Berücksichtigung der Gestalten, Regeln und Logiken für das jeweilige Fernsehformat entsprochen werden. Diese Anpassungsfähigkeit an das Publikumsinteresse wurde auch von den Produzenten politischer Fernsehformate verlangt:
So haben sich in den vergangenen Jahren u.a. einige der ehemals „klassischen“ Formate der politischen Berichterstattung - Nachrichtensendungen, Reportagen und politische Magazine - in Inhalt, Darstellung und Qualität „erneuert“ und dabei dem vermeintlichen Publikumsgeschmack angenähert. (Tenscher 1999, S.317)
Beispiele für aktuelle politische Formate finden sich in Kapitel 3.1. Dort werden die Formate näher beschrieben, deren Einflüsse auf die Rezipienten in einer empirischen Studie (vgl. Kapitel 4 und 5) untersucht wurden.
2.2. Die Framing-Theorie
In welcher Weise die Wähler politische Informationen über die Medien angeboten und aufbereitet bekommen, ist eine wichtige Frage für die politische Medienforschung. Eine relativ neue Herangehensweise an dieses Problem stellt die Framing-Theorie dar. In der Vergangenheit konzentrierte sich die empirische Medienforschung bei der Analyse von Medieninhalten und deren Wirkungen lange Zeit auf die bloße Beschreibung von „Fakten“, die durch den Text einer Sendung dargestellt wurden. Vergessen wurde dabei, auch den Zusammenhang, in dem eine Information präsentiert wird, oder die Wirkung von Bildern zu berücksichtigen (vgl. Scheufele 1999, S.91). Aus diesem Grund soll im Folgenden die Framing-Theorie vorgestellt und die sich daraus ergebenden Implikationen für die Präsentation politischer Kommunikation in unterschiedlichen Fernsehformaten beschrieben werden.
2.2.1. Die Framing-Theorie in der Medienwirkungsforschung
Frames bezeichnen Interpretationsmuster, die zur Einordnung und Verarbeitung von neuen Ereignissen und Informationen herangezogen werden (vgl. Ball-Rokeach 1990, S.255 sowie Scheufele 1999, S.92). Personen, Rollen, Vorgänge, Sachverhalte und Ereignisse werden also über die Selektion und Betonung bestimmter gedankenleitender Realitätsaspekte unterschiedlich präsentiert und definiert (vgl. Peter 2002, S.21 sowie Scheufele 1999, S.93). Hänsli beschreibt Framing als „den Prozess, durch den Themen mittels Attribuierung bestimmter Merkmale in den Medien genauer definiert und an das Publikum vermittelt werden“ (Hänsli 2002, S.12). Daher bezeichnet man Framing oft auch als Agenda-Setting auf der zweiten Ebene (vgl. Hänsli 2002, S.12, Hooffacker und Lokk 2002, Schmitt-Beck 2000, S.325 sowie Price, Tewksbury und Powers 1997, S.482). Frames bezeichnen die Perspektive, aus der ein Thema oder Ereignis gesehen wird; sie „vereinfachen die Informationsaufnahme beim Publikum; in Bruchteilen von Sekunden werden bestehende Vorstellungen von Moral, Verantwortung und so weiter auf das ‘geframte’ Thema übertragen.“ (Hänsli 2002, S.12, vgl. auch McLeod, Kosicki und McLeod 2002, S.231). Damit bedeutet Framing also weit mehr als eine bloße Zugabe zu einem immer gleich wahrgenommenen Bild:
Die Metapher des Rahmens veranschaulicht den Stellenwert dieser Deutung für die Interaktion und differenziert zugleich ihre unterschiedlichen Funktionen. Denn ein Rahmen ist nicht Dekor und Umrandung, er ist Grenze und Halt. Und so wie ohne Rahmen kein Fahrrad, kein Auto und kein Fenster, so konstituiert sich erst in der Deutung die Interaktion und reproduziert sich mit ihr. (Vowe 1994, S.433)
Entman (1993, S.52) beschreibt vier verschiedene Funktionen, die Framing leisten kann (aber nicht unbedingt durch z.B. einen einzelnen Text leisten muss):
- Definition des Problems,
- Identifikation von Ursachen,
- moralische Bewertung und
- Vorschlag von Lösungsmöglichkeiten.
Diese Funktionen können dabei im Kommunikationsprozess je nach Kommunikationsebene (Kommunikator, Kommunikat, Rezipient, Kultur) unterschiedlich ausfallen. Der Kommunikator wählt bewusst oder unbewusst solche Frames aus, die in sein eigenes Wertesystem passen. Das Kommunikat beinhaltet Frames, die sich in der An- oder Abwesenheit bestimmter Schlüsselwörter, stereotyper Images, Informationsquellen oder wertender Sätze manifestieren. Die Frames, die der Rezipient verwendet, können aber müssen nicht unbedingt das widerspiegeln, was der Kommunikator beabsichtigt hatte oder durch das Kommunikat nahegelegt wurde (vgl. Entman 1993, S.52). Die Kultur ist die Ansammlung der allgemein bekannten Frames, man könnte Kultur demnach als empirisch nachweisbares Set aller solcher Frames definieren, die sich im Gespräch oder in den Gedanken einer sozialen Gemeinschaft finden lassen (vgl. Entman 1993, S.53).
Eine Reihe von Autoren hat sich mit der Untersuchung des Nachrichten-Framing („news framing“, vgl. McLeod und Detenber 1999, Price, Tewksbury und Powers 1997 sowie Rhee 1997) beschäftigt, das darauf abzielt, den Prozess der Betonung bestimmter Aspekte von Nachrichten aufgrund deren thematischer und stilistischer Vermittlung sichtbar zu machen.[14]
Politische Medienbeiträge (als Kommunikate, vgl. Entman 1993, S.52) lassen sich somit als Interpreten[15] aktueller politischer Akteure, Inhalte und Zusammenhänge auffassen, die den Rezipienten einen kognitiven Rahmen und damit Grenzen und Deutungsmuster für deren Wahrnehmungen vorgeben.
2.2.2. Relevanz der Framing-Theorie für die Untersuchung der Darstellungsweisen von Fernsehformaten
Wie im vorherigen Kapitel beschrieben wurde, beinhalten Kommunikate Frames, die sich in bestimmten Schlüsselwörtern, stereotypen Images, Informationsquellen oder wertenden Sätze manifestieren können. Ähnlich wie beim Framing transformieren auch Formate Informationen nach bestimmten Regeln und prägen damit deren Interpretation und Bewertung entscheidend mit.[16] Man kann daher davon ausgehen, dass die einzelnen Formate, die immer wieder gleiche Strukturen reproduzieren, ein jeweiliges Set an Frames wiederverwenden. Während Schlüsselworte wie „Kindheit“ und „persönliche Hobbys“ wohl eher auf eine Talk-Show verweisen, finden sich Gespräche zu „Steuerpolitik“ und „Koalitionen“ in politischen Interviews. Selbst wenn einmal ein ähnlicher Inhalt in den unterschiedlichen Formaten behandelt werden sollte, gibt es doch ganz spezifische Darstellungsweisen, die ganz unterschiedliche Frames ansprechen können. Hooffacker und Lokk beschreiben Framing daher auch folgendermaßen:
Journalisten verhalten sich entsprechend, wenn sie bei einem Thema überlegen: Behandle ich es über diese oder jene Schiene? So kann ein Journalist über einen Parteitag auf der "Schiene parteiinterne Demokratie" berichten, aber auch auf der "Theaterkritiker-Schiene": Wie gut war die Inszenierung? Je nachdem vermittelt er seinem Publikum eine andere Sicht der Dinge (was das Auditorium mit den Botschaften anstellt, ermittelt man in der Rezeptionsforschung anhand der Schemabildung[17] - aber das ist ein anderes Thema). (Hooffacker und Lokk 2002)
Dass Politiker (bzw. deren Integrität) und politische Sachfragen aufgrund des Framings in einem Kommunikat (also auch z.B. in Fernsehformaten) unterschiedlich wahrgenommen werden, konzedieren auch Domke, Shah und Wackman: „We argue that media framing of issues in moral or ethical terms can prime voters to (1) make attributions about candidate integrity, and/ or (2) evaluate other political issues in ethical terms” (Domke, Shah und Wackman 1998, S.51).
Eine Operationalisierung der Funktionen nach Entman für den Print-Journalismus findet sich bei Matthes und Kohring (zit. nach Hooffacker und Lokk 2002):
- Das eigentliche Thema, den Nutzwert des Beitrags, findet man überall, von der Nachricht bis zum Kommentar.
- Auch das Herstellen von kausalen Zusammenhängen („who is responsible?“) leisten alle untersuchten Artikel.
- Eine Bewertung („moral evaluation“) findet sich nur mehr in interpretierenden und kommentierenden Beiträgen, und dasselbe gilt auch
- für Appelle an das Publikum („treatment recommendation“).
Diese Überlegungen beziehen sich jedoch auf die Darstellung von Sachthemen, in denen Politiker höchstens als Verursacher der zu bewertenden Handlungen auftreten. Neben dem Verhalten der Politiker vermitteln die Medien jedoch auch ein Bild von ihren Einstellungen und ihrem Charakter, was in dieser Analyse von Medienframes nicht entsprechend berücksichtigt wird.
Geeigneter für die Untersuchung von Medienframes im Wahlkampf ist daher die Unterscheidung Scheufeles (1999, S.96) von Personen-, Selbst-, Rollen- und Ereignis-Schemata, bzw. -Frames, in Anlehnung an die Schema-Theorie. Damit wird deutlich, dass nicht nur Ereignisse, sondern auch Personen von den Medien in bestimmten Frames dargestellt werden.
Zusammenfassend kann man die Kategorien von Frames nach den bisher beschriebenen Befunden so einteilen:
- Personen-Frames: Personen-, Selbst-, Rollen-Frames;
- Frames zu Sachthemen/ Problemen: Definition des Problems, Identifikation von Ursachen, moralische Bewertung und Vorschlag von Lösungsmöglichkeiten;
- Ereignis-Frames: Ereignisse, Vorgänge, Sachverhalte.
Mit dieser Typisierung wird allerdings nicht die Frage beantwortet, inwieweit solche Frames an z.B. Inhalte oder Bilder gebunden sind. Und auch allein mit der Unterscheidung von Sachthemen und Personen-, Selbst-, Rollen- sowie Ereignis-Frames ist es noch nicht getan. Wie etwa eine Stellungnahme eines Politikers (Rolle) zu einem politischen Thema (Sachthema) ausfällt, ist auch entscheidend von der Gesprächsatmosphäre abhängig, die durch ein bestimmtes Format erzeugt wird und damit einen Frame für die Präsentation des Politikers darstellt. Aus diesem Grund erscheint eine auf den greifbaren Unterscheidungen der Formate beruhende Kategorisierung von Frames notwendig. Wie diese genau aussehen muss, hängt daher von der Definition der zu untersuchenden Formate ab und wird im entsprechenden Kapitel dargelegt (siehe Kapitel 3.1).
Schließlich kommt es auf den Rezipienten an, wie abstrakt er Informationen über einen Menschen wahrnimmt und ob er eher bildhafte oder textliche Frames verarbeitet. Im nachfolgenden Kapitel soll daher näher darauf eingegangen werden, in welcher Weise Rezipienten mediale Informationen selektieren und interpretieren.
2.3. Die Schema-Theorie
In der Geschichte der Medienwirkungsforschung kann man zwei bedeutsame Paradigmenwechsel beobachten: Während zunächst von einer plausibel erscheinenden starken Medienwirkung ausgegangen wurde, legten immer mehr Studien nahe, dass die Medien keine Meinungsänderungen in der Bevölkerung hervorzurufen vermochten, sondern dass sie lediglich bereits bestehende Meinungen verstärken konnten (vgl. Brosius 1991, S.285). Damit wurde das Paradigma der schwachen Medienwirkung begründet. Innerhalb dieses Paradigmas rückten Rezipientenvariablen immer mehr in den Vordergrund; aus der Synthese der beiden vorangegangenen Paradigmen entwickelten sich verschiedene Ansätze, die sich unter dem Paradigma der selektiven Medienwirkungen zusammenfassen lassen. Die Art und Weise, in der Informationen verarbeitet werden, rückte in den Vordergrund, was unter anderem durch die Schema-Theorie als Ansatz aus der kognitiven Psychologie erklärt wird (vgl. Brosius 1991, S.285). Zuerst wird daher im folgenden Kapitel die Schema-Theorie in der Medienwirkungsforschung dargelegt und anschließend die Relevanz der Schema-Theorie für die politische Medienwirkungsforschung diskutiert.
2.3.1. Die Schema-Theorie in der Medienwirkungsforschung
In den 1930ern wurde das Konzept der Schemata erstmals für den Bereich der Neurophysiologie entwickelt. Sir Frederic Bartlett war aufgefallen, wie sehr das Verstehen und Erinnern von Menschen durch ihre Erwartungen geformt wird. In einer Reihe von Experimenten konnte er nachweisen, dass die schematisch gebildeten Erwartungen der Versuchspersonen die verschiedenen Kognitionsbereiche in hohem Maße beeinflussten (vgl. Eysenck und Keane 1995, S.275). Von der Medienwirkungsforschung wurde die Schema-Theorie unter anderem durch die Arbeiten von Winterhoff-Spurk (1989), Fiske und Taylor (1991), Graber (1993) sowie Brosius (1995) aufgegriffen.
Brosius beschreibt ein Schema als Set von Attributen, das Objekte einer bestimmten Kategorie teilen. Erkennbar als Mitglied eines bestimmten Schemas werden Objekte dann, wenn sie als Träger einiger kritischer Attribute erkannt werden, wie zum Beispiel die Attribute „Federn“ und „Schnabel“ beim Vogel-Schema. Viele Eigenschaften bleiben jedoch dabei unwichtig und werden nicht zur Einordnung in Schemata herangezogen (vgl. Brosius 1991, S.286).
Graber spricht in diesem Zusammenhang von einem „straight matching“, bei dem es genügt, wenn einzelne Informationen beim Abgleich mit bereits existierenden Schemata grob übereinstimmen:
The most common retrieval strategy is „straight matching”. This means that people search their memories for information that broadly matches the new stimulus even though the details differ. (Graber 2001, S.26)
Die Verarbeitung neuer Informationen erfolgt nur in Ausnahmefällen nach komplexeren Prinzipien, die von Graber als „segmentation“[18] und „checking“[19] bezeichnet werden. Diese Verfahren sind jedoch zeitaufwändiger als das einfache „straight matching“ und werden daher nur dann angewendet, wenn sich jemand wirklich in besonderem Maße für eine Information interessiert (vgl. Graber 2001, S.26).
Brosius dagegen hält auch eine Informationsaufnahme ohne sofortige Einordnung in Schemata für möglich und verweist auf den Unterschied zwischen einer „top-down“- und einer „bottom-up“-Verarbeitung: Man spricht von einer „top-down“-Verarbeitung, wenn Schemata die Interpretation der wahrgenommenen Informationen übernehmen und die Suche nach weiterer Information leiten. Eine Theorie allerdings, die eine rein schematische Verarbeitungsweise postuliert, müsste davon ausgehen, dass jede Information, die nicht in irgendeiner Weise bereits repräsentiert ist, ignoriert oder zumindest schnell vergessen wird. Der Mensch würde also wenig dazulernen. Dies ist jedoch nicht der Fall: Wenn die Informationen ohne interpretierende Raster zunächst einmal aufgenommen und als Einzelfall behandelt werden, spricht man daher von einer „bottom-up“-Verarbeitung (vgl. Brosius 1991, S.287).
2.3.2. Relevanz der Schema-Theorie für die Untersuchung der Wirkungen von Politikerdarstellungen auf den Rezipienten
Im vorangegangenen Kapitel wurde gezeigt, dass Menschen Informationen unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Schemata aufnehmen und verarbeiten. Wie lässt sich das Schema-Konzept nun auf die Wirkung von Politikerdarstellungen auf den Rezipienten übertragen?
Rezipienten verarbeiten Medieninformationen nicht, indem sie diese ungefiltert und unverändert abspeichern. Sie werden vielmehr, wie dargestellt, bereits bei der Informationsaufnahme von schon bestehenden Wissensstrukturen geleitet und organisieren die eingehende Information vor dem Hintergrund ihres vorhandenen Wissens. Rezipienten konstruieren sich also, angestoßen von den Medien, ihr eigenes Bild von der Realität. Dies hat Auswirkungen auf die politische Medienwirkungsforschung: Es genügt nicht, Medienwirkung daraufhin zu untersuchen, inwieweit es dem Kommunikator gelingt, seine Information zu übermitteln. Die Perspektive des Rezipienten, der aktiv mit den Informationen umgeht, muss in den Wirkungsprozess integriert werden.
Dabei spielt die „top-down“-Verarbeitung (vgl. Kapitel 2.3.1) eine entscheidende Rolle bezüglich der Massenkommunikation, da Medieninhalte oft gleichartiger und stereotyper Natur sind (vgl. Brosius 1995, S.102). Die Zuschauer halten für die meisten Formen politischer Information – z.B. Fernsehnachrichten – also Schemata bereit, die die Wirkung der Informationen kanalisieren (vgl. Brosius 1991, S.287). Dies trifft sicherlich auch auf die Wahrnehmung von Politikern in den Massenmedien zu: Bei der Erwähnung einer allgemeinen Kategorie kommen dem Rezipienten einige Politiker sicherlich eher in den Sinn als andere. Aufgrund der Tatsache, dass wenige Attribute notwendig sind, um ein Schema zu aktivieren, läuft schematische Verarbeitung natürlich immer Gefahr, voreingenommen und stereotyp zu sein. Insbesondere dann, wenn sich Stimuli nicht eindeutig einem Schema zuordnen lassen, werden abweichende Attribute bei der Informationsverarbeitung durch kongruente Attribute ersetzt oder gar völlig vergessen (vgl. Brosius 1991, S.287).
Bei der Integration der Informationen in bereits bestehende Vorstellungen werden diese selektiert, verkürzt und verallgemeinert – der Rezipient verhält sich „alltagsrational“ (vgl. Scheufele 1999, S.91-92). Aus diesem Grund bilden sich Rezipienten eher heuristische und routinisierte als rationalistische Urteile (vgl. auch Scheufele 1999, S.92):
Gehört beispielsweise das Attribut „korrupt“ zum Politiker-Schema eines Rezipienten, wird er die Information, ein einzelner Politiker habe aufrichtig gehandelt, entweder nicht zur Kenntnis nehmen oder uminterpretieren. Gleichermaßen wird beim Fehlen von entsprechender Information die Korruptheit hinzuaddiert. (Brosius 1991, S.286-287)
Es geht also nicht so sehr darum, wie viele Informationen über einen Politiker in z.B. einer Fernsehsendung präsentiert und behalten werden, sondern welche bereits vorhandenen Schemata sie bei den Zuschauern ansprechen und wie sie infolge dessen eingeordnet und interpretiert werden. Bei der Medienrezeption lässt sich allerdings nicht mehr mit einfachen Schemata arbeiten, die von allen Menschen in etwa gleich wahrgenommen werden (Federn, Schnabel à Vogel) (vgl. Brosius 1991, S.291). Daher muss man bei empirischen Untersuchungen zur Medienwirkung im Auge behalten, dass die Probanden vermutlich die Informationen, die sie aus demselben Medienstimulus beziehen, unterschiedlich selektieren, verkürzen und verallgemeinern (s.o.). Es existieren jedoch allgemein von den Rezipienten geteilte Schemata, die zur Wahrnehmung von Politikern und deren Beurteilung herangezogen werden (vgl. Kapitel 3.2). Dies liegt daran, dass alle Wissensstrukturen, die bereits beim Rezipienten bestehen und in die neue Informationen integriert werden, ihrerseits überwiegend auf mediatisiertem Wissen beruhen. Politische Schemata haben sich also zum großen Teil in der Auseinandersetzung mit den Medien herausgebildet. Sie besitzen deshalb einen medienbezogenen Charakter und sind den Medienformaten angepasst. Werden also Informationen den politisch relevanten Formaten entsprechend angeboten, ist anzunehmen, dass beim Rezipienten bereits ähnliche Schemata existieren. Dies begünstigt schematische Verarbeitungsprozesse.
Wie bereits erwähnt, können schemageleitete Urteile jedoch fehlerhaft sein, da sie nicht durch eine rationale Reflexion der Informationen entstehen, sondern durch automatische Kategorisierungen. Gerade das macht den Rezipienten doppelt abhängig vom Medium: Er erhält nicht nur Informationen über einen Politiker durch die Medien, sondern auch die Art und Weise, mit der er diese Informationen interpretiert, wird stark durch die Medien beeinflusst. Denn die Aktivierung bestimmter Schemata ist abhängig von der Art der Information:
The way a television program or message introduces information and topics [...] will influence which schematic frames are foregrounded by the viewer (which information is attended to and how it guides the viewers’ inferences). (Biocca 1991, S.81)
Politische Sendungen können bestimmte Schemata aktivieren, indem sie diese entweder explizit bedienen oder aber bestimmte Attribute ansprechen, die eng mit einem passenden Schema verknüpft sind. Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, vermitteln die Medien Informationen durch Frames, die von den Rezipienten entsprechend ihrer vorhandenen Schemata aufgegriffen werden (oder eben auch nicht). Die von den Medien angebotenen Frames können den Rezipienten-Schemata entsprechen, sie ergänzen oder ihnen widersprechen. Trotz der Individualität dieses Verarbeitungsprozesses ist jedoch davon auszugehen, dass Rezipienten oftmals die gleichen Frames aufgreifen und sie ähnlich verarbeiten, da sie gleichermaßen ihre Schemata durch die Rezeption von standardisierten Medienangeboten entwickelt haben.[20]
3. Fernseh-Wahlkampf aus Sicht der Framing- und Schema-Theorie
Mit Hilfe der Erkenntnisse zur Beschreibung von Medienangeboten sowie deren Rezeption und Verarbeitung kann nun der Rezeptionsprozess für die Wahrnehmung eines Politikers (Schema-Theorie) in unterschiedlichen Fernsehformaten (Framing-Theorie) während des Wahlkampfes untersucht werden. Zunächst sollen daher die von den zu untersuchenden Formaten begünstigten Frames sowie die Kategorien beschrieben werden, anhand derer die Rezipienten politische Spitzenkandidaten beurteilen. Abschließend verdeutlicht ein Schaubild die vorher gemachten Überlegungen zu den Zusammenhängen zwischen dem Auftreten eines Politikers in einem bestimmten Format und der Wirkung auf seine Wahrnehmung durch die Rezipienten.
3.1. Abgrenzung der Fernsehformate als Frames
In diesem Kapitel sollen die Formate beschrieben werden, die in der empirischen Studie als unabhängige Variablen verwendet wurden (vgl. Kapitel 4.3). Dafür wurden die Sendungen „Boulevard Bio“ (Talkshow-Format) und das „Sommer-Interview“ (Interview-Format) als Vertreter eigenständiger Formate ausgewählt, während die Sendung „Maischberger“ eine „Mischform“ dieser beiden Formate darstellt. Dabei sollen die formatspezifischen Eigenheiten charakterisiert werden; für den Rezipienten irrelevante Rahmenbedingungen wie z.B. die Ausstrahlung der Sendung bei öffentlich-rechtlichen oder privaten Fernsehanbietern können ausgeblendet werden (zu vergleichenden Analysen öffentlich-rechtlicher und privater Programme vgl. Pfetsch 1996, Marcinkowski 1994 und Schatz 1994). Vielmehr wird es darum gehen, Formate im Hinblick auf die von ihnen produzierten Frames zu untersuchen.
3.1.1. Talkshow-Format: Der Polit-Talk
Die Talkshow entstand in den 1950ern als Form der Unterhaltung in den USA, wo sich das Fernsehen frühzeitig als Massenmedium etablieren konnte (vgl. Plake 1999, S.40-41). Die erste deutsche Talkshow „Je später der Abend“ im Dritten Programm wurde am 4.3.1973 gesendet (vgl. Plake 1999, S.42). Dass sich dieses Format immer im Einklang mit den kulturellen Gegebenheiten des jeweiligen Landes entwickelte (vgl. Kapitel 2.1.2), wird von Plake (1999, S.38ff.) detailliert beschrieben. Er gliedert die Talkshow in drei unterschiedliche Grundtypen (vgl. Plake 1999, S.32-33):
- Die Debattenshow oder das Forum,
- die Personality-Show und
- die Bekenntnisshow.
Boulevard Bio etwa kann zum Typus der Personality-Show gezählt werden, denn in dieser Sendung geht es um die Darstellung von Persönlichkeiten, die oft Prominente sind. Anders als bei Bekenntnisshows, in denen die Erzählung, die „story“ (Plake 1999, S.35), wichtiger ist als die Persönlichkeit des Gastes, hält die Identität eines Prominenten bei Boulevard Bio seine Geschichten zusammen:
Einerseits wird jeweils ein Thema vorgegeben, bei großer Variationsbreite, andererseits werden dazu kaum Experten eingeladen, sondern neben Betroffenen bevorzugt Prominente, die dazu persönliche Erfahrungen beisteuern können. Biolek […] erzeugt eine harmonische Gesprächsatmosphäre“ (Erlinger und Foltin 1994, S.92-93.)
In einer Debattenshow dagegen sollen die Teilnehmer ein vorgegebenes Thema diskutieren, der Austausch von Argumenten steht hier also im Vordergrund. Anders als Semeria, der als Elemente der Talkshow neben dem Seriencharakter der Sendung und der zentralen Rolle des Gastgebers die Personen- und nicht Sachbezogenheit der Gespräche anführt (vgl. Semeria 1999, S.29), unterscheidet Plake Talkshows unter anderem nach dem letztgenannten Kriterium.
Dörner beschreibt Talkshows als „ein zum Zweck der massenmedialen Verbreitung inszeniertes Gespräch, dessen primäre Funktion in der Unterhaltung des Publikums besteht“ (Dörner 2001, S.134). Auch er hebt den Seriencharakter des Talks und die zentrale Rolle von konstant auftretenden „Gastgebern“ hervor, als weiteres Merkmal zählt er außerdem die Anwesenheit eines kopräsenten Studiopublikums auf. Dieses kann durch Mimik und Körpersprache Affekte zum Ausdruck bringen und verstärkt so die positiven und negativen Reaktionen in der Interaktion von Moderator und Gästen: „Es belohnt und bestraft, und zwar im Kollektiv, in Stellvertretung eines Millionenpublikums an den Bildschirmen“ (Plake 1999, S.30). Das Publikum übermittelt den Zuschauern die Stimmung im Studio sowie unausgesprochene Gedanken und Gefühle, die beispielsweise zweideutige Formulierungen hervorrufen können (vgl. Plake 1999, S.30).
Übereinstimmend mit Dörner empfindet Plake es als eine „Paradoxie dieses Formats“, dass es „die Show – zumindest scheinbar – unterläuft“ (Plake 1999, S.35). Die Gäste sollen sich in einer Talkshow so präsentieren, dass sie möglichst natürlich und spontan wirken, obwohl das Geschehen für das Publikum inszeniert ist (vgl. Kapitel 2.1.2). Die inszenierte Atmosphäre, die Biolek dabei zu erzeugen versucht, kann dabei vom Publikum als wohltuend „harmonische Gesprächsatmosphäre“ (s.o.) empfunden werden, aber auch als gekünstelt und überzogen freundlich wirken, wie Fischer es sieht:
Das menschgewordene Friedenslächeln namens Biolek überzieht nämlich alle und alles mit der styroporartigen Freundlichkeit und Weltenliebe, die einen dicken stoß-, schlag- und kältefesten Puffer zwischen das Fernsehen und den Rest der Welt legt. Ja, das quietscht und ist dazu noch innen hohl, aber trotzdem funktioniert es stets aufs neue. Bioleks bohrende Fragen beschränken sich auf Wendungen aus dem Sozialarbeitsgrundkurs, nämlich „Wie ist das bei Ihnen?“ und „Kann man das so sagen?“ (Fischer 1996, S.111)
An dieser Stelle soll jedoch keine qualitative Bewertung der Sendung Boulevard Bio erfolgen, sondern auf die möglichen Arten von Frames eingegangen werden, die in einem solchen Format bevorzugt erzeugt werden. Dazu gehört neben einer eher entspannten Gesprächsatmosphäre sicherlich auch die Konzentration des Gesprächsthemas auf den Gast „als Mensch“ (Personen-Frames). Der Politiker soll in der Show mehr als in Interviews oder Pressekonferenzen von sich preisgeben und sich weniger formell als sonst verhalten. Es geht um die Selbstdarstellung des Politikers: Er muss sich geben, wie er „privat“ ist, oder doch zumindest nach Ansicht der Zuschauer sein könnte.
3.1.2. Interview-Format: Politisches Interview
Stellte das Interview für die Medien ursprünglich ein Recherche-Instrument dar, entwickelte es sich im Laufe der Zeit zu einem eigenen Format. Die Interviewer-Strategien begannen als „harmlose Stichwortfragen der 50er Jahre“ (Holly 1994, S.426), wandelten sich dann aber zu immer kritischeren und härteren Strategien. Holly (1994, S.426) fasst einige Merkmale des Formats „politisches Fernsehinterview“ aus pragmalinguistischen und ethnomethodologischen Studien der 1970er und 1980er Jahre zusammen:
1. Interviewer stellen Fragen oder machen Beiträge, die irgendwie als Fragen interpretierbar sind.
2. Interviewte machen Beiträge, die als Antworten interpretierbar sind.
3. Redeteile von Interviewern, die keine Fragen sind, werden als Fragevorbereitungen und –begründungen geäußert und vom Interviewten als solche verstanden.
4. Interviewer eröffnen und beenden das Interview; sie haben das Recht, die Sprecherrolle zuzuteilen und u.U. zu entziehen.
5. Interviewer unterlassen spontane Empfangsbestätigungen und Antwortbewertungen; stattdessen stellen sie Anschluss- und Fortsetzungsfragen.
6. Interviewer treffen in bewertenden oder strittigen Äußerungen Vorkehrungen dafür, dass sie ihre Neutralität rechtfertigen können.
7. Vorübergehende Abweichungen vom Interviewschema führen nicht unbedingt zum Zusammenbruch des Regelapparats, sondern werden in eine grundsätzliche Orientierung an den Regeln eingebettet.
Damit wird klar, dass politische Interviews keinen Plaudercharakter haben, sondern wirklich strikt geregelten Abläufen mit einer klaren Rollenaufteilung von Interviewer und Interviewtem folgen. Kritisch gesehen werden muss allerdings Punkt 5 der Merkmale nach Holly, denn gerade durch Anschluss- und Fortsetzungsfragen kann der Interviewer zum Ausdruck bringen, dass er die gegebene Antwort möglicherweise für unzureichend hält.
Sämtliche angeführten Merkmale könnte man jedoch unabhängig vom Medium für jegliche Interviews aufzählen. Im Fernseh-Format „politisches Interview“ würde man zusätzlich beispielsweise folgende Konventionen erwarten:
- Formelle Kleidung des Interviewers und des Politikers,
- angemessene Gestik und Mimik,
- Fragen meist zu aktuellen Themen,
- eher neutral gestaltetes, nicht ablenkendes Studio (bzw. Drehort),
- keine wilden Kamera-Schwenks,
- künstliche Beleuchtung etc.
Die Frage ist, welche Auswirkungen diese Bedingungen auf die Wahrnehmung des Politikers durch die Rezipienten haben. Welche Frames werden nun überwiegend durch die beschriebenen formatspezifischen Eigenschaften produziert?
Durch die festgelegte Rolle als prominenter Interviewter wird man dem Politiker eine Experten-Rolle zubilligen, dessen Meinung zu politischen Problemen gefragt ist. Damit unterliegt der Gast natürlich einem gewissen Rechtfertigungszwang, durch den eher kritischen Befragungsstil wird er in eine verteidigende Haltung gedrängt. Im Allgemeinen muss nicht der Interviewer seine Aussagen begründen, sondern der befragte Politiker.
Des Weiteren wird der Interviewte als Amtsträger geframt, also z.B. als Chef seiner Partei oder als Bundeskanzler. Er beantwortet Fragen zu politischen Handlungen, Themen und Akteuren, nicht aber zu seinen Hobbys und seiner Familie (es sei denn, es geht um die Frage nach deren „Instrumentalisierung“ für den Wahlkampf).
3.1.3. Mischform: Talk-Interview
Wie bereits in Kapitel 2.1.3 beschrieben, folgen Fernsehformate keinen festgeschriebenen Gesetzesmäßigkeiten, sondern verändern sich mit dem Publikumsgeschmack und den allgemein vorherrschenden kulturellen Gegebenheiten. Holly (1994, S.426-427) bezeichnet etwa deutsche Fernsehinterviews als neutraler im Vergleich zu amerikanischen Interviews. Somit verändern sich die einzelnen Formate, wobei neue „Mischformen“ entstehen können. Dies zeigt sich bei der für die empirische Studie verwendeten Sendung „Maischberger extra“: hier finden sich charakteristische Elemente der beiden politischen Formate „Talkshow“ und „Interview“. Während die wochentäglich bei ntv ausgestrahlte Sendung „Maischberger“ größtenteils Interview-Charakter aufweist, können viele Eigenheiten bei der Sondersendung als Talk-spezifisch beschrieben werden.
[...]
[1] Für Überblicke zur Personalisierungsdebatte allgemein vgl. Brettschneider 2002, S.20ff., Kindelmann 1994, S.26ff, Lass 1995, S.9ff. Zur Personalisierungsdebatte im Fernsehen vgl. Greger und Marcinkowski 2000.
[2] Vgl. auch Sarcinelli und Tenscher 1998, S.305, Schulz 1998, S.203, Hofmann 1996, S.59, Jarren und Bode 1996, S.112-113 oder Radunski 1996, S.40ff.
[3] Es handelt sich um eine Inhaltsanalyse von Fernseh-Nachrichtensendungen aus den Jahren 1977 und 1998.
[4] In diesem Zusammenhang wird auch häufig argumentiert, dass Politiker sich schon immer symbolischer Gesten bedient haben und Politik deshalb von jeher einen personenbezogenen Charakter für die Öffentlichkeit aufwies. Meyer, Ontrup und Schicha (2000, S.95) erwähnen „historisch bekannte Staatsmanngesten, die von Politikern, z.B. de Gaulle und Adenauer, Kohl und Mitterand oder Brandt […] in Szene gesetzt wurden“.
[5] Vgl. auch Dahlem 2001, S.83, der die Frage offen lässt, ob die Parteiidentifikation der Beurteilung politischer Kandidaten und Probleme vorgelagert oder ob sie selbst ein Produkt der aktuellen Politik ist.
[6] Vgl. Kapitel 3.2.
[7] Vgl. auch Sarcinelli und Tenscher 1998, S.313.
[8] Allerdings sieht Dahlem (2001) diese Sichtweise für die Bundesrepublik wieder dadurch relativiert, dass mit den Kanzlerkandidaten der großen Volksparteien zwei politische Persönlichkeiten gegeneinander antreten, bei denen der Wähler davon ausgehen kann, dass sie bei einem Sieg ihrer Partei auch in das Amt des Bundeskanzlers gewählt werden (vgl. Dahlem 2001, S.165).
[9] Vgl. auch Sarcinelli und Tenscher 1998, S.306 sowie Jarren und Bode 1996, S.65.
[10] Radunski beschreibt Amerikanisierung u.a. damit, dass der Kandidat wichtiger sei als die Partei, dass die Wahlkampfführung von professionellen Spezialisten gesteuert werde und dass der Wahlkampf elektronisch geführt werde, also v.a. mittels des Fernsehens. (vgl. Radunski 1996, S.34-35)
[11] Vgl. Jarren und Donges (2002, S.203) zu system- und handlungstheoretischen Zugängen zum politischen Journalismus.
[12] Zu dieser Annahme findet sich ein passendes Zitat von David Halberstamm über John F. Kennedys Einstellung zu News-Shows: „Kennedy hielt das, was er da sah, für schrecklich wichtig. Vielleicht war das nicht die Realität. Möglicherweise war es noch nicht einmal guter Journalismus. Aber es war das, was das ganze Land für die Wirklichkeit hielt“ (Weischenberg 1997, S.19).
[13] Während etwa in einem Spielfilm „Marke westliches Format“ (typischer Vertreter: Hollywood-Produktionen) das Hauptaugenmerk auf eine nach bestimmten Mustern ablaufende Handlung gelegt wird, erwartet man von einem Spielfilm „Marke asiatisches Format“ (z.B. „Bollywood-Produktionen“ aus Indien), dass die Musik- und Tanzszenen einen Hauptteil des Films ausmachen.
[14] Für eine umfassende Darstellung bisheriger Studien vgl. Rhee 1997, S.26.
[15] Der Begriff Interpreter ist hier in „der doppelten Bedeutung des Wortes, nämlich als Deuter und als Darsteller“ (Vowe 1997, S.433) zu verstehen.
[16] Sowohl Framing-Ansätze als auch Beschreibungen des Format-Begriffs verweisen auf die Bedeutung ihrer Einbettung in der Kultur einer Gesellschaft (für Framing und Kultur vgl. Jarren und Donges 2002, S.70).
[17] Vgl. Kapitel 2.3!
[18] Eine Information wird in ihre Bestandteile zerlegt und alle verfügbaren Schemata für diese einzelnen Teile werden bei der Interpretation berücksichtigt.
[19] Das zuerst erfolgte „straight matching“ wird als unzureichend erkannt und daraufhin durch zusätzliche Schemata ersetzt oder ergänzt.
[20] Dies gilt ganz besonders für die Rezeption von Fernsehformaten, die ja stark standardisierte Elemente aufweisen (vgl. Kapitel 2.1.3).
Details
- Titel
- Wirkung unterschiedlicher Fernsehformate auf den Rezipienten bei der Darstellung von Politikern im Wahlkampf
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 136
- Katalognummer
- V222814
- ISBN (eBook)
- 9783832475338
- ISBN (Buch)
- 9783838675336
- Dateigröße
- 1021 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- medienwirkung schema-theorie framing-theorie politik medienanalyse
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2003, Wirkung unterschiedlicher Fernsehformate auf den Rezipienten bei der Darstellung von Politikern im Wahlkampf, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/222814

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.