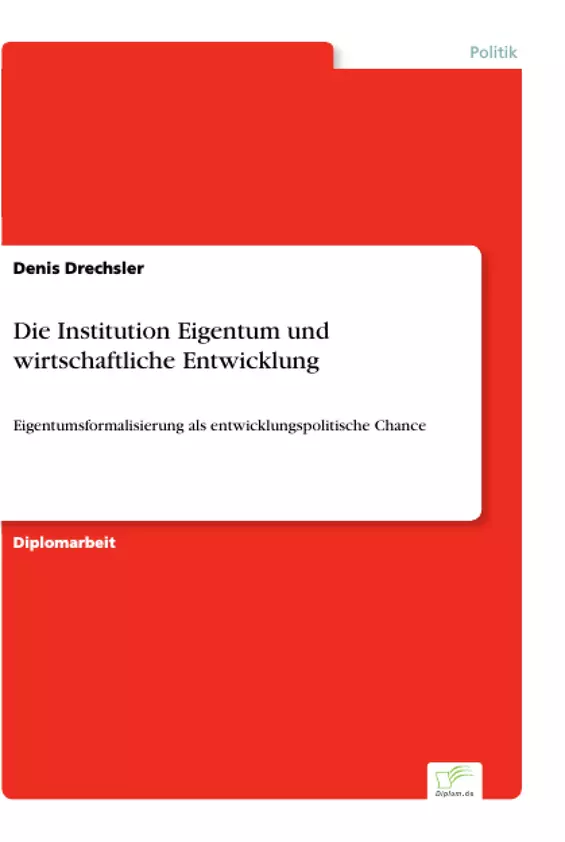Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos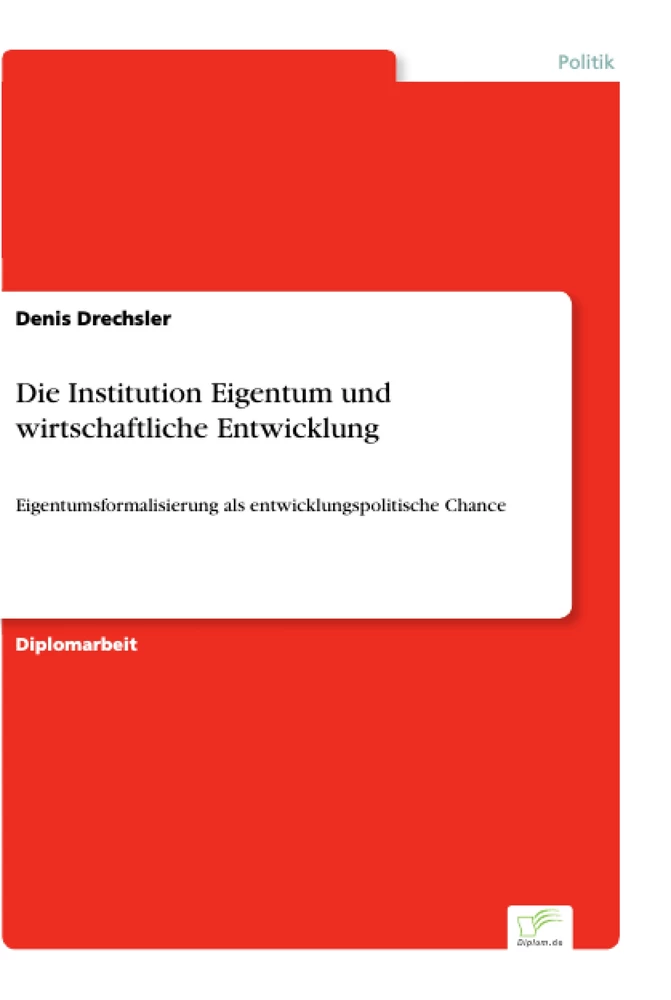
Die Institution Eigentum und wirtschaftliche Entwicklung
Diplomarbeit, 2003, 107 Seiten
Politik - Internationale Politik - Thema: Entwicklungspolitik
Autor

Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Universität Potsdam (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät)
Note
1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Danksagung
1. Einleitung
2. Entwicklungspolitik und institutionelle Reform
2.1 Grundzüge der klassischen Entwicklungspolitik
2.2 Was ist Entwicklung?
2.3 Ansätze einer neuen Entwicklungspolitik
2.4 Zusammenfassung
3. Institutionen und ihre Bedeutung in der Gesellschaft
3.1 Mängel der neoklassischen Wirtschaftstheorie
3.1.1 Präferenzbildung unter eingeschränkter Rationalität
3.1.2 Institutionen und ihr Einfluss auf Informationskosten
3.2 Wie wirken Institutionen – eine konzeptionelle Betrachtung
3.2.1 Grundzüge der Institutionenökonomik
3.2.2 Institutionenökonomik und der Aufbau von Märkten
3.2.3 Einfluss der Kultur auf Entwicklungspfade
3.2.4 Institutionenökonomik und Transaktionskosten
3.3 Zusammenfassung
4. Die Institution Eigentum
4.1. Die Institution Eigentum im historischen Wandel
4.1.1 Eigentum als Naturrecht
4.1.2 Kritische Positionen zu einem unbeschränkten Zugang zu Eigentum
4.1.3 Eigentum in der Industriellen Revolution – Anspruch und Wirklichkeit
4.1.4 Machtinstitutionen und die Schaffung und
Erhaltung von Eigentumsrechten
4.1.5 Grenzen des liberalen Eigentumsbegriffes – die soziale Dimension
4.2. Eine ökonomische Theorie des Eigentums
4.2.1 Eigentumsrechte und individuelle Rationalität
4.2.2 Transaktionskosten senkender Effekt von Eigentumsrechten
4.3 Zusammenfassung
5. Eigentum und Entwicklungspolitik
5.1 Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Eigentumsformalisierung
5.1.1 Die besondere Bedeutung des Grundeigentums für die
internationale Entwicklungspolitik
5.1.2 Einfluss gesicherter Grundeigentumsrechte auf die
wirtschaftliche Entwicklung
5.1.3 Legitimationsbasis für gesicherte Eigentumsrechte
5.1.4 Die Rolle des Staates bei der Schaffung und Sicherung von Eigentumsrechten
5.1.5 Reformen im Eigentumssicherungssystem
5.1.6 Zusammenfassung – Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Entwicklungspolitik im Bereich der Eigentumsformalisierung
5.2 Kernelemente eines effizienten Eigentumssicherungssystems
5.2.1 Organisatorische Ebene gesicherter Eigentumsrechte
5.2.2 Gesetzliche Ebene gesicherter Eigentumsrechte
5.2.3 Zusammenfassung – Elemente gesicherter Eigentumsrechte an Grund und Boden
5.3 Erkenntnisse aus bisherigen Reformvorhaben in Entwicklungsländern
5.3.1 Eingeschränkter entwicklungspolitischer Blickwinkel
5.3.2 Mehrebenen-Ansatz der Eigentumsformalisierung
6. Eigentumsformalisierung in Peru
6.1 Die Studie des Instituto Libertad y Democracia und das Pilotprojekt
6.2 Die Schaffung einer eigenständigen Formalisierungsbehörde
6.3 Das Peru Urban Property Rights Project
6.4 Erfolge und Misserfolge der Eigentumsformalisierung in Peru
6.4.1 Umfang der Reformen
6.4.2 Konsolidierungsmaßnahmen
6.4.3 Arbeitsangebot
6.4.4 Krediteffekt
6.5 Bewertung des PUPRP
6.5.1 Formalisierungsansatz
6.5.2 Aspekt der kritischen Masse
6.5.3 Bottom-up und Pro-aktiv Ansatz
6.5.4 Kostenfaktor
6.5.5 Reformwille
6.6 Replizierbarkeit des peruanischen Reformprojekts
7. Schlussbemerkungen
Literatur
Anhang
Eidesstattliche Erklärung
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Wesentliche Kritikpunkte an der neoklassischen Wirtschaftstheorie
Abb. 2: Lohnniveau und Wertschöpfung in ausgewählten Ländern
Abb. 3: Produktionspotenzial durch gesteigerten Kapitaleinsatz
Abb. 4: Teufelskreis in der Kapitalmangeltheorie
Abb. 5: Effekte der Eigentumsformalisierung auf das Arbeitsangebot
Abb. 6: Wirtschaftswachstum und Investitionsquote
Abb. 7: Elemente eines effizienten Eigentumssicherungssystems
Abb. 8: Elemente und Reihenfolge notwendiger Reformschritte einer Eigentumsformalisierung
Abb. 9: Effizienz des Eigentumssicherungssystems und reales Pro-Kopf-Einkommen
Abb. 10: Eigentumssicherung im internationalen Vergleich
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: COFOPRI Land Titling und RPU Registrierung
Tab. 2: Lohnniveau und Wertschöpfung im produzierenden Gewerbe
Tab. 3: Pro-Kopf-Einkommen und Investitionsquote
Tab. 4: Weltbankprojekte im Eigentumsbereich
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Danksagung
Viele Köche verderben angeblich den Brei – eine umfangreiche akademische Studie hingegen kann von der Hilfe Anderer profitieren. Besonderer Dank gilt meinen Betreuern an der Universität Potsdam, Herrn Prof. Dr. Harald Fuhr sowie Herrn Prof. Dr. Paul J.J. Welfens, deren Ratschläge wichtige Anregungen für die Gestaltung meiner Diplomarbeit bedeuteten. Förderliche Hinweise – insbesondere für den Bereich der Institutionenökonomik – erhielt ich darüber hinaus von Herrn Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann (Universität Potsdam) sowie Mitarbeitern des Zentrums für Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) an der Universität in Maryland. Meine Untersuchung des peruanischen Formalisierungsprojekts hätte ohne die finanzielle Unterstützung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) in ihrer vorliegenden Form nicht realisiert werden können. Während des vom DAAD geförderten Aufenthalts in Washington bereicherte mich das Fachwissen der früheren Betreuerin des Peru Urban Property Rights Project, Frau Elena Panaritis, sowie weiterer Mitarbeiter der Weltbank, die im Bereich der Landformalisierung tätig sind. Dankbar bin ich ebenfalls für die Bereitstellung eines Büros während meiner Zeit in Washington durch das American Institute for Contemporary German Studies (AICGS) – insbesondere gebührt mein Dank hier dem persönlichem Engagement ihres Präsidenten, Herrn Jackson Janes.
Potsdam/Washington, im Januar 2003
1. Einleitung
Eigentum ist ein Grundpfeiler einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung. Es gewährleistet den in ihr handelnden Akteuren die Kontrolle und die Sicherheit über ihr Hab und Gut und fördert so die Bereitschaft zur wirtschaftlichen Leistungserbringung. Dies ist sicherlich keine neue und überraschende Erkenntnis. Schon liberale Philosophen wie John Locke und David Hume oder klassische Nationalökonomen wie Adam Smith und David Ricardo betonten die herausragende Rolle des Eigentums bei der Entwicklung von marktwirtschaftlichen Systemen. Auch basieren wirtschaftswissenschaftliche Theorien wie das vorherrschende neoklassische Ideal einer vollständigen Konkurrenz auf der Existenz von Eigentum und setzen wohldefinierte Eigentums- und Verfügungsrechte implizit als gegeben voraus.[1] Eigentum bildet sowohl Anreiz als auch Ziel ökonomischen Verhaltens und ist damit essentielle Grundlage wirtschaftlicher Aktivität.
Vergleichsweise neu ist hingegen der Hinweis, dass Eigentum seine entwicklungsförderliche Wirkung nur entfalten kann, falls es eingebettet ist in einen institutionellen Rahmen, der die Entstehung marktwirtschaftlicher Strukturen ermöglicht und unterstützt (vgl. insbesondere NORTH/THOMAS, 1973; NORTH, 1990). Dieser institutionelle Rahmen ist äußerst vielschichtig und darf nicht – wie vielfach angenommen – auf eine rein organisatorische Ebene reduziert werden. Die Institution Eigentum beschreibt ein geistiges Konzept, durch das ein Rechtsverhältnis zwischen Mensch und Sache konstruiert wird. Im modernen Rechtsstaat umfasst der institutionelle Rahmen von Eigentum daher neben einer allgemeinen Bestandssicherung des Eigentums ein wirksames Rechtssystem sowie eine funktionierende Gesetzgebung, um die Institution Eigentum zu schaffen sowie durch Rechtsgarantien und Sanktionsmechanismen abzusichern.
In jüngster Zeit wird die Bedeutung institutioneller Regelungsmechanismen insbesondere als Grundlage nachhaltiger Entwicklung hervorgehoben. Reformen des Eigentumssicherungssystems bilden bei dem Versuch, Entwicklungsprozesse über den Aufbau funktionierender institutioneller Strukturen einzuleiten, einen wichtigen, wenngleich noch recht jungen Ansatzpunkt der internationalen Entwicklungszusammenarbeit.[2] Im Bereich der Landpolitik erweitert sich hierdurch der herkömmliche entwicklungspolitische Ansatz einer oftmals rein distributiven Bodenreform um den Aspekt gesicherter Grundeigentumsrechte. Für den Großteil der Menschen in Entwicklungsländern[3] bilden Landressourcen neben der eignen Arbeitskraft das wichtigste – da häufig einzige – Aktiva, das ihnen im Wirtschaftsprozess zur Verfügung steht. Die Einführung eines funktionierenden Grundeigentumssystems wirkt sich daher potenziell auf breite Bevölkerungsschichten aus.
Allgemein lässt sich die wirtschaftliche Bedeutung von gesicherten Eigentumsrechten wie folgt zusammenfassen: (i) schaffen sie einen Anreiz für wirtschaftliches Verhalten und senken (ii) die Transaktionskosten von wirtschaftlichen Austauschprozessen; zugleich führen sie (iii) zu einer erhöhten (Planungs-) Sicherheit des Gütereigentümers, die (iv) eine bessere Verwendung bestehender Ressourcen erlaubt. Der (v) vereinfachte bzw. vielfach dann erst mögliche Zugang zu formalen Kreditmärkten durch die Verwendung der Eigentumsgüter als Sicherheit für aufgenommene Gelder bildet einen weiteren Bereich, in dem die Sicherung von Eigentumsrechten wirtschaftliche Vorteile generiert.
In vielen Entwicklungs- und Schwellenländern besteht jedoch ein nur rudimentär ausgebildetes, durch staatliche Institutionen kaum bzw. gar nicht gestütztes Eigentumssystem. Aufgrund der unzureichenden formalen Absicherung von Eigentum finden in diesen Wirtschaftsräumen häufig informelle Eigentumskontrakte Anwendung über die durch den offiziellen Markt nicht anerkannten oder mangelhaft beurkundeten Güter – ein Phänomen, das als Informalität bezeichnet wird. Bezogen auf den im Rahmen der Diplomarbeit untersuchten Fall des Grundeigentums sind z.B. 80 % der Landbesitzer in Indonesien in keiner Behörde registriert und etwa 70 % des ländlichen Raumes in Guatemala formal nicht erfasst (Daten aus ORTIZ, 1999, S. 4). Das wirtschaftliche Potenzial bestehender Landressourcen wird angesichts dieser institutionellen Missstände nur unvollständig ausgeschöpft; eine Überführung informeller Bodenrechtssysteme in ein formales System – eine so genannte Grundeigentumsformalisierung – könnte folglich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dieser Volkswirtschaften erheblich steigern.
Allerdings reicht es in Entwicklungsländern häufig nicht aus, lediglich bestehende Strukturen der Eigentumssicherung zu modernisieren. Vielmehr sind weitreichende Reformen vonnöten, die sowohl technische Aspekte beinhalten wie die Vermessung von Bodenflächen und die Einführung eines Katastersystems, als auch rechtliche Änderungen umfassen, um über entsprechende gesetzliche Regelungen eine grundlegende Erneuerung des Systems zu ermöglichen. Die ausreichende Teilnahme der Bevölkerung am formalen System bildet eine weitere zentrale Voraussetzung, die bei der Reformierung eines Eigentumssicherungssystems beachtet werden muss. Wie Erfahrungen aus Formalisierungsprojekten zeigen, bleiben die Reformen sonst häufig wirkungslos und führen zu keiner nachhaltigen Veränderung (vgl. z.B. DEININGER et al., 2001, S. 27). Gleiches droht einzutreten, falls die Projekte ohne die Unterstützung der politischen und administrativen Elite eines Landes durchgeführt werden. Institutionelle Veränderungen bedürfen der Reformbereitschaft des öffentlichen Sektors; damit sehen sie sich zwangsläufig konfrontiert mit systeminhärenten Widerständen, die z.B. von der Public Choice Theorie in einem opportunistischen rent seeking – und den Reformprozess häufig bremsenden – Verhalten von öffentlich Bediensteten verortet wird (vgl. MUELLER, 1997, S. 229ff.).
Eigentumsrechtliche Reformen sind ein vielversprechender, allerdings auch schwieriger und komplexer Ansatz der internationalen Entwicklungspolitik. Die vorliegende Arbeit untersucht Probleme und mögliche Lösungsstrategien, die sich mit institutionellen Reformen im Allgemeinen sowie der Formalisierung von Grundeigentum im Speziellen verbinden. Insbesondere geht es dabei um die Frage, ob die internationale Entwicklungspolitik bei ihrer proklamierten Neuausrichtung auf institutionelle Reformen tatsächlich eine umfassende Neugestaltung sozioökonomischer Rahmenbedingungen erreicht, um auf diese Weise Entwicklungsprozesse in der Dritten Welt ermöglichen und fördern zu können.
Ausgehend von einem Überblick über die internationale Entwicklungspolitik im Verlauf der vergangenen zwanzig Jahre (Kapitel 2) wird die Bedeutung von Institutionen für ökonomische Verhaltensentscheidungen sozialer Akteuren untersucht (Kapitel 3). Auffällig hierbei ist, dass Wirtschaftsakteure nicht – wie von der neoklassischen Theorie angenommen – im Rahmen vollkommener Information und frei von äußeren Einflüssen zu einer jeweils nutzenmaximierenden Verhaltensentscheidung gelangen; vielmehr wird ihr Handeln maßgeblich bestimmt durch institutionelle Faktoren, die ihre Wahloptionen einschränken oder ihr Verhalten sogar vollständig prädestinieren. Die Bedeutung institutioneller Reformmodelle für die internationale Entwicklungspolitik wird durch diesen Befund theoretisch untermauert.
Wesentlichen Einfluss auf präferenzgesteuerte Entscheidungsprozesse hat die Institution des Eigentums, die in einem anschließenden Abschnitt näher untersucht wird (Kapitel 4). Wohldefinierte Eigentumsrechte können einen Wirtschaftsprozess wie die im neoklassischen Ideal beschriebene vollkommene Konkurrenz in Ansätzen erst ermöglichen: Sie senken die Transaktionskosten für wirtschaftliche Austauschprozesse und erhöhen den verfügbaren Informationsbestand, so dass eine nutzenmaximale – in neoklassischer Sicht rationale – Verhaltensentscheidung vereinfacht wird. Aufgrund der ökonomischen Relevanz von Landressourcen in den Ländern der Dritten Welt kommt der Sicherung von Grundeigentumsrechten eine wichtige entwicklungspolitische Bedeutung zu. Wie eine Untersuchung über mögliche Ansatzpunkte im Bereich der Eigentumssicherung unterstreicht (Kapitel 5), verspricht insbesondere die Formalisierung bereits bestehender Besitzverhältnisse, Entwicklungsimpulse zu erzeugen.
Ein durch die Weltbank gefördertes Formalisierungsprogramm in Peru dient in einem anschließenden Abschnitt dazu, die Wirkung einer formalen Anerkennung von Grundeigentumsrechten am praktischen Fallbeispiel zu untersuchen (Kapitel 6). Neben den soziökonomischen Effekten einer formal-rechtlichen Eigentumssicherung soll anhand dieses Projekts ebenfalls erläutert werden, welche Schlussfolgerungen sich hieraus für die internationale Entwicklungspolitik ergeben. Erste Untersuchungen deuten hin auf einen Erfolg des peruanischen Formalisierungsprojekts, wenngleich nicht alle der zuvor angestrebten Ziele erreicht werden konnten. Kapitel 7 fasst die Ergebnisse zusammen.
2. Entwicklungspolitik und institutionelle Reform
Bei der Untersuchung entwicklungspolitischer Maßnahmen im Eigentumsbereich ist es unerlässlich, ihre Stellung in den Gesamtkontext der Entwicklungspolitik einzuordnen. Die folgende Darstellung gibt hierzu einen Überblick über wichtige Charakteristika der internationalen Entwicklungspolitik während der vergangenen zwanzig Jahre. Insbesondere stellt sie dabei einen Richtungswechsel heraus, der die internationale Entwicklungspolitik in jüngster Zeit verstärkt auf die Durchführung von so genannten institutionellen Reformen und den Aufbau eines effizienten institutionellen Systems lenkte.
Institutionelle Reformen beschreiben den Versuch, die Rahmenbedingungen, auf deren Grundlage Akteure Verhaltensentscheidungen treffen, grundlegend und einschneidend zu verändern. Der Begriff Institution muss hierbei deutlich von seiner allgemein gebräuchlichen Gleichsetzung mit Organisationen abgegrenzt und ausgeweitet werden. Das institutionelle System einer Gesellschaft umfasst neben tatsächlichen Organisationen, die im Idealfall die institutionelle Ordnung widerspiegeln und stärken, ebenfalls die Werte und Verhaltensnormen der Gesellschaftsmitglieder.[4] Insofern sind institutionelle Reformen ein umfassender und komplexer Ansatz „to change … the entire set of economic, legal, and social incentive structures governing human … behavior“ (RAISER, 1997, S. 2).
Eigentumsrechtliche Reformen passen sich in diese entwicklungspolitische Tendenz nahtlos ein. Die Formalisierung von Eigentum beschreibt die Überführung von de facto Eigentumsrechten, denen eine Anerkennung und Absicherung durch staatliche Institutionen fehlt, in die formalen Strukturen einer Gesellschaft. In Entwicklungsländern muss allerdings ein adäquater formal-rechtlicher Rahmen oftmals erst geschaffen werden, um eine effiziente und vor allem nachhaltig wirksame Eigentumssicherung zu ermöglichen. Entwicklungspolitische Maßnahmen, die diesen Formalisierungsprozess unterstützen, sind daher zweifelsohne ein wichtiger Beitrag des institution building, das im Zentrum der neueren entwicklungspolitischen Diskussion steht und insbesondere die Politik der Weltbank beeinflusst (vgl. WELTBANK, 2002, S. 3ff.).
2.1 Grundzüge der klassischen Entwicklungspolitik
Internationale Entwicklungshilfe wurde lange Zeit verstanden als der Versuch, den Ländern der Dritten Welt durch externe Impulse in Form von Geld, Know-how und Personal eine wirtschaftliche Entwicklung nach Vorbild der westlichen Industrieländer zu ermöglichen (vgl. MESSNER/NUSCHELER, 2001, S. 403). Diese Grundgedanken der klassischen Entwicklungshilfe haben mittlerweile in der entwicklungspolitischen Diskussion an Bedeutung verloren. In ihnen spiegelt sich der vormals enge Blickwinkel der Entwicklungshilfe auf rein wirtschaftliche Aspekte der angestrebten Entwicklung wider, der andere Dimensionen wie politische, soziale und kulturelle Ebenen lange Zeit vernachlässigte (vgl. ANDERSEN, 1998, S. 75). Zum anderen verdeutlichen sie die Ansicht, Entwicklung in erster Linie als einen Prozess einzustufen, der von Außen gesteuert und angeregt werden kann – eine spezifische Förderung der in den jeweiligen Ländern bestehenden eigenen Potenziale rückte demgegenüber in den Hintergrund der entwicklungspolitischen Bemühungen.[5]
Für die Überzeugung, den wirtschaftlichen Aufholprozess der Entwicklungsländer am besten über makroökonomische Reformen und eine gezielte Ausrichtung auf Wachstumssteigerungen fördern zu können, steht der Begriff des Washingtoner Konsensus[6] (WILLIAMSON, 1990). Er ist Symbol für das als bedingungslos wahrgenommene Vertrauen der Bretton-Woods-Organisationen in die heilsamen Kräfte des Marktes, das deren entwicklungspolitische Maßnahmen insbesondere in den 1980er und 1990er Jahre bestimmte.[7] Höhepunkt dieser neoliberal geprägten Entwicklungspolitik waren insbesondere die von der Weltbank und dem Internationalem Währungsfonds (IWF) durchgeführten Strukturanpassungsmaßnahmen, die einer minimalstaatlichen Ideologie folgten: Über den Abbau von Staatsfunktionen, Deregulierung und Liberalisierung wurde im Rahmen des Washingtoner Konsensus versucht, die Integration der Entwicklungsländer in den Weltmarkt voranzutreiben (vgl. MESSNER/NUSCHELER, 2001, S. 408f.).
Dieser Ansatz wird mittlerweile als gescheitert angesehen, was sich für RODRIK (1999, S. 2) insbesondere an folgenden drei Beispielen dokumentiert: (i) am fehlgeschlagenen Versuch, in Russland durch Preisreformen und Privatisierungsmaßnahmen marktwirtschaftliches Verhalten zu fördern; (ii) an unbefriedigenden Ergebnissen der marktorientierten Reformen in Lateinamerika; sowie (iii) an der Finanzkrise in Asien, die eindringlich aufzeigte, dass die Liberalisierung der Finanzmärkte ohne angemessene Regulierungen in einer Katastrophe enden kann.
2.2 Was ist Entwicklung?
Ähnlich kontrovers wie die Debatte um die richtige entwicklungspolitische Strategie wird die Frage nach der Bedeutung des Begriffes Entwicklung selbst diskutiert. Auch wenn die Gleichung Wachstum = Entwicklung ernsthaft nur in den Anfangsjahren der internationalen Entwicklungspolitik vertreten wurde, erfolgt die Kategorisierung eines Staates in Industrie-, Schwellen- oder Entwicklungsland noch immer maßgeblich auf der Grundlage ökonomischer Faktoren (vgl. NOHLEN, 1998, S. 216). Es liegt daher nahe, den Entwicklungsgrad eines Landes anhand wirtschaftlicher Indikatoren zu messen bzw. den Erfolg von Entwicklungspolitik an makroökonomischen Größen wie dem Bruttoinlandsprodukt oder der Steigerungsrate des Wirtschaftswachstums festzumachen. Entwicklungspolitik zielt in einer solch engen Sicht auf die Einleitung eines Aufholprozesses, den die Entwicklungsländer beschreiten müssen, um ihre vermeintlichen Defizite zu den Industrieländern auszugleichen. Zu diesen werden in erster Linie mangelnde wirtschaftliche Effizienz, zu geringe Produktivität und fehlende Wettbewerbsfähigkeit gezählt (vgl. ANDERSEN, 1996, S. 6).
Erst im Rahmen verstärkter Kritik an der Entwicklungspolitik insbesondere im System der Vereinten Nationen sowie angesichts der ernüchternden Feststellung, nach 40 Jahren bei der Bekämpfung von Armut keinen nennenswert großen Schritt vorangekommen zu sein, gewannen alternative Entwicklungskonzepte an Befürwortern bei der Weltbank und dem IWF. Diese betonten jedoch keine vollkommen neuen Aspekte: MESSNER/NUSCHELER (2001, S. 412) stellen fest, dass die einsetzende Neuorientierung an Konzepte anknüpfte, die andere Entwicklungshilfeeinrichtungen und Nichtregierungsorganisationen schon in den 1980er und 1990er Jahren vertreten hatten.
Neben der angemahnten Zielverfehlung wurde zunehmend auch die Zieldefinition bemängelt und infolgedessen eine Ausweitung des Begriffes der Entwicklung verlangt (vgl. KLEMP, 2001, S. 14). Bereits 1977 stellte die von Willy Brandt geführte Kommission für internationale Entwicklungsfragen fest, dass unter Entwicklung „mehr als der Übergang von Arm zu Reich“ zu verstehen sei und neben der „Idee des materiellen Wohlstands ... [auch] menschlich[e] Würde, mehr Sicherheit, Gerechtigkeit und Gleichheit“ betrachtet werden müssten (BRANDT, 1977). Ein derartiges Verständnis von Entwicklung als breiter und alle Ebenen des menschlichen Lebens umfassender Prozess gelangte indes erst wesentlich später ins Bewusstsein der von der Weltbank und dem IWF verantworteten Politik (vgl. KLEMP, 2001, S. 14). Es spiegelt sich heute wider in dem seit Anfang der 1990er Jahre gebräuchlichen Human Development Index, der eine breite Indikatorenbasis zur Messung des Entwicklungsstandes heranzieht (zu Entwicklungskonzepten vgl. NOHLEN/NUSCHELER, 1992, S. 55ff.).
2.3 Ansätze einer neuen Entwicklungspolitik
Mittlerweile wird die Entwicklungspolitik bestimmt von einer stärkeren Ausrichtung auf institutionelle Reformen, der Unterstützung einer gemeinsamen Entwicklung von Politik und Wirtschaft sowie dem Ziel einer direkten Armutsbekämpfung. Entscheidend für diese „programmatisch[e] Kehrtwende“ (KLEMP, 2001, S. 16) ist die Auffassung, dass eine umfangreiche und nachhaltige Entwicklung nicht ausschließlich durch den Markt erreicht werden kann.[8] Bildete der Abbau von Markthindernissen ein wesentliches Ziel der Politik des Washingtoner Konsensus, konzentriert sich die internationale Entwicklungspolitik jetzt auf die Stärkung von privaten sowie insbesondere staatlichen institutionellen Strukturen (vgl. MESSNER, 2000, S. 10). Wie RITZEN et al. (2000, S. 2) darstellen, umfasst die aktuelle Entwicklungsstrategie hierbei die Förderung eines stabilen und offenen marktwirtschaftlichen Systems, den Aufbau effizienter staatlicher Einrichtungen sowie die Verbesserung der öffentlichen Leistungserbringung in den Bereichen Ausbildung, Gesundheit und soziale Sicherung.
Rolle des Staates
Zunehmend besteht Einigkeit darüber, dass nur ein breiter und mehrere Ebenen umfassender entwicklungspolitischer Ansatz Aussicht auf Erfolg hat, da Entwicklungspolitik „ohne wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Strukturveränderungen und ohne Verhaltensänderungen der Eliten ... wirkungslos bleiben muss“ (MESSNER, 2000, S. 2). Als entscheidendes Element des institutionellen Systems einer Gesellschaft kommt dabei dem öffentlichen Sektor im Entwicklungsprozess eine entscheidende Rolle zu; so empfiehlt z.B. die Weltbank eine Refokussierung auf den Staat als strategische Handlungsoption (vgl. WELTBANK, 1997, S. 38). Darüber hinaus wird seit Anfang der 1990er Jahre unter dem Stichwort der good governance [9] verstärkt diskutiert, inwieweit eine Anhebung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung entwicklungspolitische Ziele unterstützt.
Ein zentrales Ziel der neueren Entwicklungspolitik ist die Erhöhung der Transparenz im öffentlichen Sektor sowie eine Stärkung der Rechte auf Informationszugang (vgl. FUHR, 1997, S. 248). Daneben konzentrieren sich entwicklungspolitische Maßnahmen auf die Herausbildung einer nationalen Identität, die den Staat als legitimen institutionellen Überbau anerkennt (vgl. ANDERSEN, 1996, S. 15). Nach MYRDAL (1972, S. 125ff.) sind Entwicklungsländer entgegen ihrer oftmals autoritären Strukturen zumeist „schwache Staaten“, die aufgrund mangelnder politischer Unterstützung nur über unzureichend Stabilität verfügen.[10] Für eine gleichmäßige und nachhaltig wirksame Entwicklung ist nach heute herrschender Meinung ein konsolidierter Staat jedoch unverzichtbar (vgl. FANZUN/LEHMANN, 2000, S. 260). Trotz oder gerade angesichts einer zunehmend globalisierten Welt besitzen staatliche Strukturen auch weiterhin eine große Bedeutung als ausgleichender Gegenpol für die wachsende internationale Interdependenz. Die Weltbank wertet daher die Globalisierung und die Regionalisierung als zwar konkurrierende, einander jedoch ebenfalls ergänzende Erscheinungen (vgl. WELTBANK, 2000, S. 31).
Ausdruck des entwicklungspolitischen Umdenkens ist die angewachsene Bedeutung eines Public Sector Management (vgl. FUHR, 1997, S. 241). Für die Politik der Weltbank lässt sich eine Abkehr von minimalstaatlichen Konzepten zudem an den jüngsten Weltentwicklungsberichten dokumentieren, deren Titel die Wichtigkeit des Staates sowie die Notwendigkeit für institutionelle Reformen in Entwicklungsländern herausstellen.[11] Die entwicklungspolitische Bedeutung institutioneller Strukturen wird damit nachdrücklich unterstrichen (vgl. MESSENER/NUSCHELER, 2001, S. 411).
Institutionelle Entwicklungspolitik und der Markt
Eine institutionelle Entwicklungsstrategie bestreitet nicht, dass der Aufbau funktionsfähiger Märkte entwicklungspolitische Ziele unterstützt. Entwicklung ist zwar nicht nur, aber doch in entscheidender Weise ein wirtschaftliches Phänomen (vgl. ANDERSEN, 1996, S. 7). Allerdings fügt sie der klassischen Entwicklungspolitik eine weitere Ebene hinzu und betrachtet sowohl die positiven Auswirkungen einer funktionierenden Marktwirtschaft als auch die Strukturen, die für ein Funktionieren des Marktes unerlässlich sind; neben öffentlichen Gütern wie dem inneren und äußeren Frieden, einem stabilen Geldwesen und Infrastruktureinrichtungen sind dies insbesondere Rechtssicherheit und der Schutz des Eigentums. Erfahrungen aus Ländern ohne vergleichbare staatliche Strukturen haben gezeigt, dass Entwicklungshilfe sonst kaum positive oder sogar kontraproduktive Auswirkungen haben kann. Eingesetzte Mittel versickern buchstäblich im Sand oder aber den Taschen einiger weniger Nutznießer (vgl. MENZEL, 2001, S. 4).
Ebenfalls wird im Rahmen einer institutionellen Entwicklungspolitik nicht die im Grunde neoliberale Überzeugung angezweifelt, dass Entwicklung nur über eine Integration der Entwicklungsländer in den Weltmarkt erreicht werden kann. Insbesondere im Hinblick auf den Globalisierungsprozess wird die Integration der Entwicklungsländer als nahezu unbestrittene Notwendigkeit angesehen (vgl. FANZUN/LEHMANN, 2000, S. 261). Im Unterschied zur neoliberalen Politik des Washingtoner Konsensus rücken jedoch Aspekte wie Tragfähigkeit, Nachhaltigkeit und eigenverantwortliche Steuerung der entwicklungspolitischen Reformen in den Mittelpunkt der Betrachtung.
Rule of Law[12]
Bei der Diskussion um den positiven Einfluss von Institutionen steht im Wesentlichen der Aufbau eines effizienten formal-rechtlichen Rahmens im Vordergrund. Befürworter eines rule of law Ansatzes vertreten die Ansicht, dass erst formale Gesetze und das Vorhandensein eines Rechtswegs die erforderliche Sicherheit und Stabilität eines institutionellen Systems garantieren, um nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.
Gerade im Bereich der Eigentumsformalisierung hat der rule of law Ansatz die entwicklungspolitische Diskussion maßgeblich beeinflusst. Der Aufbau formal-rechtlicher Strukturen zur effizienten Eigentumssicherung wird in der aktuellen entwicklungspolitischen Debatte zunehmend als notwendig erachtet. Neben Hernando DE SOTO (1989), einem Pionier der Diskussion um die entwicklungspolitische Bedeutung gesicherter Eigentumsrechte, befindet auch WILLIAMSON (2001, S. 301), dass die Integration von informellen Übereinkünften in die Strukturen des formalen Marktes eine zentrale Aufgabe der aktuellen Entwicklungspolitik sei.
Grundeigentum und institutionelle Entwicklungspolitik
Ähnlich der Diskussion um die Bedeutung von Institutionen gelangten Eigentumsfragen erst seit Anfang der 1990er Jahre verstärkt in die entwicklungspolitische Diskussion (vgl. FUHR, 1997, S. 245). Mit dem Ende des Kalten Krieges und den damit verbundenen wirtschaftlichen und strukturellen Veränderungen in Mittel- und Osteuropa gewann die Suche nach effizienten marktwirtschaftlichen Strukturen nachdrücklich an Gewicht in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit (vgl. WILLIAMSON, 2001, S. 301). Für den traditionellen entwicklungspolitischen Ansatz am Grundeigentum, der vornehmlich über verteilungspolitische Bodenreformen Entwicklungsprozesse einzuleiten versuchte, bedeutete dies eine Erweiterung um den Aspekt der institutionellen Eigentumssicherung.[13]
Die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) erkennt in der Reformierung von Grundeigentum sogar einen Kernbereich der gegenwärtigen Entwicklungszusammenarbeit. Nach ihren Worten werde die Bodenfrage momentan neu diskutiert und dahingehend beurteilt, dass gesichertem Grundeigentum eine entscheidende Bedeutung für den Entwicklungsprozess zukomme (vgl. GTZ, 1997, o.S.). Im Sinne eines rule of law Ansatzes ist hierbei die Verbindung einheimischen Bodenrechts mit formal-rechtlichen Sicherungsmechanismen eine der derzeit größten Herausforderungen für die internationale Entwicklungszusammenarbeit.
2.4 Zusammenfassung
Seit einigen Jahren ist in der internationalen Entwicklungspolitik ein Wandel feststellbar, der den Staat sowie das institutionelle Gefüge einer Gesellschaft verstärkt in das Zentrum der verfolgten Entwicklungsstrategie einbindet. Nach unbefriedigenden Ergebnissen der Strukturanpassungsmaßnahmen deutet die Neuorientierung in der internationalen Entwicklungspolitik darauf hin, dass neoliberale Reformvorhaben mit dem mittlerweile angestrebten Ziel nachhaltiger Entwicklung oftmals schwer zu vereinbaren sind (vgl. STEIN, 1995, S. 115). Ein entscheidender Mangel einer neoklassisch fundierten Entwicklungspolitik wurde darin erkannt, dass sie den Einfluss von Institutionen auf wirtschaftliche Austauschprozesse häufig unterschätzt. Dies ist keine neue Erkenntnis, sondern seit jeher ein wesentlicher Kritikpunkt an der neoklassischen Wirtschaftstheorie. Gerade im Bereich der Entwicklungspolitik treten diese Mängel jedoch verstärkt hervor, da in Entwicklungsländern Strukturen, die einen reibungslosen Marktaustausch erst ermöglichen, oftmals kaum oder nur unzureichend ausgebildet sind. Die im Rahmen des Washingtoner Konsensus verfolgte Politik makroökonomischer Stabilisierung (monetär, fiskalisch und budgetär) und Liberalisierung (Handel, Wechselkurs, Privatisierung) konnte für einen nachhaltigen Entwicklungsprozess zwar wichtige, angesichts der vorhandenen institutionellen Defizite jedoch nicht ausreichend tiefgreifende Veränderungen bewirken. Unzulänglichkeiten bestehen in Entwicklungsländern u.a. in einem schwachen Schutz von Eigentumsrechten, der zu ineffizienten Marktprozessen führt und bestehende Ressourcen nur unbefriedigend ausschöpft (vgl. hierzu die Übersichten im Anhang). Allein auf die segensreiche Wirkung des freien Marktaustausches zu hoffen, wie dies die Entwicklungspolitik lange Zeit getan hat, erscheint unter diesen Umständen als ein zu kurz greifender Ansatz (vgl. RODRIK, 1999, S. 2).
3. Institutionen und ihre Bedeutung in der Gesellschaft
Um die Bedeutung von Institutionen für wirtschaftliche Austauschprozesse und mithin für die internationale Entwicklungspolitik zu verdeutlichen, untersucht der folgende Abschnitt den Einfluss institutioneller Regelungsmechanismen auf soziale Interaktionen. Ziel dieser Betrachtung ist, die oben dargestellte programmatische Kehrwende in der internationalen Entwicklungspolitik unter theoretischen Gesichtspunkten zu analysieren. In Anbetracht der großen Bedeutung, die der neoklassischen Wirtschaftstheorie für die internationale Entwicklungspolitik lange Zeit beigemessen wurde, beginnt der Abschnitt mit einer allgemeinen Kritik am neoklassischen Ansatz. Anschließend wird als wesentlicher Einfluss von Institutionen eine Unsicherheitseindämmung bzw. Kostenminimierung im Wirtschaftsprozess identifiziert. Da eine institutionelle Entwicklungspolitik in erster Linie auf die Schaffung von formal-rechtlichen Institutionen zielt, wird auf Grundlage der herausgearbeiteten Wirkungskanäle zudem dargestellt, in welcher Weise informelle Institutionen in ein formal-rechtliches System überführt werden können.
3.1 Mängel der neoklassischen Wirtschaftstheorie
Institutionen finden in der neoklassischen Theorie keine Berücksichtigung. Ausgehend von ihrer grundlegenden Prämisse des methodologischen Individualismus sowie ihrer Verhaltensannahme der rationalen und in diesem Sinne immer optimal nutzenmaximierenden Wahl wird der Einfluss von Institutionen auf den marktwirtschaftlichen Austauschprozess vollständig ausgeblendet (vgl. SIMON, 1986). In der künstlichen Welt der vollkommenen Konkurrenz, die sich im Wesentlichen durch perfekte Information, Homogenität der Güter sowie das Fehlen von Transaktionskosten kennzeichnet, sind Institutionen überflüssig. Alles, was rationale Individuen im derart konzipierten Totalmodell von WALRAS (1874) zu ihrer Verhaltensentscheidung benötigen, ist der Preis. Er ist der Träger aller wichtigen Informationen über sonst gleichwertige Güter und stellt über den von Walras eingeführten Auktionator sicher, dass sich alle Märkte im Gleichgewicht befinden.
Eine solch restriktive Wirtschaftstheorie ist auf die Realität – insbesondere die der Entwicklungsländer – naturgemäß schwer übertragbar. Abgesehen von einer denkbaren Homogenität der Güter bieten insbesondere die Annahme der perfekten Information sowie der vollkommenen Rationalität, also einer nach rein nutzenmaximierenden Überlegungen getroffenen Entscheidung, Anlass für Kritik (vgl. NORTH, 1995, S. 17).
Abb. 1: Wesentliche Kritikpunkte an der neoklassischen Wirtschaftstheorie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung
Um die Wirklichkeit besser abbilden zu können, müssen wirtschaftliche Austauschprozesse unter Berücksichtigung des Einflusses spezifischer Verhaltensmuster untersucht werden. Jede soziale Interaktion wird durch diese Verhaltensmuster beeinträchtigt und modifiziert – sei es durch bestehende formal-rechtliche Gesetze oder aber informelle Übereinkünfte zwischen den interagierenden Personen. Als institutionelles System bildet dieser Katalog von Regeln und Verhaltensnormen die Grundlage für jeglichen sozialen Austausch. Institutionen und Individuen befinden sich hierbei in einer gegenseitigen Abhängigkeitsbeziehung: Während Individuen über die Ausgestaltung des institutionellen Rahmens entscheiden, begrenzen Institutionen die als möglich angesehenen Auswahloptionen (vgl. SHEPSLE, 1989, S. 135f.).
Institutionen sind ein Medium zur Regelung und Stabilisierung eines spezifischen Systems von Werten und Verhaltensregeln innerhalb einer Gemeinschaft. Im Idealfall bringen sie die individuellen Interessen der einzelnen Gesellschaftsmitglieder in Einklang mit den Erfordernissen der Gesamtgesellschaft. Aristoteles sah ihre vornehmliche Aufgabe z.B. in der Förderung von tugendhaftem Benehmen, wodurch die Hauptursache für Ungerechtigkeit – der Neid zwischen den Menschen – abgemildert werden sollte (vgl. TOYE, 1995, S. 49). Institutionen sind Abbild normativ fester und habituell erlernbarer Verhaltensweisen. Sie können durch aktive Auswahl oder Bestätigung geschaffen und aufrecht erhalten werden; ihr Bestehen sowie die Stabilität des gesamten institutionellen Systems kann darüber hinaus durch Verhaltensrestriktionen gestärkt und gesichert werden (vgl. LANE/ERRSON, 2000, S. 26).
Institutionen sind damit ein allgegenwärtiger Einflussfaktor auf das menschliche Leben, deren Existenz sich zwangsläufig durch die Interaktion von Individuen ergibt: Solange soziale Akteure die Fähigkeit besitzen, miteinander zu kommunizieren, wird ihr Austausch von Gedanken, Gefühlen oder ihr gezeigtes Verhalten einen inter-personellen Effekt haben und der Bildung von Institutionen Vorschub leisten. Ein Festhalten am atomistischen Modell der neoklassischen Wirtschaftstheorie erscheint unter diesem Gesichtspunkt als aussichtsloser Versuch, die institutionslose Logik der Zahlen auf die Realität auszuweiten (vgl. TOYE, 1995, S. 51).
3.1.1 Präferenzbildung unter eingeschränkter Rationalität
Die ständige Interaktion zwischen den Wirtschaftssubjekten mittels Sprache und Gestus verhindert, dass Individuen frei von äußeren Einflüssen über die Bildung von Präferenzordnungen zu nutzenoptimalen Handlungsentscheidungen kommen. Die enge Beziehung zwischen individueller und institutioneller Sphäre lässt sich gut an Gehlens Konzept von Leitideen veranschaulichen (übernommen aus GEHLEN, 1986). Leitideen geben die in einer Gesellschaft vorherrschenden Handlungsmaximen wider und bilden damit das Verbindungsglied zwischen der Rationalität von sozialen Akteuren und ihrem sie umgebenden institutionellen Rahmen. Scheint es zunächst so, als seien Leitideen ein objektives Maß zur Einschätzung sozialer Phänomene, lässt sich ebenfalls feststellen, dass durch sie sowohl die individuelle Vernunft und damit Rationalität als auch der institutionelle Rahmen einer Gesellschaft beeinflusst werden. Während Leitideen also generell stabilitätsfördernd auf den sozialen Raum wirken, da sie die gemeinsam geteilten Überzeugungen seiner Mitglieder repräsentieren, müssen sie zudem als dynamische Einflussfaktoren verstanden werden, die sich im Laufe der Zeit an veränderte äußere Umstände anpassen können (vgl. STÖLTING, 1999, S. 113).
3.1.2 Institutionen und ihr Einfluss auf Informationskosten
Institutionen bilden dementsprechend die Grundlage für stabile Bewertungsmuster; ohne sie wäre es nicht möglich, menschliches Verhalten als z.B. fair, gerecht, freundlich oder böse einzustufen. Das Fehlen einer objektiven Rationalität, die einen einheitlichen Maßstab für die Präferenzbildung der einzelnen Individuen bedeuten würde, macht demnach alle Bewertungen menschlichen Verhaltens abhängig vom institutionellen und damit den von den Gesellschaftsmitgliedern beeinflussten Kontext (vgl. WOLFF, 1999, S. 133ff.). Ohne eine objektive oder, wie NORTH (1995, S. 8) anmerkt, instrumentelle Rationalität bricht jedoch eine wesentliche Prämisse der neoklassischen Theorie zusammen.
Die Wirtschaftstheorie hat auf diese Herausforderung bereits früh mit dem Konzept der eingeschränkten Rationalität reagiert (SIMON, 1955). Es stellt damit den ersten einer Reihe weiterer Versuche dar, den ursprünglichen Analyserahmen der Mikroökonomie zu bewahren.[14] Im Unterschied zur reinen und – wie beschrieben – institutionslosen Ökonomie billigt ein gemäßigterer neoklassischer Ansatz nunmehr den Einwand, dass ein Teil der von der Theorie implizit vorausgesetzten Institutionen wie Geld und Privateigentum zunächst aktiv geschaffen werden müssen.
Analog zum engen Zusammenspiel, das zwischen dem institutionellen Rahmen einer Gesellschaft und dem Verhalten ihrer Mitglieder besteht, interagieren auch bestehende Werte und Normen mit ihrer tatsächlichen organisatorischen Ausgestaltung. Obwohl dies keine Voraussetzung für das Vorhandensein einer Institution darstellt, werden viele Werte auch vom organisatorischen Rahmen einer Gesellschaft repräsentiert und gestützt. Die Legitimation dieser Organisationen hängt wiederum stark vom Konsens der Gesellschaftsmitglieder ab.
Ob und inwieweit institutionelle Regelungen zum Tragen kommen, beruht entscheidend auf ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz. Die Legitimität von neuen Strukturen, die eine Verhaltensänderung und -anpassung verlangen, ist daher nicht einfach durch ihre Absicherung in formal-rechtlichen Gesetzen oder öffentlichen Behörden zu erreichen. Vielmehr bedarf es einem Annäherungsprozess an ihre Legitimität – „[a] moving toward ... legitimacy“ (STEIN, 1995, S. 115). Diese These wird z.B. dadurch gestützt, dass der wirtschaftliche Wandlungsprozess in den osteuropäischen Transformationsländern nicht allein durch die – verhältnismäßig schnell umzusetzende – formale Errichtung einer marktwirtschaftlichen Ordnung erfolgen konnte. Insbesondere in Russland, wo nach Jahrzehnten zentralstaatlicher Planwirtschaft liberale Marktstrukturen nur unzureichend ausgebildet sind, zeigt sich deutlich, dass „merely rewriting the rules and reforming legal institutions, while necessary, is not sufficient to change behavior“ (vgl. HENDLEY, 1997, S. 246).
Aus dem bisher gesagten wird deutlich, dass in der Realität Verzerrungen und suboptimale Ergebnisse eher Regel als Ausnahme wirtschaftlicher Austauschprozesse sind. Augenscheinlich führen die Handlungsentscheidungen von Wirtschaftssubjekten in einer Marktwirtschaft nicht zwangsläufig zu optimaler Nutzenmaximierung und Wohlstandvergrößerung, wie Adam SMITH (1776) noch durch sein Modell der unsichtbaren Hand andeutete.
Grund für diese Verzerrungen sind Marktunvollkommenheiten, die einen effizienten Ressourceneinsatz verhindern. Im Unterschied zu der in der neoklassischen Theorie angenommenen Existenz vollkommener Information ist es oftmals nicht möglich sowie angesichts der damit verbundenen Kosten häufig weder ratsam noch rational, ständig alle zur Verfügung stehenden Information einzuholen. Stattdessen kann eine bewusste Entscheidung, auf kostspielige Informationen zu verzichten und seine Wahl stattdessen auf Basis einer schon bestehenden Präferenz zu treffen, nutzenmaximaler sein als im Fall der perfekten Informationsbeschaffung (vgl. BATES, 1995, S. 32). Ein effizienter Austausch im Sinne des neoklassischen Marktgleichgewichts wird dadurch jedoch verhindert.
Institutionen können nun als Reaktion verstanden werden, diese Unvollkommenheiten der Märkte auszugleichen. Ein Beispiel verdeutlicht dies: Um das Informationsdefizit einer Transaktion zu umgehen ist es denkbar, z.B. im Falle fehlender Kenntnis über die Zahlungsfähigkeit eines Kunden mit diesem dennoch ein Geschäft abzuschließen, da der Kunde seinen Verpflichtungen bisher immer nachgekommen ist. An die Stelle der vollkommenen Information tritt in diesem Beispiel die Institution des Vertrauens.
Allerdings ist mit der Existenz von Institutionen sowie ihrem Einfluss auf wirtschaftliche Austauschprozesse nicht gesagt, dass dadurch immer nur ein Nutzen vermehrender Effekt erzielt wird. Vielmehr können Institutionen bestehende Unvollkommenheiten in den Märkten verstärken und festigen; dann nämlich, wenn die Institutionen selbst Ausdruck der am Markt vorhandenen Mängel sind. Institutionen werden von Menschen geschaffen und sind daher nicht frei von menschlichen Fehlentscheidungen. Über positive Rückkoppelungseffekte von Institutionen auf individuelle Präferenzen kann es auf diese Weise sogar zu einer Verschärfung bestehender Unzulänglichkeiten kommen.
3.2 Wie wirken Institutionen – eine konzeptionelle Betrachtung
Der Einwand, menschliches Verhalten könne nur bedingt in das mathematische Korsett der neoklassischen Wirtschaftstheorie gepresst werden, lässt sich recht leicht mit Verweis auf mögliche Paradoxien[15], Anomalien in Form irrationalen Verhaltens[16] oder ganz allgemein die Existenz von Marktunvollkommenheiten begründen. Diese Aspekte verdeutlichen, dass die neoklassische Theorie wie alle Theorien nur eine Annäherung und keine genaue Abbildung der Realität ist. Ungewiss bleibt, ob die Berücksichtigung von Institutionen eine exaktere Darstellung und Analyse der Wirklichkeit ermöglicht und wie dies in Form eines theoretischen Konzepts geschehen könnte.
Dass Institutionen Einfluss auf das Verhalten von Individuen haben, ist im Grunde unstrittig und von untergeordneter Relevanz (vgl. IMMERGUT, 1997, S. 325). Nachdem Sozial- als auch Teile der Wirtschaftswissenschaften die Bedeutung von Institutionen (wieder-) entdeckt haben (vgl. MARCH/OLSON, 1989), ist es nunmehr wesentlich entscheidender zu klären, welche Institutionen in welcher Form das Verhalten beeinflussen (vgl. GÖHLER/KÜHN, 1999, S. 18). Diese Erkenntnisse sind insbesondere für die internationale Entwicklungspolitik bedeutsam, da hieraus Ansatzpunkte für eine effizientere Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung abgeleitet werden könnten. Eine um den Einfluss von Institutionen erweiterte Wirtschaftstheorie, die den allgemeinen Analyserahmen der Neoklassik beibehält, ist die schon Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte und in den letzten Jahren wieder verstärkt diskutierte Institutionenökonomik.[17]
3.2.1 Grundzüge der Institutionenökonomik
Die Institutionenökonomik untersucht wirtschaftliche Austauschprozesse unter Berücksichtigung des spezifischen institutionellen Rahmens, der diese Vorgänge umgibt. Im Kern vertritt sie dabei die Ansicht, dass Institutionen durch eine bewusste Entscheidung rational handelnder Wirtschaftssubjekte geschaffen werden, die auf diese Weise ihren Nutzen zu maximieren versuchen. Institutionen werden dabei verstanden als Reaktion auf die durch Transaktionskosten hervorgerufenen Mängel des Marktes, dessen Steuerungsfunktion angesichts der in der Realität bestehenden Unzulänglichkeiten sogar vollständig versagen kann.
Im Unterschied zur gewöhnlich vorgebrachten Kritik am neoklassischen Modell verbindet sie mit dem Verweis auf ein mögliches Marktversagen jedoch nicht automatisch der Ruf nach dem Staat, der die vermeintlich bessere Steuerung im Vergleich zum dezentralen Koordinationssystem der Märkte verspricht. Vielmehr hält die Institutionenökonomik den öffentlichen Sektor dazu an, durch die aktive Anpassung des institutionellen Rahmens die Effizienz des Marktprozesses zu steigern (vgl. HARRIS et al., 1995, S. 1).
Durch das Zugeständnis einer möglichen Existenz von Marktunvollkommenheiten ist die Institutionenökonomik gerade für die Entwicklungspolitik ein wichtiger Ideengeber und Wegweiser, um die Nachhaltigkeit von Reformen sicherzustellen. Entwicklungsländer mit ihren oftmals nur ungenügend ausgebauten formal-rechtlichen Steuerungsmechanismen sowie ihren teilweise „pervasive market failures“ (BATES, 1995, S. 36) bilden naturgemäß eine ideale Projektionsfläche für Theorien, die am Aufbau effizienzsteigernder Institutionen ansetzen.
3.2.2 Institutionenökonomik und der Aufbau von Märkten
Entwicklungspolitik muss sich aus Sicht der Institutionenökonomik immer auf die Entwicklung von Märkten richten. Nach NORTH (1990, S. 34f.) bestehen folgende Stadien der institutionellen Marktreife: (i) persönlicher Austausch innerhalb homogener Kulturgemeinschaften, (ii) unpersönlicher Austausch, der sich über Verwandtschaftsbeziehungen und Verhaltenskodexe regelt, und (iii) unpersönlicher Austausch, der durch eine Drittpartei (z.B. Staat) gesichert wird.
Die Bildung von marktwirtschaftlichen Institutionen ist hierbei ein evolutorischer Prozess, in dem sich jeweils diejenige institutionelle Regelung durchsetzt, die am besten den gegebenen Anforderungen genügt (NORTH, 1995, S. 20). Da Institutionen annahmegemäß immer auf der Entscheidung von Einzelakteuren basieren, kann es durch eine asymmetrische Verteilung von Information, unterschiedliche Machtpositionen im (abstrakt angenommenen) Verhandlungsprozess oder durch zu kurzfristig ausgerichtete Partikularinteressen auch zu einer ineffizienten Auswahl des institutionellen Ordnungsrahmens kommen. Es besteht daher kein Automatismus, der die Erreichung eines bestmöglichen institutionellen Systems garantiert (vgl. NORTH, 1981, S. 20). Die Entwicklung einer Gesellschaft wird entscheidend durch bereits vorhandene institutionelle Faktoren bestimmt, geleitet bzw. eingeschränkt, wobei Institutionalisten eine strikte Annahme einer pfadabhängigen Entwicklung annehmen (vgl. NORTH, 1990, S. 93ff.).
Damit aber ließen sich unterschiedliche Reifestadien einer Marktwirtschaft auf den Einfluss von kulturethnischen Einflussgrößen zurückführen – eine vermeintliche Erklärung für den bisherigen wirtschaftlichen Misserfolg der Entwicklungsländer, die z.B. von DE SOTO (2000, S. 4) vehement bestritten wird. Auch RODRIK (1999, S. 1) sieht den Entwicklungsrückstand der Dritten Welt eher durch strukturelle denn durch kulturspezifische Faktoren begründet; er befindet „ homo oeconomicus to be alive and well in the tropics and other poor lands”.
3.2.3 Einfluss der Kultur auf Entwicklungspfade
Angesichts weltweiter Entwicklungsunterschiede und der paradoxen Situation, dass Entwicklungsländer häufig über wesentlich reichhaltigere Naturressourcen verfügen als die Industrienationen, liegt die Vermutung nahe, dass auch die Kultur eines Landes Einfluss auf dessen wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung hat. Vor diesem Hintergrund wird z.B. der Erfolg der Industriellen Revolution in Europa einer protestantischen Arbeitsethik (angefangen mit WEBER, 1904) und das Wirtschaftswachstum der so genannten Tigerstaaten [18] in Südostasien konfuzianischen Einflüssen zugeschrieben (vgl. RHEE, 1999, S. 27). Gleichzeitig scheint für Teile der Wissenschaft erwiesen, dass einige Immigrantengruppen aufgrund ihrer spezifischen kulturellen Hintergründe wirtschaftlich erfolgreicher seien als andere (vgl. BORJAS, 1994, S. 1702).
Eine solche Betrachtung lässt allerdings außer Acht, dass die Kultur eines Landes keine rein exogene Größe ist. Folglich greift eine Betrachtung zu kurz, die in ihr ein unveränderbares Hemmnis für Entwicklungsprozesse sieht (vgl. z.B. LANDES, 1990, S. 11). Vielmehr ist die Kultur immer auch Ausdruck eines sie umgebenden institutionellen Rahmens, der durch seine Veränderbarkeit die Anpassung kultureller Faktoren in gewissen Grenzen ermöglicht – „culture itself can be shaped and changed. Behind so many attitudes, tastes, and preferences lie the political and economic forces that shaped them“ (ZAKARIA, 1999, o.S.).
Die deutliche Betonung der Einzelakteursebene seitens der Institutionenökonomik erscheint vor diesem Hintergrund als zu strenge Annahme, das institutionelle System einer Gesellschaft allein auf einen im Grunde zufälligen Prozess zurückzuführen (vgl. BATES, 1995, S. 44). Streng genommen ergäbe sich durch diesen Zusammenhang ein verhängnisvoller Teufelskreis: Institutionen beschränken die Auswahloptionen für die Ausgestaltung des institutionellen Systems und stärken sich auf diese Weise selbst. Der Einfluss von anderen Ebenen wie dem Staat als forcierendes oder behinderndes und in diesem Sinne formendes Element wird hingegen unzureichend wahrgenommen. Gerade im Bereich der Entwicklungspolitik ist es jedoch wichtig, nicht nur eine Diagnose der bestehenden Probleme anzubieten, sondern gleichzeitig eine Lösungsstrategie aufzuzeigen.
Aus diesem Grund soll von der oben dargestellten strengen Form der Pfadabhängigkeit, die durch diesen restriktiven Auswahlmechanismus impliziert wird, im Folgenden abgesehen werden. Wie EASTERLY (2001, S. 141ff.) erklärt, reagieren Menschen auf Anreize; nur wenn diese fehlen oder falsche Signale setzen, sind unerwünschte Verhaltensentscheidungen eine unausweichliche Konsequenz. Eine kluge und umsichtige Entwicklungspolitik, die insbesondere auf die Nachhaltigkeit ihrer Reformvorhaben zielt, kann jedoch durch die aktive Anpassung des formal-institutionellen Rahmens die Bedingungen schaffen, die für eine wirtschaftliche Entwicklung nötig sind, um auf diese Weise den vermeintlich vorgezeichneten Pfad in eine andere Richtung umzulenken.
Entwicklungspolitik als Verhaltensmodifikation
Mit dem Hinweis auf die bewusste Veränderung von Institutionen ist die Brücke geschlagen zu der eingangs dargestellten Auswirkung des institutionellen Umfelds auf die individuelle Rationalität. Nach dem bereits genannten Konzept von SIMON (1955), der rationales Verhalten immer begrenzt sieht durch die verfügbaren Informationen, individuelle Erfahrungen sowie persönliche geistig-reflektorische Kapazitäten, ist die Kultur kein unvermeidliches Resultat ethnischer Charakteristika; vielmehr basiert sie auf den rationalen Entscheidungen und Präferenzen der Gesellschaftsmitglieder. Über eine Modifikation der Parameter, auf deren Grundlage rationale Entscheidungen getroffen werden, ist Kultur damit in einem gewissen Umfang form- und veränderbar.
Allerdings ist dies ein langwieriger – angesichts der damit verbundenen Konsequenzen und Auswirkungen auf das Leben in Entwicklungsländern ebenfalls sensibler und sicherlich nicht unproblematischer[19] – Prozess. Aus dem Zusammenhang der durch Normen beeinflussten Verhaltensmuster mit der tatsächlichen Ausgestaltung des organisatorischen Rahmens einer Gesellschaft ergibt sich, dass formale Institutionen nur dann akzeptiert werden, wenn sie die von der Gesellschaft geteilten Werte widerspiegeln. Folglich ist eine Konkordanz nötig zwischen bestehender informeller und aufzubauender formaler Regelung. Dabei ist zu beachten, dass eine Verhaltensanpassung wesentlich mehr Zeit beansprucht als die Schaffung neuer Gesetze und formaler Institutionen (vgl. LEPSIUS, 1990, S. 63).
Nachhaltigkeit von entwicklungspolitischen Reformen
Für die Wirksamkeit von entwicklungspolitischen Reformen bedeutet dies, dass eine nachhaltige Veränderung nicht mit Zwang oder Gewalt erreicht werden kann, sondern nur durch die Schaffung von adäquaten Anreizstrukturen. Ineffiziente Märkte und entwicklungshemmende Strukturen sind kein unvermeidbares Ergebnis kultureller Eigenarten, sondern lassen sich vielmehr zurückführen auf fehlende oder schlecht an die jeweilige Situation angepasste formal-institutionelle Rahmenbedingungen. Im Bereich der Eigentumsformalisierung bedeutet dies z.B. Folgendes: Um dauerhaft wirksame Reformen zu erreichen ist es nötig, den Prozess des Übergangs in den formalen Markt so sehr zu verkürzen, ihn zu vereinfachen oder zu verbilligen, dass es auf Grundlage einer rationalen Entscheidung sinnvoll erscheint, diesen Schritt zu unternehmen.
Die Kultur eines Landes ist jedoch insofern von entscheidender Bedeutung, als sie das Spektrum der möglichen institutionellen Reformen begrenzt. Dies hat schon NORTH (1981, S. 18) festgestellt; allerdings beurteilt er den einschränkenden Charakter der Kultur nicht ausschließlich negativ, sondern erkennt darin ebenfalls einen essentiellen Wert für institutionelle Reformen. Die Durchsetzung von formalen Gesetzen sei mit erheblich weniger Kosten verbunden, wenn die formal-rechtlichen Regelungen auf Verständnis bei der Bevölkerung stoßen: „To the extent that the participants believe the sytem to be fair, the costs of enforcing the rules ... are enormously reduced by the simple fact that the individuals will not disobey“ (NORTH, 1981, S. 53).
3.2.4 Institutionenökonomik und Transaktionskosten
Zentraler Ansatzpunkt der (alten wie neuen) Institutionenökonomik ist die Transaktionskostenproblematik (vgl. COASE, 1937; NORTH, 1987). Durch die Existenz von Transaktionskosten wird ein optimaler Marktaustausch vereitelt, da Verhaltensentscheidungen auf der Grundlage unvollständiger Informationen und teilweise irrationaler Auswahlprozesse getroffen werden (vgl. NORTH, 1995, S. 17). Institutionen, die sowohl direkt auf die Rationalität der Wirtschaftssubjekte wirken als auch indirekt rationales Verhalten steuern, indem sie über den institutionellen Rahmen einer Gesellschaft den Grad der Marktunvollkommenheit bestimmen, werden demnach als reiner Kostenfaktor operationalisiert.
Dies geschieht auf Basis einer einfachen Annahme: Die Wahl irrationalen Verhaltens ist immer eine bewusste Entscheidung, sich angesichts bestehender Marktunvollkommenheiten durch den Rückgriff auf kostengünstigere Einflussfaktoren leiten zu lassen. Die Kostenintensität der Informationsbeschaffung ermöglicht auf diese Weise eine Verhaltensbeeinflussung durch nicht-ökonomische Faktoren wie die Überzeugungskraft von Dritten oder aufgezwungene Präferenzordnungen. Mikroökonomisch argumentiert kann es so im Extremfall zu einer adversen Selektion kommen, also einer bevorzugten Auswahl minderwertiger Produkte, da der Preis als einzige kostengünstige Information im Verhältnis zur Qualität überbewertet wird. Der Marktprozess führt durch dieses Verhalten zu keinem effizienten Auswahlverfahren.
Die Institutionenökonomik sieht die Aufgabe von Institutionen im Wesentlichen darin, Unsicherheiten zwischen den Menschen, die immer mit zusätzlichen Kosten verbunden sind, zu mindern oder – im Idealfall – vollständig durch feste Regelbindungen auszuschalten (vgl. NORTH, 1990, S. 6). Neben psychologischen Aspekten wie einer Verhaltensentscheidung auf Basis von Vertrauen oder Gutgläubigkeit bewirken auch formal-rechtliche Institutionen wie gesichertes Privateigentum eine Unsicherheitseindämmung und Transaktionskostensenkung. Sie fördern somit wirtschaftliches Verhalten und ermöglichen eine bessere, da konsequentere Ausnutzung bestehender Ressourcen. Formal gesicherten Eigentumsrechten wird aus diesem Grund eine entscheidende Bedeutung in der Literatur der Institutionenökonomik beigemessen (vgl. NORTH, 1995, S. 25); einige Autoren erkennen in ihnen gar den Schlüssel zu wirtschaftlicher Entwicklung und Wachstum (vgl. HOSKINS/EIRAS, 2002, S. 37ff.).
Allerdings ist auch bei der Errichtung formal-rechtlicher Institutionen das Kostenargument zu beachten. So müssen potenzielle von tatsächlich erreichbaren Vorteilen unterschieden werden, um festzustellen, ob sich der Aufbau eines formal-institutionellen Rahmens lohnt. Im Bereich der Eigentumssicherung könnten ebenfalls informelle Regulierungsmechanismen, die auf Vertrauen und gemeinschaftlichen Übereinkünften basieren, eine effiziente Lösung darstellen. Gegen eine generelle Vorteilhaftigkeit eines durch den Staat gesicherten Eigentumssystems stellt ELLICKSON (1991) für Kalifornien fest, dass dortige außergesetzliche Abmachungen zwischen Viehzüchtern effizienter seien als eine formal gesetzliche Regelung. Andere Beispiele lassen sich aus den Bereichen der Diamanten- und Baumwollindustrie zitieren, wo ebenfalls private Abkommen eine staatliche Sicherung überflüssig machten (vgl. BERNSTEIN, 1992 und 2001).
3.3 Zusammenfassung
Der vorige Abschnitt hat die Bedeutung von Institutionen für wirtschaftliche Austauschprozesse aufgezeigt, die als ubiquitärer Einflussfaktor auf individuelle Verhaltensmuster identifiziert wurden. In deutlichem Kontrast zu der von der neoklassischen Theorie vertretenen vollkommenen Konkurrenz spielen Institutionen eine wichtige Rolle im Wirtschaftsprozess; sie beeinflussen insbesondere die Rationalität der Wirtschaftssubjekte sowie die individuell verfügbaren Informationen, auf deren Grundlage Verhaltensentscheidungen getroffen werden.
Als Weiterentwicklung der neoklassischen Theorie untersucht die Institutionenökonomik nutzenmaximierendes Verhalten unter Beachtung des Einflusses von Institutionen. Sie kommt dabei zu dem Schluss, dass Institutionen im Idealfall die Unsicherheit zwischen den Menschen verringern bzw. vollständig ausschalten und über eine Kostenminimierung den Wirtschaftsablauf positiv unterstützen. Neben informellen Übereinkünften kann eine formal-rechtliche Ausgestaltung des institutionellen Systems förderlich auf den Wirtschaftsprozess wirken. Formale Institutionen müssen allerdings in Konkordanz stehen zu den informellen Verabredungen sowie der Kultur einer Gesellschaft, um eine optimale Wirkung zu entfalten. Im Hinblick auf die Erfolgsaussichten institutioneller Reformen bedeutet dies für die Entwicklungspolitik zweierlei: Entweder muss der zeitliche Projektrahmen langfristig angelegt sein, um eine mögliche Anpassung der informellen Strukturen mit den formal-rechtlichen Institutionen zu ermöglichen; oder die institutionellen Reformen müssen auf bereits bestehende informelle Strukturen aufbauen.
Im Rahmen einer formal-rechtlichen Ausgestaltung des institutionellen Systems kommt der Institution des Eigentums eine entscheidende Bedeutung zu, um wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen; sie ist eine conditio sine qua non einer jeden Marktwirtschaft. Der folgende Abschnitt konzentriert sich daher ausführlich auf die Institution des Eigentums und ihren Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung.
4. Die Institution Eigentum
Entgegen der landläufigen Gleichsetzung des Eigentumsbegriffes mit dem jeweiligen Eigentumsgegenstand selbst beschreibt das Eigentum ein Rechtsverhältnis. Eigentum gewährt einem Individuum hierbei ein ganzes Bündel an Rechten an einer beweglichen – oder im Fall des Grundeigentums – unbeweglichen Sache. Neben dem Recht, die Verfügungsgewalt an einer Sache auszuüben (ius abutendi), umfasst Eigentum zudem das Recht zur Nutzung (ius utendi) sowie zum Besitz (ius possessio) einer Sache. Ein weiterer elementarer Bestandteil des Eigentums liegt im Recht zur Fruchtziehung aus Eigentumsgegenständen (vgl. STEIN, 1995, S. 115).
MACPHERSON (1978, S. 10) führt die fehlerhafte Vermischung von Eigentumsrecht und
-gegenstand auf die Herausbildung der kapitalistischen Wirtschaftsform zurück, in der alles handel- und veräußerbar wurde. Dass mit dem Kauf eines Gegenstands allen voran ein Rechtsgeschäft geschlossen würde, sei angesichts der real stattfindenden Eigentumsübergänge zunehmend schwerer nachzuvollziehen gewesen. Diese Differenzierung war in der Theorie hingegen nie umstritten. Eigentum wird darin ausdrücklich als persönliches Recht über eine Sache definiert und ursprünglich sogar auf abstrakte Konzepte wie das Leben und die individuelle Freiheit angewendet (vgl. PIPES, 1999, S. xv).
Eigentum lässt sich unterteilen in Privateigentum, Staatseigentum und öffentliches Eigentum (vgl. MACPHERSON, 1978, S. 6). Bis auf die letzte dieser Eigentumsformen beinhaltet das Eigentumsrecht in erster Linie das Recht zum Ausschluss Anderer von Rechtsansprüchen an einem Eigentumsgegenstand; das Eigentumsrecht muss daher ausgeglichen sein durch die Pflicht Dritter, dieses Recht zu respektieren (vgl. GRANT, 1998, S. 3). Die vorliegende Arbeit wird sich hauptsächlich auf das Privateigentum konzentrieren, mit dem ein individuelles Recht an einer Sache begründet wird. Als solches ist Privateigentum ein grundlegendes Element eines marktwirtschaftlichen Systems, da es den einzelnen Wirtschaftsakteuren Sicherheit für Transaktionen sowie einen Anreiz für wirtschaftliche Austauschprozesse liefert. Erwähnt sei an dieser Stelle, dass andere Autoren (insbesondere OSTROM, 1990) für den Bereich der Entwicklungsländer auf die besondere Bedeutung von Gemeinschaftseigentum verweisen, über das die Gemeinschaftsmitglieder zusammen als öffentliche Eigentumsressource verfügen.
4.1. Die Institution Eigentum im historischen Wandel
Schon früh beschäftigte Philosophen und Nationalökonomen die Frage nach der Bedeutung des Eigentums. Im Zentrum der Betrachtung stand hierbei zumeist die Suche nach den Kriterien, die ein durch den Eigentumsbegriff definiertes, absolutes dingliches Recht über eine Sache begründen und legitimieren. Bei der Auswertung dieser theoretischen Diskussionen wird offenbar, dass sich die Bedeutung des Eigentumsrechts im Zeitablauf fortwährend veränderte. Eigentum ist eine von den Menschen künstlich geschaffene Institution, die darauf zielt, die Realität entsprechend der in der Gesellschaft bestehenden Normen und Wertvorstellungen zu formen. Folglich ist sie einem ständigen Wandel ausgesetzt, der sich an den jeweils vorherrschenden Präferenzen und Zuständen in einer Gesellschaft orientiert.
Der folgende Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Stationen der modernen Eigentumstheorie. Angefangen mit John Locke, der mit seinen Schriften maßgeblich die Entwicklung des liberalen Rechtsstaates beeinflusste und die Grundlage des modernen Eigentumsbegriffes schuf, werden weitere, z.T. kritische und kontroverse Positionen dargestellt, die die Bedeutung der Institution Eigentum bis in die heutige Zeit beeinflusst haben.
4.1.1 Eigentum als Naturrecht
In deutlichem Kontrast zur vorherrschenden Ansicht seiner Zeit leitet John LOCKE (1689) das Recht zum Eigentum aus einem Naturrecht an den gottgegebenen Ressourcen ab. Jeder Mensch besitze das natürliche Recht, von den „Dingen Gebrauch zu machen, die für sein Dasein notwendig oder nützlich“ seien (ebd., S. 136). Privateigentum an einer Sache gründe folglich nicht auf der königlichen (oder hoheitlichen) Vermögenszuteilung, die noch die paternalistische Weltsicht des Mittelalters bestimmt hatte, sondern beruhe vielmehr auf der individuellen Leistungsfähigkeit, die von der Natur bereitgestellten Güter durch Arbeit zu gewinnen oder nutzbar zu machen: „[Es war] die Arbeit, die zuerst ein Eigentumsrecht verlieh“ (ebd., S. 228). Dieses sei die eindeutigste und legitimste Form, ein individuelles Recht an einer Sache zu begründen, da der Wert eines Gegenstandes zu einem Großteil erst durch Arbeit erschaffen werde und folglich niemand die Rechtmäßigkeit eines auf dieser Grundlage begründeten Eigentumsanspruches bestreiten könne.
Locke sieht in seinem Naturrechtsprinzip das Recht auf Privateigentum sowohl begründet als auch begrenzt. Jedem stehe selbstverständlich nur soviel aus dem Pool der natürlichen Ressourcen zu, wie er für den eigenen Verbrauch benötigen würde. Allerdings wird diese Ansicht aufgeweicht und vollends aufgehoben durch die Institution des Geldes, für die diese Einschränkung in Lockes Theorie nicht gilt. Als künstlich geschaffenes Wertaufbewahrungsinstrument ermöglicht Geld den Menschen eine Eigentumsanhäufung über den täglichen Bedarf hinaus und bildet somit die Grundlage für eine möglicherweise stark divergierende Vermögensverteilung in der Gesellschaft. Das Recht am Eigentum ist in Lockes Theorie ein unbeschränktes Recht[20] (vgl. DÖHN, 1998, S. 174).
Mit seinem auf Arbeit gründendem Naturrechtsprinzip ist Locke ein wichtiger Vertreter für eine Ansicht, die von einer Vielzahl anderer Theoretiker bestätigt wurde und sich bis in die heutige Zeit hat fortsetzen können.[21] Arbeit als bestimmendes und das Recht auf Eigentum generierendes Element wurde ebenfalls von Jeremy BENTHAM (1802) proklamiert. Allerdings verknüpft Bentham die Existenz des Eigentums an einen institutionellen Rahmen, der das Naturrecht durch eine verbindliche gesetzliche Ordnung abbilden müsse. Auch Bentham sieht im natürlichen Trieb der Menschen, sich die Natur durch Arbeit nutzbar zu machen, den Grundstein zur Schaffung von Eigentum; ohne einen gesetzlichen Rahmen, der als einziger garantieren könne, dass der Lohn der Bemühungen auch tatsächlich demjenigen zustünde, der sie durch seine eigene Arbeit erwirtschaftet habe, reduziere sich der Antrieb der Menschen jedoch auf die Sicherung der eigenen Lebensgrundlage. Ohne Rechtsinstitutionen, so Bentham, könne Eigentum daher nicht existieren (vgl. ebd., S. 52).
Während Locke also Eigentumsrechte bereits in vorgesellschaftlichen Gemeinschaften verankert sieht, ist für Bentham ein gesetzlicher Rahmen Vorbedingung für ihre Existenz. Zudem vertritt er die Ansicht, das eine Überschussproduktion, die die ökonomische und soziale Wohlfahrt einer Gesellschaft steigern würde, erst erwartet werden dürfe, wenn die Menschen Erwartungen über die Zukunft bildeten. Benthams logische Wirkungskette sieht in (i) der Schaffung von Rechtssicherheit über Eigentum die Voraussetzung für (ii) die Bildung von Erwartungen über die Zukunft, die zu (iii) einem erhöhten Arbeitsaufwand über den täglichen Bedarf hinaus und dadurch (iv) zur Produktion von Überschüssen führt. Dieser Überschuss ermögliche eine Wohlfahrtssteigerung oder, gemäß Benthams Gleichsetzung von materiellem Wohlstand und Glück, „a ... portion of happiness“ (ebd., S. 46).
Obgleich Bentham eingesteht, dass die Schaffung von Eigentum nach den von ihm genannten Prinzipien zwangsläufig zu Ungleichverteilungen führen würde und materieller Reichtum immer nur bestehen könne durch die gleichzeitige Existenz von Armut, sieht er im Eigentum dennoch die Basis für gesellschaftliche Wohlfahrt. In seiner Theorie beschreibt Armut den Urzustand der menschlichen Existenz (the primitve condition of the human race); erst die Institution des Eigentums habe wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht. Vermögensunterschiede zwischen den Menschen seien sogar unverzichtbare Grundlage für die gesellschaftliche Leistungsfähigkeit, da erst die Aussicht auf materielle Besserstellung wirtschaftliche Anreizstrukturen schaffen würde (vgl. ebd., S. 52f.).
4.1.2 Kritische Positionen zu einem unbeschränkten Zugang zu Eigentum
Angesichts starker gesellschaftlicher Vermögensunterschiede, denen Locke und auch Bentham keine besondere Bedeutung zumaßen oder in denen beide sogar eine positive Anreizwirkung zu höherer Produktion erkannten, entwickelten sich jedoch ebenfalls kritische Ansichten über das uneingeschränkte Recht zum Eigentumserwerb. Für Jean-Jacques ROUSSEAU (1755) liegt im Eigentum der Anfang allen lasterhaften und moralisch verwerflichen Verhaltens: Es begründe den Neid, die Kriminalität und die Unsicherheit in und zwischen den Staaten und bilde die Grundlage für innergesellschaftliche und internationale Konflikte. Aus dem von HOBBES (1651) dargestellten Naturzustand des Kampfes der Menschen untereinander begründet das Eigentum damit zugleich die Basis für den von Hobbes und später ROUSSEAU (1762) entwickelten Gesellschaftsvertrag, der diese Missstände auszugleichen versucht. Eigentum ist folglich ein essentielles Element, das die moderne Zivilgesellschaft erst ermöglichte bzw. als second best solution notwendig machte: „Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire ‚Ceci est à moi’, et trouva des gens assez simple pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile“ (ROUSSEAU, 1755, S. 31). In seiner Darstellungen des Ursprungs und der Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen legt Rousseau daher seine revolutionäre Forderung nach Wiederherstellung der natürlichen Gleichheit aller Menschen dar.
Auch Rousseau erkennt im Eigentum ein Naturrecht, das allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung stehe bzw. stehen solle. Allerdings sieht er dieses Recht gefährdet durch die von ihm beobachtete materielle Ungleichverteilung. Aufgabe des Staates solle daher nicht der Schutz bestehender Eigentumsverhältnisse sein, sondern die Sicherstellung eines gleichen Zugangs zum Eigentumserwerb. Durch künstliche Bedürfnisse sei das Streben nach Eigentum einem pervertierten Wunsch nach Reichtum, Macht und Überlegenheit über andere Gesellschaftsmitglieder gewichen und diene längst nicht mehr der Befriedigung natürlicher Bedürfnisse. Als Grenzfall ließe es gar das Eigentum am Menschen zu, was deutlich die von Rousseau festgestellte Ungleichheit in der Gesellschaft unterstreichen würde. Eigentum müsse daher begrenzt sein auf das Maß, das ein einzelner verbrauchen kann (ebd., S. 36).
Die Abhängigkeit eines Großteils der Gesellschaft steht ebenfalls im Zentrum der Kritik von Karl MARX (1848/1867) am kapitalistischen Eigentumssystem. Nicht mehr das direkte Eigentum am Menschen – die Sklaverei, die Rousseau in seiner Abhandlung verurteilt –, sondern die Freiheitsbeschränkung der proletarischen Bevölkerung durch den fehlenden Zugang zu den Produktionsmitteln sei nach Marx Quelle der Ungleichheit zwischen den Gesellschaftsmitgliedern. Marx wendet sich damit deutlich gegen die von Bentham formulierte These, dass Privateigentum Grundlage für gesellschaftliche Wohlfahrt sei, da es einen Ansporn für wirtschaftliches Verhalten gebe. Im Gegenteil sieht Marx im Privateigentum das grundlegende Übel der kapitalistischen Gesellschaft: Die Existenz von Privateigentum führe unweigerlich zur Enteignung großer Teile der Gesellschaft, da zunehmend mehr Leute nicht mehr für sich selbst, sondern für einen Kapitalisten arbeiten müssten, der über die Produktionsmittel verfügt. Arbeiter seien dadurch wenig mehr als bloße Sklaven für die Bourgeoisie (vgl. MARX, 1848, S. 63).
Implizit stimmt Marx damit der im Grunde liberalen Meinung zu, dass erst Eigentum eine gewisse Individualität und Freiheit ermögliche. Auch lässt sich mit seiner Theorie die Auffassung vereinbaren, dass Eigentum neben wirtschaftlichen Aspekten ebenfalls die Grundlage für eine soziale Entwicklung der Gesellschaft sei, da es z.B. identitätsstiftend auf die arbeitende Bevölkerung wirke. Allerdings stünden diese Privilegien in der kapitalistischen Gesellschaft zu wenigen Leuten zur Verfügung, so dass die Existenz von Privateigentum zur Ausbeutung des Proletariats führe. Marx sieht daher die vollständige Abschaffung des Privateigentums und seine Ersetzung durch Gemeinschaftseigentum vor.
4.1.3 Eigentum in der Industriellen Revolution – Anspruch und Wirklichkeit
Die sich ständig verschlechternde Situation der Arbeiterklasse im Zuge der Industriellen Revolution und die sich herausbildende und allmählich zuspitzende soziale Frage konnten die Theoretiker fortan nicht mehr unberücksichtigt lassen. Entgegen sozialistischen und kommunistischen Positionen verteidigte John Stuart MILL (1871) jedoch weiterhin die Existenz des Privateigentums, dass angeblich für so viele gesellschaftliche Missstände verantwortlich sein sollte. Würde man das Privateigentum komplett abschaffen, so argumentiert Mill, ließe sich das effektive und wohlfahrtssteigernde Prinzip der Arbeitsteilung nicht mehr aufrecht erhalten, das gerade auf dem individuellen Streben der Menschen nach egoistischen Zielen aufgebaut sei. Nicht das Privateigentum per se habe zu sozialer Not und Ungerechtigkeit geführt; vielmehr sei es aufgrund einer historischen Fehlentwicklung zu einer Situation gekommen, die der eigentlichen Theorie des Privateigentums widerstreben würde. In der kapitalistischen Gesellschaft verfügten häufig nicht die produktivsten und arbeitsamsten Gesellschaftsmitglieder über Privateigentum, sondern ihre untätigsten und nutzlosesten Kräfte. Die bestehenden rechtlichen Regelungen hätten eher zu einer Konzentration des Reichtums geführt, anstatt für eine leistungsgerechtere Verteilung zu sorgen (vgl. ebd., S. 208).
Die Gesetzgebung solle jedoch die Legitimität des Eigentums immer daran festmachen, ob es produktiv eingesetzt oder aus produktiver Arbeit entstanden sei. Die Gesetze müssten daher verträglich sein mit den „principles on which the justification of private property rests“ (ebd., S. 207), d.h. jedem das Recht zugestehen an allem, das man selbst erarbeitet oder durch seine Enthaltsamkeit angespart habe. Mill erkennt keine Ungerechtigkeit darin, dass ein Individuum nicht in den Genuss dessen käme, was ein anderer erwirtschaftete – die von sozialistischen Theoretikern vorgebrachte Meinung, Eigentum sei automatisch Diebstahl an denjenigen, denen das Eigentum verwehrt bliebe, könne Mill nicht nachvollziehen. Allerdings sei nicht hinnehmbar „to be born into the world and find all nature’s gifts previously engrossed, and no place left for the new-comer” (ebd., S. 230).
Unterteilung von beweglichem und unbeweglichem Eigentum
Eine wichtige Unterteilung des Eigentums, die insbesondere durch die neuen industriellen Produktionsformen zentrale Bedeutung erlangte, liegt in Mills Definition von beweglichem und unbeweglichem Eigentum. Bezog sich der Eigentumsbegriff in der agrarisch geprägten Gesellschaft des 17. und 18. Jahrhunderts in erster Linie auf Landbesitz und die durch die Nutzung von Grund und Boden erwirtschafteten Produkte, eröffnete die Industrielle Revolution einen neuen Blickwinkel auf den Eigentumsbegriff. Zunehmend leitete sich materieller Reichtum nicht mehr von der Größe des bewirtschafteten oder kontrollierten Bodens ab, sondern beruhte auf dem Eigentum an industriellen Produktionsmitteln. Mill reduziert daher das von ihm definierte ökonomische Prinzip zur Eigentumsbestimmung auf bewegliche Güter, da dieses auf den Landbesitz keine Anwendung finden könne: „[N]o man made the land. It is the original inheritance of the whole species” (ebd., S. 230).
Dennoch ließe sich auch für Grundeigentum argumentieren, dass oftmals erst durch das Eigentumsrecht an einem Stück Land ein Anreiz für dessen Kultivierung gegeben würde. Ein Individuum könne immer dann zum Eigentümer eines Grundstücks werden, wenn er es zum größeren Nutzen der Gesellschaft einsetzen würde. Die Frage des Eigentumsrechts ist für Mill eine Frage der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit (expediency) – ist diese nicht mehr gegeben, müsse das Eigentumsrecht nach Zahlung einer Entschädigung an den Staat als die Vertretung der Allgemeinheit zurückfallen (vgl. ebd., S. 228).
4.1.4 Machtinstitutionen und die Schaffung und Erhaltung von Eigentumsrechten
Die wichtige Rolle des Staates als Garant für die Sicherung und Schaffung von Eigentum wird ebenfalls von Thomas Hill GREEN (1885) betont. Ohne eine Institution der Macht könne kein allgemein akzeptiertes Eigentumsrecht geschaffen werden. Green greift damit einen Gedanken auf, den zuvor Bentham in die Diskussion um das Eigentum eingeführt hatte. Der von Bentham geforderte formal-rechtliche Rahmen, der Sicherheit für das Eigentum gewährleisten und damit Erwartungen an die Zukunft ermöglichen würde, wird von Green jedoch weitaus prägnanter und präziser in der besonderen Machtposition des Staates gesehen. Nur der Staat als souveräne Vertretung des Allgemeinwillens könne in der modernen Gesellschaft die Eigentumsrechte generieren und ihren Bestand garantieren.
Green nimmt damit Abstand von der engen Lockeschen Formel, die Erschaffung von Eigentum allein auf den Arbeitseinsatz zurückzuführen. Vor ihm hatte schon David HUME (1739) darauf verwiesen, dass die Verbindung von Mensch und Eigentum nicht naturgegeben sei, sondern einer moralischen Idee entspränge und auf der Grundlage einer Gerechtigkeitsvorstellung existieren würde (vgl. ebd., S. 294). Eigentum sei, so Green, eine gedankliche Konstruktion, die darauf abzielte, die Wirklichkeit nach den moralischen Grundsätzen und Normen einer Gesellschaft zu gestalten. Jedes Eigentumsrecht beruhe daher auf einem gesellschaftlichen Konsens, der dem Eigentum erst die moralische Legitimation gewähren könne. Moderne Gesellschaften führten in dieser Hinsicht lediglich eine Tradition fort, die schon in frühen Formen menschlichen Zusammenlebens bestanden habe; so in Familien und Clans, die laut Green allesamt über eine spezifische Eigentumsordnung verfügt hätten (vgl. GREEN, 1885, S. 168). Die Gründung von Eigentum auf der Basis von Arbeit könne daher immer nur als zweiter Schritt bei der Generierung von Eigentumsrechten und erst nach dem Aufbau aller notwendigen Institutionen zu ihrer Durchsetzung erfolgen. Generell gründe das Recht auf Eigentum auf zwei Vorgängen: der individuellen Aneignung (appropriation) sowie der gesellschaftlichen Anerkennung (recognition) (vgl. ebd., S. 165f.).
Auch für Green ist die ungleiche Vermögensverteilung in der kapitalistischen Gesellschaft nicht zurückzuführen auf die bloße Existenz von individuellen Eigentumsrechten. Vielmehr spiegele sich in ihr das Ergebnis einer über Jahrhunderte währenden Entwicklung wider. Ungleichheit begründe sich entscheidend auf der ursprünglichen Landnahme von Entdeckern und Eroberern, wobei Landbesitzer zu Kapitalisten und abhängige Bauern zu Proletariern geworden seien. Das spezifische Charakteristikum des Grundeigentums habe es dabei erlaubt, dass Land im Unterschied zu den anderen natürlichen Ressourcen Wasser, Luft und Licht besessen werden konnte. Mit diesem zunächst physischen Vorgang habe ein Teil der von Green beschriebenen Eigentumsgenerierung – nämlich die Aneignung – erfolgen können, auf deren Grundlage sich dann die Anerkennung durch die Gesellschaft entwickelt habe. Der Boden wurde damit als erste, ursprünglich freie Ressource zu einem knappen Gut, über das individuelle Eigentumsrechte beansprucht werden konnten (vgl. PETERSEN/MÜLLER, 1999, S. 133).
Im beginnenden 20. Jahrhundert wurde diese Sichtweise noch einmal deutlich von Thorstein VEBLEN (1923) herausgearbeitet, der ein geistiger Vater des Institutionalismus und der Institutionenökonomik ist. Die Vermögensverteilung in der kapitalistischen Gesellschaft sei, so Veblen, maßgeblich von einer verliehenen Eigentumsvergabe (tenure by prescription) bestimmt, mit der über die ursprünglichen natürlichen Ressourcen verfügt worden sei. Diese Eigentumsvergabe beruhe auf keinem der in der Theorie diskutierten Grundsätze des Eigentumserwerbs und könne weder mit dem Prinzip der Arbeit (principle of workmanship) noch mit nutzentheoretischen Überlegungen, also Mills ökonomischem Maßstab, gerechtfertigt werden – die Eigentümer dieser Dinge „own [them] ... because they own them“ (VEBLEN, 1923, S. 122). Vielmehr seien sie Ausdruck eines feudalen Systems von Privilegien, der Lehnsherrschaft und angestammter Rechtsbeziehungen, die im Endeffekt auf eine ursprüngliche gewaltsame Landnahme zurückgeführt werden könnten (vgl. VEBLEN, 1923, S. 121).
Anstatt also nach unzureichenden Begründungen und Legitimationsgrundlagen für das Eigentum zu suchen, sei es eher die Aufgabe des Staates, die tatsächlich bestehenden Besitzverhältnisse in formales Recht umzuwandeln. Veblen geht hierbei dezidiert auf die Situation von Landbesetzern (squatters) ein, deren Anspruch auf das Eigentum an einem Stück Land sich ebenfalls davon ableiten müsse, ob sie erfolgreich und unbestritten den Besitz eines Grundstückes für sich reklamieren könnten (vgl. VEBLEN, 1923, S. 122f.).
In der kapitalistischen Gesellschaft bildeten Eigentümer und Nutzer einer Sache nur noch selten eine Einheit, die durch die herkömmlichen Theorien impliziert wurde. Vielmehr sei jetzt die Eigentümerabstinenz (absenteeism) zu beobachten, also das Fernbleiben des Eigentümers vom Ort der eigentlichen Nutzung seines Eigentums. Dieses Auseinanderfallen von Eigentümer und Nutzer sei eine direkte Konsequenz der von Adam Smith eingeführten arbeitsteiligen Produktion, obgleich Smith in seiner Theorie noch von einer Einheit des Unternehmers, Arbeiters und Eigentümers ausgegangen war. Da Eigentum und tatsächlicher Besitz nur noch selten zusammenfielen, sei es in der industrialisierten Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, dass bestehende Eigentumsverhältnisse durch einen gesicherten und verbindlichen institutionellen Rahmen abgebildet würden (vgl. VEBLEN, 1923, S. 125).
4.1.5 Grenzen des liberalen Eigentumsbegriffes – die soziale Dimension
Vertreter eines liberalen Eigentumsbegriffes hatten es angesichts der gravierenden sozialen Probleme in den kapitalistischen Gesellschaften zunehmend schwerer, ihre Vision eines unbeschränkten und an keine Verpflichtung gebundenen Privateigentums aufrecht zu erhalten. Ohne die generellen Vorteile der Existenz von individuellen Eigentumsrechten in Frage zu stellen, da sie ein wichtiger Baustein für die wirtschaftliche Entwicklung der westlichen Industrienationen gewesen seien, fordert COHEN (1927, S. 165f.) eine soziale Komponente des Eigentums. Das Eigentumsrecht sollte mit der Verpflichtung verbunden werden, dieses in vorteilhafter Weise für die Gesellschaft einsetzen zu müssen.[22] Nicht zuletzt aus moralischen Gründen sollte Eigentum mit dem Allgemeinwohl verbunden sein – „[property needs] to serve the larger social need“ (ebd., S. 164). Im Grenzfall erlaube diese soziale Dimension des Eigentumsrechts dem Staat sogar den Einsatz des starken Instruments der Enteignung, falls dadurch die Gesamtwohlfahrt der Gesellschaft erhöht werden könne.
[...]
[1] Eigentum umfasst in der vorliegenden Arbeit sowohl Eigentums- als auch Verfügungsrechte über mobile und immobile Sachen, wobei das Immobiliar- bzw. Grundeigentum im Vordergrund steht.
[2] Unter dem Begriff der internationalen Entwicklungszusammenarbeit wird in erster Linie die Entwicklungspolitik zusammengefasst, die vom System der Vereinten Nationen (VN) ausgeht. Damit folgt die Arbeit der weitläufig geteilten Ansicht, die internationale Entwicklungszusammenarbeit eng an das VN-System sowie ihrer durch das Abkommen von Bretton Woods gebildeten Sonderorganisationen Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF) zu binden (vgl. FANZUN/LEHMANN, 2000, S. 253). Entwicklungspolitik kennzeichnet hierbei alle Maßnahmen, die auf eine Veränderung der wirtschaftlichen oder sozialen Lage der Entwicklungsländer abzielen. Der Begriff der Entwicklungshilfe ist hiervon insofern abzugrenzen, als er konkrete Maßnahmen und Hilfsprojekte als Untereinheit der Entwicklungspolitik beschreibt.
Auch die entwicklungspolitische Debatte um Reformen im Grundeigentumsbereich wird maßgeblich von VN-Organisationen bestimmt. Wie WILLIAMSON (2001) darstellt, erkläre sich die zentrale Bedeutung der VN für Entwicklungshilfe im Bereich des Grundeigentums aus der aktiven Rolle der Weltbank, die seit 30 Jahren auf diesem Politikfeld agieren würde. Andere wichtige, zumeist VN-Organisationen, seien die UN Food and Agriculture Organisation, die International Federation of Surveyors, die UN Regional Cartographic Conferences sowie die UN Economic Commission for Europe. Nationale Projekte, die über bilaterale Entwicklungshilfe eigentumsrechtliche Reformen verfolgen, hätten zwar ebenfalls Bedeutung, seien allerdings schwer zu vereinheitlichen und zudem schlecht dokumentiert (vgl. ebd., S. 303).
[3] Die Begriffe Entwicklungsland und Dritte Welt werden in dieser Arbeit als Synonyme verwendet. Ferner ist die Trennung von Entwicklungs- und Schwellenland stellenweise unscharf; da sich Entwicklungspolitik jedoch auf beide Länderkategorien ausstreckt, ist in erster Linie die Abgrenzung zu Industrieländern wichtig.
[4] Institutionen sind darüber hinaus nicht auf geschriebene Verhaltensregeln – im engeren Sinn Gesetze – beschränkt. Nach NORTH (1990, S. 3) spiegeln Institutionen die Spielregeln einer Gesellschaft wider, die jedoch nicht nur in ausdrücklichen Gesetzestexten, sondern ebenfalls in möglicherweise verdeckten Verhaltenskodexen und Wertemustern verankert sind. Um diese Unterscheidung zu verdeutlichen, wird die Arbeit von formalen Institutionen sprechen, wenn eine Institution durch den gesetzlichen oder organisatorischen Rahmen einer Gesellschaft gesichert ist, sowie den Begriff der informellen Institution verwenden, wenn die Regelung auf einem nicht-formalen Mechanismus basiert.
[5] Die klassische Entwicklungspolitik umfasst die von allen Industrieländern auf der Ebene politischer Handlungen zugunsten der Entwicklungsländer betriebene öffentliche Entwicklungshilfe. Diese enthält nach Definition des Ausschusses für Entwicklungshilfe der OECD Leistungen, die (i) unentgeltlich oder zinsgünstig mit einem Zuschuss oder Schenkungselement von mindestens 25 % an Partnerländer sowie regionale oder multilaterale Organisationen vergeben werden, (ii) die von öffentlichen bzw. staatlichen Stellen gewährt werden und die (iii) in erster Linie der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Hebung des Lebensstandards dienen, also Hilfsprojekte und -programme sowie Strukturanpassungshilfen.
[6] Ursprünglich bezeichnete der Begriff lediglich den kleinsten gemeinsamen Nenner der aus Washington von Weltbank und IWF betriebenen Entwicklungspolitik (vgl. WILLIAMSON, 1990). Erst durch die Popularisierung des Begriffes entstand die Gleichsetzung des Washingtoner Konsensus mit neoliberalen Reformmodellen der Entwicklungshilfe (vgl. WILLIAMSON, 2000, S. 255f.).
[7] Im Rahmen dieser Strukturanpassungsprogramme verbreiterte sich das Aufgabenfeld des IWF teilweise auf entwicklungspolitische Maßnahmen, so dass beide Bretton-Woods-Organisationen stärker zusammenrückten (vgl. MÜLLER, 1993, S. 82).
[8] Für eine ausführliche Diskussion der Probleme einer neoliberalen Entwicklungspolitik vgl. MESSNER/NUSCHELER, 2001, S. 408f.
[9] Als Ausgangspunkt für die Good-Governance-Debatte gilt das Jahr 1989. Eine Weltbankstudie über den Entwicklungsprozess in Sub-Sahara Afrika (WELTBANK, 1989a) machte auf die Wichtigkeit des politischen Umfelds für nachhaltig wirksame Entwicklungshilfe aufmerksam. Bis heute ist jedoch nicht eindeutig geklärt, was genau sich hinter dem Begriff der good governance verbirgt. Im Kern umfasst er die Forderung nach einer effizienten Staatsverwaltung, Transparenz und Informationszugang sowie rechtlichen Rahmenbedingungen für Entwicklung (vgl. FANZUN/LEHMANN, 2000, S. 261).
[10] Zur Abhängigkeit der Persistenz eines politischen Systems von der politischen Unterstützung vgl. EASTON, 1965, S. 84
[11] Weltentwicklungsbericht 1997: The State in a Changing World; 2000/01: Attacking Poverty; 2002: Building Institutions for Markets; 2002/03: Sustainable Development in a Dynamic Economy.
[12] Die Weltbank definiert die rule of law als ein auf formalem Recht basierendes System, wobei angenommen wird, dass (i) Gesetze im Voraus bekannt und (ii) diese in Kraft getreten sind, (iii) rechtliche Grundlagen für die Anwendung und mögliche Änderung der Gesetze existieren, über die (iv) im Konfliktfall durch ein verbindliches Urteil einer unabhängigen juristischen oder schlichtenden Institution entschieden wird und (v) bestimmte Vorgehensweisen vorhanden sind, um die Regeln an möglicherweise geänderte Anforderungen anzupassen (vgl. SHIHATA, 1997, S. 1579).
[13] Das verstärkte entwicklungspolitische Engagement im Bereich der Landverwaltung lässt sich u.a. erkennen an der Politik der Weltbank, die in den 1980er Jahren lediglich einige wenige, seit Anfang der 1990er Jahre hingegen jedes Jahr mehr als zehn neue Projekte zusätzlich förderte (zwischen 1988 und 1999 insgesamt 156 Projekte; 50 davon im engeren Bereich der Landformalisierung; vgl. BYAMUGISHA/ZAKOUT, 2000, S. 1).
[14] BECKERs (1981) ökonomische Theorie der Familie, in der familiäre Beziehungen ebenfalls aus einem rationalen Nutzenkalkül abgeleitet und erklärt werden, ist ein weiteres anschauliches Beispiel für den Versuch, den Analyserahmen der Mikroökonomik auf alle Gesellschaftsbereiche auszuweiten und somit seine Existenz zu rechtfertigen (vgl. BATES, 1995, S. 28).
[15] ARROW (1951) wies nach, dass selbst bei Existenz einer eindeutigen Präferenzordnung allein die Reihenfolge einer kollektiven Mehrheitsentscheidung über die Auswahl der Optionen entscheidet. Mit dieser Feststellung wird eine grundlegende Voraussetzung der neoklassischen Theorie, die Transitivität der Präferenzordnung, verletzt.
[16] Klassisches Beispiel hierfür ist die hohe Wahlbeteiligung in Demokratien, obgleich die Entscheidung, an einer Wahl teilzunehmen, angesichts der damit verbundenen Kosten und der verschwindend kleinen Einflussmöglichkeiten für einen einzelnen Wähler im Grunde eine irrationale Handlung widerspiegelt.
[17] Zu unterscheiden ist die alte Institutionenökonomik, die einen umfassenden Einfluss von Institutionen auf allen Ebenen des menschlichen Lebens konstatiert, und der eher wirtschaftswissenschaftlich ausgerichteten neuen Institutionenökonomik, die im Grund das Modell der Neoklassik beibehält und dieses um den Einfluss von Transaktionskosten erweitert (vgl. STEIN, 1995, S. 109ff.).
[18] Unter diesem Begriff werden Hongkong, Singapur, Südkorea und Taiwan zusammengefasst (vgl. LANDES, 1990, S. 6). Eine ausgeweitete Liste beinhaltet zudem die Philippinen, Thailand, Indonesien, Südkorea und Malaysia.
[19] Immerhin bedeutete dies, dass wesentliche Einflussfaktoren, die das soziokulturelle Leben in Entwicklungsländern bestimmen, (fremd-) gesteuert würden.
[20] Mit der Einschränkung, dass auch eine materielle Vermögensanhäufung in Form von Geld nur insoweit mit den Naturgesetzen vereinbar ist, als es jeder Person die Sicherstellung der eigenen Lebensgrundlage ermöglicht (vgl. DRUWE, 1995, S. 146).
[21] Das deutsche Eigentumsrecht sieht z.B. einen Eigentumsübergang vor durch die Verarbeitung oder Umbildung eines Gegenstandes in eine neue Sache (vgl. BGB, 2001, 48 Aufl., § 950)
[22] Diese Auffassung setzte sich u.a. im Deutschen Grundgesetz mit einer Sozialbindung des Eigentums fort. Der generelle Schutz des Eigentums wird zwar durch das Grundgesetz zugesichert (Art. 14, Abs. 1), gleichzeitig wird jedoch festgelegt, dass Eigentum verpflichtet (ebd., Abs. 2). Wie RODRIK (1999, S. 6) erklärt, würden alle Gesellschaften anerkennen, dass Eigentumsrechte für das Allgemeinwohl eingeschränkt werden könnten; lediglich das Ausmaß der Einschränkung sei international verschieden.
Details
- Titel
- Die Institution Eigentum und wirtschaftliche Entwicklung
- Untertitel
- Eigentumsformalisierung als entwicklungspolitische Chance
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 107
- Katalognummer
- V222151
- ISBN (eBook)
- 9783832467982
- ISBN (Buch)
- 9783838667980
- Dateigröße
- 932 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- entwicklungszusammenarbeit institutionelle reform institutionenökonomik weltbank nachhaltigkeit
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2003, Die Institution Eigentum und wirtschaftliche Entwicklung, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/222151

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.