Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos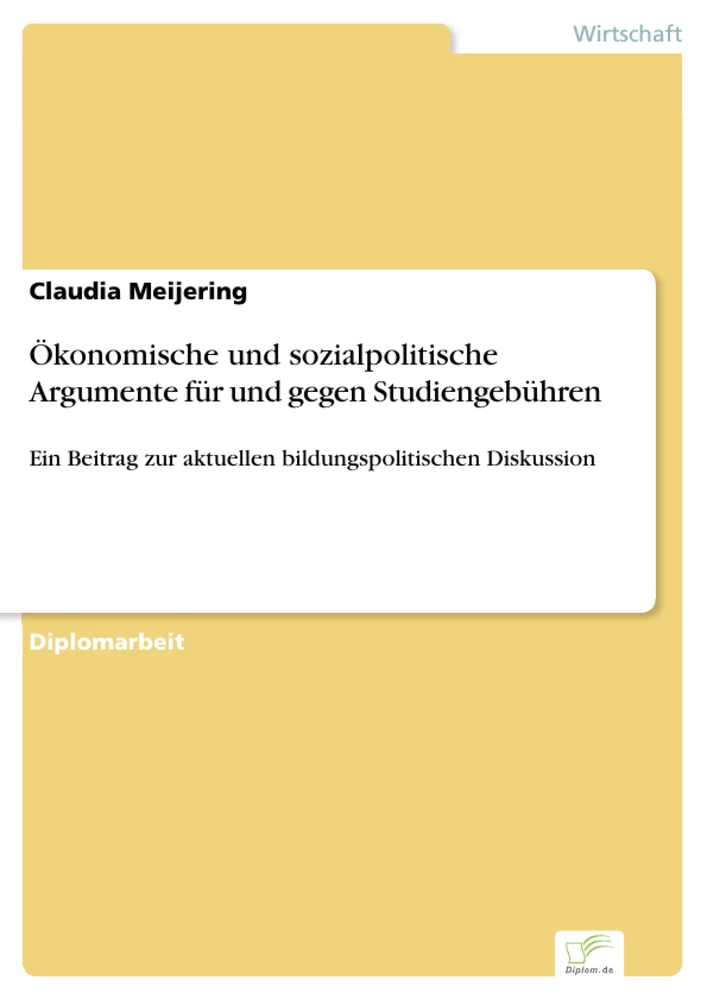
Ökonomische und sozialpolitische Argumente für und gegen Studiengebühren
Diplomarbeit, 2003, 136 Seiten
Autor

Kategorie
Diplomarbeit
Institution / Hochschule
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Betriebswirtschaftslehre)
Note
1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Ausgangslage
2.1 Geschichtliche Entwicklung des deutschen Hochschulwesens
2.2 Bildungspolitische Diskussion zum Thema Studiengebühren
2.3 Studiengebühren in der BRD
2.4 Finanzierung des Hochschulwesens
2.4.1 Ausgaben im Hochschulwesen nach Mittelherkunft
2.4.2 Entwicklung der Studierendenzahlen
2.4.3 Kosten eines Studiums
2.4.4 Anteil von Studiengebühren am Hochschuletat
3 Ökonomische Argumente für und gegen Studiengebühren
3.1 Effizienztheoretische und verteilungspolitische Ansätze
3.2 Allokatives Marktversagen im staatlichen Hochschulsystem
3.2.1 Öffentliche Güter
3.2.2 Monopolistische Situation und sinkende Durchschnittskosten
3.2.3 Informationsproblematiken
3.2.4 Externe Effekte
3.2.5 Zur Theorie des Marktversagens und der meritorischen Güter
3.3 Hochschulbildung als Investition
3.3.1 Humankapitaltheorie und weitere theoretische Ansätze zur Erklärung von Bildungsentscheidungen
3.3.2 Übertragung der Humankapitaltheorie auf die Hochschulbildung
3.4 Rendite einer Hochschulausbildung
3.5 Fazit
4 Umverteilungsaspekte von Studiengebühren
4.1 Studie von Grüske
4.1.1 Untersuchung im Querschnitt
4.1.2 Untersuchung im Längsschnitt
4.2 Weitere Untersuchungen
4.2.1 Querschnittsanalyse von Hellberger
4.2.2 Längsschnittuntersuchung von Weißhuhn
4.3 Fazit
5 Rahmenbedingungen für Studiengebühren
6 Zusammenfassende Betrachtung
Anhang
Literaturverzeichnis
Versicherung
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Ausgaben der Hochschule für Lehre und Forschung
Tab. 2: Ausgaben (Grundmittel) im Hochschulwesen von Bund und Ländern 1995-1999
Tab. 3: Ausgaben (Grundmittel) von Bund und Ländern 1995-1999 für den Hochschulbereich
Tab. 4: Vollkosten eines Hochschulstudiums je Studierenden und Jahr nach Fächergruppen; Berechnungsjahr 1994
Tab. 5: Privater Finanzierungsanteil und Finanzierungsanteil der öffentlichen Hand an den Vollkosten eines Hochschulstudiums je Studierenden und Jahr nach Fächergruppen; Berechnungsjahr 1994
Tab. 6: Forschungs-, Entwicklungs- und Lehrekoeffizienten
Tab. 7: Kosten und Nutzen der Hochschulausbildung
Tab. 8: Durchschnittliche private Renditen unterschiedlicher Bildungsabschlüsse für den Zeitraum 1984-1997
Tab. 9: Umverteilungswirkungen zwischen unterschiedlichen Einkommensklassen
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Ausgaben für Lehre und Forschung im Hochschulwesen je Studierenden
Abb. 2: Laufende Grundmittel der Hochschulen nach Fächergruppen in 1998
Abb. 3: Laufende Ausgaben (Grundmittel) für Lehre und Forschung an Hochschulen je Studierenden nach Fächergruppen und Hochschularten in 1998
Abb. 4: Anzahl der Studienanfänger, Studierenden und Hochschulabsolventen
Abb. 5: Studienberechtigten-, Studienanfänger-, Studierenden- und Hochschulabsolventenquote [%]
Abb. 6: Vollkosten eines Hochschulstudiums je Studierenden und Jahr; Berechnungsjahr 1994
Abb. 7: Grundmittel (laufende Grundmittel und Investitionsausgaben) für Lehre und Forschung je Studierenden nach Fächergruppen in 1998
Abb. 8: Grundmittel-Ausgaben für den Bereich Lehre je Studierenden (bzw. Ausbildungskosten je Studierenden) nach Fächergruppen für das Jahr 1998
Abb. 9: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquote in Deutschland
Abb. 10: Relativierte Nettovorteile je Akademiker im Längsschnitt
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Im Vergleich zur Reformbewegung Ende der 60er Jahre, wo die Hochschulorganisation und Hochschulverfassung im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte standen, sind es gegenwärtig die Leistungs- und Innovationsfähigkeit sowie die internationale Wettbewerbsfähigkeit in Forschung und Lehre, die das deutsche Hochschulsystem vor neue Herausforderungen stellt.
Ungeachtet dessen, dass der gesellschaftliche Stellenwert von Bildung und Ausbildung in der öffentlichen Diskussion nicht in Frage gestellt wird, führen die wachsenden Anforderungen der Hochschulen einerseits und die zunehmend begrenzten Haushaltsmittel andererseits, zu einer Auseinandersetzung zwischen den Hochschulen, der Öffentlichkeit und den für die Hochschulfinanzierung zuständigen Ministerien über die finanzielle und personelle Ausstattung der Hochschulen. In diesem Kontext wird wiederholt auf die im internationalen Vergleich geringen öffentlichen Hochschulausgaben in Deutschland hingewiesen. So belegte Deutschland im Jahr 1998 mit einem Anteil von 0,97% der öffentlichen Bildungsausgaben im Tertiärbereich als Anteil am Bruttoinlandsprodukt nur den siebzehnten Platz im OECD-Ländervergleich.[1]
Die fehlenden Finanzmittel der Hochschulen haben eine Diskussion über Formen und Verfahren der Hochschulfinanzierung ausgelöst. Es werden zunehmend Finanzierungskonzepte gefordert, die auf die Erschließung zusätzlicher Finanzierungsquellen abzielen oder das vorhandene Bildungsbudget effizienter nutzen. In der Debatte um die effizientere Nutzung der gegebenen Ressourcen stehen Konzepte wie Globalhaushalt oder Budgetierung im Vordergrund. Zusätzliche Einnahmequellen der Hochschulen ergeben sich durch Stiftungen, Sponsoring, die Einwerbung von Drittmitteln sowie durch Einnahmen aus Dienstleistungen und Weiterbildung. Darüber hinaus wird im Kontext der Gewinnung neuer Finanzierungsquellen zunehmend die Gebührenfreiheit an deutschen Hochschulen zur Disposition gestellt.
Die Studiengebührendebatte wird aber auch vor dem Hintergrund geführt, dass Anreizstrukturen für eine zielgerichtete Studienwahl und ein effektives Studium nicht in ausreichendem Maße im deutschen Hochschulsystem verankert sind. Die Forderung nach effektiver Studienorganisation nimmt in der hochschulpolitischen Debatte und auf dem Arbeitsmarkt jedoch ebenso einen zentralen Stellenwert ein.
Im Spannungsfeld der Studiengebührendiskussion sind nicht nur effizienztheoretische Argumente von Bedeutung, sondern auch Verteilungskonflikte, Chancengleichheit sowie die rückläufige Studierneigung und der steigende Akademikerbedarf. So lag 1999 die Studienanfängerquote in Deutschland nur bei 28% und damit im internationalen Vergleich deutlich unter dem OECD-Ländermittel von 45%[2] Das durch Bildung angeeignete Humankapital ist jedoch einer der wesentlichen Standortfaktoren der Hochlohnvolkswirtschaften.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit sollen vor allem ökonomische und sozialpolitische Argumente für und gegen Studiengebühren diskutiert werden. Dieser Diskussion soll eine Beschreibung der Ausgangslage an die Seite gestellt werden, die die geschichtliche Entwicklung des deutschen Hochschulsystems, die bildungspolitische Studiengebührendebatte, die aktuellen Studiengebührenregelungen auf Bundes- und Länderebene sowie die Finanzierung des Hochschulwesens beinhaltet. Die Arbeit soll darüber hinaus mögliche Ausgestaltungen von Studiengebühren erörtern.
2 Ausgangslage
2.1 Geschichtliche Entwicklung des deutschen Hochschulwesens
Neben der mittelalterlichen Gründungszeit wurde die Entwicklung der deutschen Universitäten Anfang des 19. Jahrhunderts nachhaltig durch die neuhumanistische Universitätsreform geprägt, die einhergeht mit der Gründung der Universität Berlin in 1809/1810 und eng mit dem Namen Wilhelm von Humboldts verbunden ist.[3] Eine weitreichende Autonomie, die Selbstverwaltung durch die Ordinarien, die Betonung einer von allen unmittelbaren gesellschaftlichen Interessen freien Forschung sowie die Abgrenzung der universitären Bildung sowohl von der schulischen Unterrichtsform als auch von der beruflichen Praxis sind die kennzeichnenden Postulate der Humboltschen Universitätskonzeption.[4]
In Folge der Erneuerung des Universitätswesens um 1810 stieg die Zahl der Studierenden, die vor 1800 mit etwa 5.600 Studierenden einen Tiefstand erreicht hatte, auf etwa 15.000 in 1830 an.[5] Bis 1835 verursachte Wirtschaftskrise und Restaurationspolitik erneut einen Rückgang der Studierenden auf 12.000. Die in den nachfolgenden Jahren zu beobachtende Stagnation der Zahl der Studierenden wurde erst mit der Gründung des Deutschen Reiches in 1871 beendet. So wurde im Jahr 1872 mit 15.000 Studierenden wieder der Stand von 1830/31 erreicht. Die Zahl der Immatrikulierten an Universitäten und Technischen Hochschulen lag 1880/81 bei ca. 26.000, 1890/91 bei ca. 35.000, 1900/01 bei ca. 50.000 und 1913/14 bei ca. 75.000.[6]
Der kontinuierliche Anstieg der Studierenden endete mit dem Ersten Weltkrieg. Während im Jahr 1916 nur noch 17.000 Studierende gezählt werden konnten, stieg nach Ende des Ersten Weltkriegs die Zahl der Studierenden sprunghaft an. 1919/20 studierten an deutschen Universitäten und Technischen Hochschulen ca. 110.000 Studierende. Bis zum Ende der Weimarer Republik (1918-1933) reduzierte sich diese Zahl auf 80.000, um in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945) auf 58.000 zu sinken.[7]
Inhaltlich wurde nach dem Zweiten Weltkrieg an die Universitätsstruktur Humboltscher Prägung angeknüpft und die Autonomie der Universitäten wiederhergestellt, die von den Ordinarien getragene Selbstverwaltung gestärkt und der Lehr- und Forschungsbetrieb wieder aufgenommen. Die Kulturhoheit, d.h. die volle Kompetenz für den gesamten Bereich des Bildungswesens und damit auch des Hochschulwesens lag im föderativen Staatssystem der 1949 gegründeten BRD bei den Bundesländern.
Im Jahr 1949 gab es insgesamt 19 Universitäten und sieben Technische Hochschulen an denen im Jahr 1950 ca. 110.000 Studierende immatrikuliert waren. Die Zahl der Immatrikulierten stieg bis 1960 auf 215.000 und bis 1967 auf 257.000 an. Die Studienkosten betrugen damals ca. 20.000 DM jährlich und wurden von fast zwei Drittel der Studierenden durch Zuwendungen der Eltern, von einem Siebtel der Studierenden durch Erwerbstätigkeit und von einem weiteren Siebtel durch Studienförderung nach dem „Honneffer-Modell“ (seit 1957) finanziert.[8]
Die Studierendenzahlen stiegen in den Folgejahren kontinuierlich an. Im Jahr 1970 wurden 410.000 Immatrikulierte gezählt, 680.000 im Jahr 1977 und 855.000 im Jahr 1980/81. Die Zahl der Studierenden überschritt erstmals im Jahr 1984 die Millionengrenze und stieg bis 1988/89 auf 1.470.000 an.[9] Während 1950 etwa 4% eines Altersjahrganges ein Studium begannen waren es 1960 bereits 8%, 1970 im nun durch Fachhochschulen erweiterten Hochschulsystem 15%, 1980 insgesamt 20% und 1990 ca. 25%. In absoluten Zahlen wurde dieser Trend durch die geburtenstarken Jahrgänge der 70er und 80er Jahre sowie die gestiegene Fachstudiendauer quantitativ verstärkt.[10]
Die von den staatlichen Haushalten geleisteten Gesamt-Hochschulausgaben beliefen sich im Haushaltsjahr 1970 auf ca. 7,9 Mrd. DM, in 1980 auf ca. 17,9 Mrd. DM und in 1987 auf ca. 26 Mrd. DM. Damit stiegen die Hochschulausgaben im Zeitraum 1970 bis 1987 um rd. 70 %. Dies entspricht in Etwa der prozentualen Steigerungsrate der Zahl der Studierenden im Vergleichszeitraum.[11]
Die hohe Steigerungsrate Zahl der Studierenden sowie der gestiegene Finanzierungsbedarf der Hochschulen führte zu einer Beteiligung des Bundes an der Finanzierung und Gestaltung des Hochschulwesens und der Forschungsförderung. Die rechtliche Basis für die Beteiligung des Bundes an den Aufgaben der Bildungsplanung und einer Mitverantwortung insbesondere für den Hochschulbau wurde 1969 durch eine Grundgesetzänderung gelegt.[12] Ein einheitlicher länderübergreifender gesetzlicher Rahmen für das Hochschulwesen wurde erstmalig mit dem Hochschulrahmengesetz (HRG) geschaffen, das 1976 in Kraft trat.[13]
Trotz der Überlast im Hochschulwesen haben 1977 die Regierungschefs von Bund und Ländern zusammen mit den Hochschulen beschlossen, den Hochschulzugang ungeachtet unzureichender personeller und räumlicher Kapazitäten prinzipiell offen zu halten. Dieser Öffnungsbeschluss wurde 1989 zwar von der Hochschulrektorenkonferenz aufgekündigt, jedoch von den Regierungschefs bestätigt.[14] Eingeschränkt wurde die Studienwahlfreiheit lediglich (in einigen Studiengängen) durch die Einführung des Numerus Clausus im Jahr 1972.
Die in den 70er Jahren von allen Parteien und der Gesellschaft getragene soziale Öffnung der Hochschulen steht in einem funktionalen Zusammenhang zur Abschaffung der Studiengebühren, die bis 1970 in der BRD erhoben wurden. Die Erhebung der Studiengebühren erfolgte bis Ende der 60er Jahre mehrheitlich in Form sogenannter Hörergelder, die im Mittel zwischen 250 und 300 DM je Semester lagen.[15]
2.2 Bildungspolitische Diskussion zum Thema Studiengebühren
Bis Anfang der 80er Jahre waren Studiengebühren nicht Gegenstand der politischen und hochschulpolitischen Diskussion. Dies änderte sich durch den Machtwechsel und die Bildung der konservativ-liberalen Bundesregierung 1982/1983. Einen ersten Vorstoß unternahm das damalige Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft im Jahr 1983 indem es verkündete, die Möglichkeit der Einführung von Studiengebühren zu prüfen. Die Idee der Einführung von Studiengebühren wurde seitens der Bundesregierung aufgrund mangelnder politischer Durchsetzbarkeit jedoch wieder verworfen.[16]
Eine weitere wesentliche Station in der angestoßenen Studiengebührendebatte waren die im Jahr 1985 vom Wissenschaftsrat (WR) herausgegebenen "Empfehlungen zum Wettbewerb im deutschen Hochschulsystem".[17] In diesen Empfehlungen spricht sich der Wissenschaftsrat indirekt für Studiengebühren aus, indem die Studiengebührenfreiheit als strukturelles Hindernis des deutschen Hochschulsystems dargestellt wird.[18] Der Wissenschaftsrat plädierte in der Folgezeit immer wieder -mehr oder weniger- deutlich für die Abschaffung der Gebührenfreiheit. So thematisieren die im Jahr 1993 veröffentlichten „10 Thesen zur Hochschulpolitik“ des Wissenschaftsrates zwar nicht die Einführung von Studiengebühren, jedoch enthielt eine durch Indiskretion veröffentlichte Rohfassung eine elfte These, die die Einführung von Studiengebühren empfahl. Diese elfte These entsprach dem Votum der Wissenschaftsvertreter im Wissenschaftsrat und wurde aufgrund eines Vetos der politischen Vertreter im Rat gestrichen.[19]
Die Einführung von Studiengebühren wird seit Anfang der 90er Jahre zunehmend im Kontext einer Verkürzung der Studienzeiten diskutiert. So veröffentlichte im Jahr 1992 eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und der Kultusministerkonferenz (KMK) „Vorschläge zur Verkürzung der Studienzeiten“[20], in denen die Einführung von Studiengebühren beim Überschreiten einer bestimmten Studiendauer als wirksames Mittel empfohlen wird. Auf dem 177. Plenum der HRK im November 1995 war die Einführung von Studiengebühren Gegenstand einer kontroversen Diskussion.[21] Ein Beschluss des 177. Plenums der HRK zum Thema Studiengebühren wurde jedoch nicht gefasst, obwohl sich eine knappe Mehrheit der Rektoren in diesem Plenum für Studiengebühren ausgesprochen haben soll.[22]
Zum Wintersemester (WS) 1997/1998 wurden die „Vorschläge zur Verkürzung der Studienzeiten“ von HRK und KMK erstmalig in Baden-Württemberg durch die Einführung von Studiengebühren für Langzeitstudierende umgesetzt. Ein Jahr zuvor hat bereits Berlin eine sog. Verwaltungsgebühr eingeführt, die erstmalig zum WS 1996/1997 von allen Studierenden unabhängig von der Semesterzahl erhoben wurde. Eine derartige Verwaltungsgebühr, die in keinem Verhältnis zu den tatsächlich anfallenden Verwaltungsgebühren bei der Rückmeldung liegt, wird insbesondere von den Studierenden als Studiengebühr betrachtet. Dem Vorbild Berlins und Baden-Württembergs folgten weitere Bundesländer.[23]
Auf Länderebene ist die Vorstellung des Studienkonten-Modells des rheinland-pfälzischen Bildungsministers Zöllner im Januar 2000 eine weitere wesentliche Station in der Studiengebührendebatte.[24] Im November 2001 wurde aus den Bildungsministerien der Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gemeinsam verkündet, dass die Einführung des Studienkonten-Modells spätestens ab 2004 erfolgen soll.[25]
Ferner hat auf Länderebene im Mai 2000 die KMK in seiner 290. Plenarsitzung einen Beschluss zur Gebührenfreiheit des Hochschulstudiums gefasst.[26] Dieser Beschluss sichert die Gebührenfreiheit bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss an Hochschulen und bei konsekutiven Studiengängen bis zum zweiten berufsqualifizierenden Abschluss. Des Weiteren beinhaltet der Beschluss die Einrichtung von Guthaben mit einer definierten Anzahl von Semestern oder Studienkonten, die in Form von Semesterwochenstunden vergeben werden. Mit der Aufnahme der Studienkonten in Form von Semesterwochenstunden hat die KMK das Studienkonten-Modell von Zöllner aufgegriffen. Bei Überschreitung der Studienguthaben bzw. Studienkonten sollen die Länder die Möglichkeit haben, Studiengebühren zu erheben. Die Grundsätze des KMK-Beschlusses wurden den Ministerpräsidenten mit der Bitte um Bestätigung vorgelegt. Die angestrebte Einigung auf der Ebene der Ministerpräsidenten konnte jedoch nicht erzielt werden.
Auf Bundesebene wurde bereits kurz nach dem Regierungswechsel 1998 von der neuen Bundesministerin für Bildung und Forschung angekündigt, die Erhebung von Studiengebühren auszuschließen.[27] Umgesetzt wurde dies ansatzweise mit dem sechsten Gesetz zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes (6. HRGÄndG) vom 08. August 2002.[28] Dieses Gesetz sieht u.a. die Ergänzung des § 27 (Allgemeine Voraussetzungen) des Hochschulrahmengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Januar 1999 um folgenden Absatz vor:
„(4) Das Studium bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss und das Studium in einem konsekutiven Studiengang, der zu einem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss führt, ist studiengebührenfrei. In besonderen Fällen kann das Landesrecht Ausnahmen vorsehen.“
Der Bundesrat hat sich zuvor im Plenum am 21. Juni 2002 gegen das 6. HRGÄndG ausgesprochen, nachdem die von den unionsregierten Ländern geforderten Änderungen im Vermittlungsausschuss keine Berücksichtigung gefunden haben.[29] In diesem Zusammenhang haben die unionsregierten Länder eine Klage vor dem Verfassungsgericht angekündigt. Die Klage soll sich vor allem darauf stützen, dass die Bildungspolitik vornehmlich Ländersache ist und der Bund durch die Verabschiedung dieses Gesetzes seine Kompetenzen überschritten hat. Der Einspruch des Bundesrates wurde endgültig durch den Beschluss des 6. HRGÄndG durch den Bundestag am 04.07.2002 zurückgewiesen.[30] Das 6. HRGÄndG trat mit der Veröffentlichung im Gesetzesblatt am 15.08.2002 in Kraft.
Neben den unionsregierten Ländern wird das bundesweite Verbot für Studiengebühren bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss bzw. für ein Studium in einem konsekutiven Studiengang, der zu einem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss führt, auch von der HRK abgelehnt. Der Präsident der HRK sieht keinen Bedarf für ein solches Gesetz und vertritt ebenso, wie die unionsregierten Länder die Meinung, dass der Bund mit diesem Gesetz seine Regelungskompetenzen überschritten hat und Studiengebühren alleinige Ländersache sind.[31]
Die öffentliche Sachverständigen-Anhörung zu den Entwürfen des 6. HRGÄndG im Bundestag am 17.04.2002 ergab ein differenziertes Meinungsbild.[32] Während die Vertreter der Gewerkschaften und Studierenden die Studiengebührenfreiheit überwiegend begrüßten, lehnten die Professoren diese mehrheitlich ab. Kritik gegen das 6. HRGÄndG wurde auch von den Befürwortern des bundesweiten Studiengebührenverbots geäußert. Die Kritik zielt darauf ab, dass das Gesetz nicht weit genug geht.[33] Zwar sieht das Gesetz grundsätzlich die Gebührenfreiheit bis zum ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss vor, enthält aber gleichzeitig eine Öffnungsklausel für die Bundesländer[34], die in besonderen Fällen Ausnahmen ausdrücklich zulässt. Mit dieser Öffnungsklausel lassen sich Langzeitstudiengebühren, Zweitstudiengebühren, Einschreibe- und Prüfungsgebühren ebenso legitimieren wie Gebühren für Gasthörer und Senioren. Ferner gilt das rahmenrechtliche Studiengebührenverbot nicht unmittelbar, sondern muss erst innerhalb einer dreijährigen Frist von den Ländern in Landesrecht umgesetzt werden.
Die Studiengebührendebatte wird überwiegend auf (hochschul)politischer und gesellschaftlicher Ebene geführt. Aus den Unternehmen in Deutschland ist hingegen die Forderung nach Studiengebühren weniger zu vernehmen. So wurden die deutschen Unternehmen vom Institut der deutschen Wirtschaft aufgefordert, den Handlungsbedarf im Hochschulwesen auf einer Skala von +100 (sehr notwenig) bis -100 (gar nicht notwendig) einzustufen. Während die Reform der Lehrerausbildung (+68) und der Ausbau der der Fachhochschulen (+ 29) als notwendig eingestuft wurden, traf dies für die Einführung von Studiengebühren (-3) nicht zu.[35]
2.3 Studiengebühren in der BRD
Als erstes Bundesland hat Baden-Württemberg an den staatlichen Hochschulen und Berufsakademien zum WS 1997/98 Studiengebühren eingeführt. Die rechtliche Grundlage bildet das Landeshochschulgebührengesetz (LHGebG) vom 05. Mai 1997.[36] Die Studiengebühren betragen 511 € je Semester und gelten grundsätzlich für alle Studierende ab dem ersten Semester. Den Studierenden werden jedoch sog. Bildungsguthaben für die Dauer der Regelstudienzeit zuzüglich vier Semester zur Verfügung gestellt. Die Studiengebühren werden erst fällig, wenn das Bildungsguthaben aufgebraucht wurde. Faktisch sind von den Studiengebühren daher nur Langezeitstudierende und Studierende im Zweitstudium (sofern sie über kein Bildungsguthaben mehr aus dem Erststudium verfügen) betroffen. Die Einnahmen aus den Studiengebühren stehen den Hochschulen als zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung. Des Weiteren wird an den staatlichen Hochschulen und Berufsakademien in Baden-Württemberg von allen Studierenden je Semester eine Immatrikulations- oder Rückmeldegebühr (sog. Verwaltungsgebühr) erhoben.[37]
Der Einzug diese Verwaltungsgebühr in Höhe von 51 € ist derzeit aufgrund eines schwebenden Normenkontrollverfahrens ausgesetzt. Die Erhebung einer Studiengebühr für Langzeitstudierende ist hingegen gemäß einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts mit dem Grundrecht des Art. 12 Abs. 1 GG auf freie Wahl der Ausbildungsstätte vereinbar und verstößt somit nicht gegen höherrangiges, insbesondere nicht gegen Bundesverfassungsrecht.[38] Das Bundesverwaltungsgericht führt in seinem Urteil aus, dass das Anliegen des Gesetzgebers ein zeitlich unbegrenztes Studium auf Kosten des Steuerzahlers nicht mehr zuzulassen, verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. Der Gang zum Bundesverfassungsgericht steht noch aus.
In Hamburg sieht der Entwurf eines neuen Hochschulgesetzes die Einführung von Studiengebühren für Langzeitstudierende vor.[39] Entsprechend dem Modell in Baden-Württemberg erhält jeder Studierende ein Studienguthaben in Höhe der Regelstudienzeit plus vier Semester. Sobald das Studienguthaben verbraucht ist, sollen Gebühren in Höhe von 500 € pro Semester erhoben werden (sog. Langzeitstudiengebühren). Die eingenommenen Gebühren verbleiben bei den Hochschulen und sind in dem Bereich Lehre und Studium zu verausgaben. Die Langzeitstudiengebühren sollen erstmals zum Wintersemester 2003/04 erhoben werden.
Das Land Niedersachsen hat ebenfalls nach dem Vorbild Baden-Württembergs Studienguthaben in Höhe der Semesterzahl der Regelstudienzeit eines grundständigen Studiengangs zuzüglich vier weiterer Semester eingeführt.[40] Nach Verbrauch des Studienguthabens werden Studiengebühren in Höhe von 500 € je Semester bzw. in Höhe von 333 € je Trimester fällig. Von diesen Gebühreneinnahmen werden den Hochschulen jährlich 500.000 € zur Verfügung gestellt. In Abweichung zu Baden-Württemberg verfügen die Studierenden bei Master-, Aufbau-, Zusatz- oder Ergänzungsstudiengängen jedoch über ein zusätzliches Studienguthaben in Höhe der jeweiligen Regelstudienzeit. Darüber hinaus erhebt das Land Niedersachsen einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 50 € je Semester bzw. in Höhe von 33 € je Trimester.
Als weiteres Land hat Saarland nach dem Modell von Baden-Württemberg Studienguthaben eingeführt.[41] Die Höhe des Studienguthabens in Semestern ist abhängig von der Regelstudienzeit. Bei einer Regelstudienzeit von neun und mehr Semestern setzt sich das Studienguthaben aus der Anzahl der Semester der Regelstudienzeit zuzüglich vier Semester zusammen. Die Hochschulen erheben sofern kein Studienguthaben mehr zur Verfügung steht, eine Studiengebühr in Höhe von 500 € pro Semester. Die Studiengebühren sind von Studierenden, die im WS 2001/2002 bereits an einer Hochschule immatrikuliert waren, erstmals für das WS 2003/2004 zu entrichten. Die eingenommenen Studiengebühren stehen den Hochschulen in voller Höhe zur Verfügung. Ferner eröffnet das Saarländische Hochschulgebührengesetz den Hochschulen die Möglichkeit für postgraduale Studiengänge Gebühren zu erheben. Die Höhe dieser Gebühren richtet sich u.a. nach dem Aufwand der Hochschule.
In Nordrhein-Westfalen sollen Studienkonten nach dem Studienkontenmodell des Landes Rheinland-Pfalz eingerichtet werden (sog. Zöllner-Modell).[42] Zwar werden, wie in Niedersachsen, Baden-Württemberg, Hamburg und im Saarland bei Verbrauch der Studienguthaben semesterweise Gebühren erhoben, jedoch erfolgt die Berechnung der Studienguthaben nach anderen Kriterien und erstreckt sich auf maximal das doppelte der Regelstudienzeit. Bis zu Einrichtung der Studienkonten sollen ab dem Sommersemester (SS) 2003 Studiengebühren in Höhe von 650 € pro Semester erhoben[43], wenn die Regelstudienzeit um eine bestimmte Semesteranzahl überschritten wurde. In Studiengängen mit mindestens einer achtsemestrigen Regelstudienzeit sind Studiengebühren zu entrichten, wenn die Regelstudienzeit um mehr als vier Semester überschritten wurde. Ferner sollen ebenfalls zum SS 2003 erstmalig Studiengebühren in Höhe von 650 € je Semester für ein Zweitstudium erhoben. Die Zweitstudiengebühr bleibt von der Einführung des Studienkontenmodells unberührt. Die eingenommenen Gebühren fließen zunächst in den Landeshaushalt.
Gemäß Bayerischem Hochschulgesetz (BayHSchG) werden mit Ausnahme eines Zweitstudiums keine Studiengebühren erhoben.[44] Gebührenpflichtig sind grundsätzlich alle Studierenden, die bereits ein Hochschulstudium in der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen haben und in einem zweiten oder weiteren Studium eingeschrieben sind. Als Zweitstudium im Sinne der Gebührenverordnung gelten jedoch nicht Promotions-, Zusatz-, Ergänzungs-, Aufbau- und Masterstudiengänge. Die Gebühren für das Zweitstudium sind seit dem SS 1999 zu entrichten und können sich gemäß BayHSchG auf 400 bis 600 € je Semester belaufen. Derzeit sind im Zweitstudium 511 € je Semester zu entrichten. Mindestens 90% der eingenommenen Gebühren verbleiben im jeweiligen Hochschulhaushalt.
In Bremen werden derzeit keine Studien- oder Verwaltungsgebühren erhoben. Gemäß Bremischen Hochschulgesetz (BremHG) sind Studiengebühren für Studierende in einem Studium bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss und für ein Studium in einem konsekutiven Studiengang, der zu einem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss führt ausgeschlossen.[45] Jedoch eröffnet das Bremische Hochschulgesetz gemäß § 109 Abs. 3 die Möglichkeit, Zweitstudiengebühren zu erheben, wenn das Zweitstudium für den angestrebten Beruf weder gesetzlich vorgeschrieben noch tatsächlich notwendig ist.
Das erste berufsqualifizierende Studium ist in Sachsen unentgeltlich. Eine Regelung der Studiengebührenfreiheit im Sächsischen Hochschulgesetz (SächsHG) gibt es nicht.[46] Das SächsHG ermöglich den Hochschulen seit dem WS 197/98 für ein Zweitstudium eine Gebühr in Höhe von 307 € pro Semester zu erheben. Diese Gebühr kann jedoch erst erhoben werden, wenn die Regelstudienzeit zuzüglich vier Semester überschritten wurde. Ferner dürfen Gebühren für ein Zweitstudium nicht erhoben werden, wenn das Studium eine sinnvolle Ergänzung, Vertiefung oder Erweiterung des Erststudiums darstellt. Die Gebühren verbleiben bei den Hochschulen.
Berlin hat als erstes Bundesland die sog. Verwaltungsgebühr eingeführt, die bei der Immatrikulation und bei jeder Rückmeldung zu bezahlen ist. Die Verwaltungsgebühr in Höhe von 51 € je Semester ist seit dem WS 1996/1997 fällig und gesetzlich im Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) verankert.[47] Weitere Gebühren werden an Berliner Hochschulen nicht erhoben.[48] Die eingenommenen Gebühren stehen den Hochschulen nicht als zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung. Vielmehr wurden die Landeszuweisungen an die Hochschulen um die zu erwartenden Gebühreneinnahmen gekürzt.
Das Brandenburgische Hochschulgesetz (BbgHG) schließt Studiengebühren für ein Studium bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss und für ein Studium in einem konsekutiven Studiengang, der zu einem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss führt explizit aus.[49] Jedoch ist –wie in Berlin- bei der Immatrikulation und bei jeder Rückmeldung eine Gebühr in Höhe von 51 € zu entrichten. Die eingenommenen Mittel fließen in den Landeshaushalt.
Das Land Rheinland-Pfalz plant die Einführung eines Studienkontenmodells zum SS 2004.[50] Das Studienkonto ist mit einer bestimmten Anzahl von Semesterwochenstunden ausgestattet und kann sowohl für ein Erststudium als auch für anschließende Weiterbildungsmaßnahmen und postgraduale Studien genutzt werden. Studiengebühren in Höhe von etwa 350 € werden erhoben, wenn das Studienkonto verbraucht wurde. Bei Regelabbuchung wird den Studierenden ein gebührenfreies Erststudium bis zur zweifachen Regelstudienzeit ermöglicht. Im geltenden Universitätsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz finden sich keine Regelungen zu dem Bereich Studiengebühren, Studiengebührenfreiheit oder dem Studienkontenmodell.[51]
Keine Studien- oder Verwaltungsgebühren werden derzeit in Hessen und in Mecklenburg-Vorpommern erhoben. Jedoch wurde das im Hessischen Hochschulgesetz verankerte Studiengebührenverbot in der Neufassung des Hessischen Hochschulgesetzes gestrichen.[52] Das Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LHG M-V) schließt hingegen Gebühren bis zu einem ersten und bei gestuften Studiengängen bis zu einem zweiten berufsqualifizierenden Abschluss aus.[53]
In Sachsen-Anhalt ist gemäß Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (HSG-LSA) ein Studium, das einen berufsqualifizierenden Abschluss verleiht gebührenfrei.[54] Eine umfassende Gebührenfreiheit ist auch im Gesetz über die Hochschulen und Klinika im Lande Schleswig-Holstein (HSG) verankert.[55] Gemäß § 80 HSG werden für das Studium und die Hochschulprüfungen keine Gebühren erhoben. Ebenfalls ein weitreichendes Studiengebührenverbot ist im Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) festgeschrieben[56], dem entsprechend für Hochschulprüfungen und für staatliche Prüfungen Studiengebühren sowie Gebühren nicht erhoben werden. Eine Übersicht über die Studien- und Verwaltungsgebühren auf Länderebene enthält der Anhang 1.
2.4 Finanzierung des Hochschulwesens
2.4.1 Ausgaben im Hochschulwesen nach Mittelherkunft
Die Ausgaben der Hochschulen, die mit wenigen Ausnahmen staatliche Einrichtungen der Bundesländer sind, werden aus Grundmitteln[57], Drittmitteln und Verwaltungseinnahmen getätigt. Primär erfolgt die Finanzierung der Hochschule über die jeweiligen Landeshaushalte. Die Hochschulen legen Haushaltsanmeldungen für den jährlichen Haushaltsentwurf des zuständigen Kultus- bzw. Wissenschaftsministeriums vor. Im Anschluss führen die zuständigen Ministerien mit den Hochschulen Haushaltsverhandlungen und leiten den Haushaltsentwurf an das Finanzministerium weiter. Nach Haushaltsberatung und Beschlussfassung durch das jeweilige Landesparlament erhalten die Hochschulen ihre jährlichen Haushaltsmittel, gegliedert nach Haushaltstiteln mit entsprechenden Verwendungsrichtlinien zur Bewirtschaftung zugewiesen.
Das traditionelle Haushaltssystem der Hochschule, das in hohem Maße durch die staatliche Wissenschaftsadministration mitgesteuert wird, wurde zwischenzeitlich weitgehend durch Globalhaushalte abgelöst, die den Hochschulen eine eigenverantwortliche Mittelverwendung ermöglichen. Die Einführung der Globalhaushalte erfolgt vor dem Hintergrund einer stärkeren Finanzautonomie der Hochschulen und wird zum einen damit begründet, dass eine eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung eine zwingende Voraussetzung für einen effizienzsteigernden Wettbewerb zwischen den Hochschulen ist. Zum anderen wird davon ausgegangen, dass eine dezentrale Entscheidung über den Einsatz von Ressourcen zu einer effizienteren Mittelverwendung führt, da die Interessen der Betroffenen vor Ort besser berücksichtigt und die Entscheidungszeiträume verkürzt werden können. Im Hochschulbereich wurden inzwischen in fast allen Bundesländern Globalhaushalte flächendeckend eingeführt.[58]
Die Grundmittel setzen sich zusammen aus den laufenden Grundmitteln und den Investitionen. Die Grundmittelausstattung für laufende Ausgaben von Lehre und Forschung der Hochschulen werden über die Landeshaushalte finanziert, während größere Investitionen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte von den Ländern getragen werden.
Die Drittmittel umfassen Mittel der Forschungsförderung, die vom wissenschaftlichen Personal der Hochschule bei dritten Instanzen für die Durchführung von Forschungsprojekten eingeworben werden. Die öffentliche Forschungsförderung erfolgt überwiegend durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die zu 60% vom Bund und zu 40% von den Ländern finanziert wird. Weitere öffentliche Drittmittel fließen den Hochschulen über Forschungsaufträge der Fachressorts von Bund und Ländern zu. Ergänzt werden die öffentlichen Drittmittel durch private Drittmittel der Wirtschaft und aus Stiftungen.
Die sogenannten Verwaltungseinnahmen, die die Hochschulen selbst erwirtschaften, ergänzen die Grund- und Drittmittel. Die Verwaltungseinnahmen kommen überwiegend aus dem Bereich der Krankenversorgung. Ferner zählen zu den Verwaltungseinnahmen Entgelte für die Abgabe von Verbrauchsmitteln an Studierende, Einnahmen aus Veröffentlichungen, Vermietungen und Verpachtungen, Erlöse aus dem Verkauf von Erzeugnissen und Sachvermögen der Hochschule sowie Gebühren.[59] So zählten bzw. zählen die bis zu Beginn der 70er Jahre an den deutschen Hochschulen eingenommenen Studiengebühren bzw. Hörergelder ebenso zu den Verwaltungseinnahmen, wie die in Kapitel 2.3 aufgeführten Studien- und Verwaltungsgebühren.
Die Ausgaben für alle Hochschulen lagen im Jahr 1999 nominal bei 52,89 Mrd. DM (vgl. Tab. 1) und wurden zu 59,4% aus Grundmitteln, zu 31,0% aus Verwaltungseinnahmen und zu 9,6% aus Drittmitteln bestritten. Der mit 24,05 Mrd. DM größte Anteil der 52,89 Mrd. DM entfiel auf die Hochschulkliniken und die Fächergruppe Humanmedizin. Im Vergleich zu den Universitäten (ohne Medizin und Hochschulkliniken) wurden diese 24,05 Mrd. DM zu 65,1% aus Verwaltungseinnahmen, zu 29,4% aus Grundmitteln und zu 5,5% aus Drittmitteln bestritten. Damit erwirtschafteten die Hochschulkliniken im Jahr 1999 fast zwei Drittel ihres Finanzbedarfs. Für die Universitäten (ohne Medizin und Hochschulkliniken) wurden im Jahr 1999 insgesamt 22,53 Mrd. DM zur Verfügung gestellt, die sich zu 81,5% aus Grundmittel, zu 2,5% aus Verwaltungseinnahmen und zu 16,0% aus Drittmitteln ergeben. Auf die Fachhochschulen entfielen im Jahr 1999 insgesamt 5 Mrd. DM der 52,85 Mrd. DM, auf die Verwaltungsfachhochschulen 0,47 Mrd. DM und auf die Kunsthochschulen 0,84 Mrd. DM.[60]
Zu den Ausgaben für den Hochschulbereich lassen sich im weiteren Sinne auch die Aufwendungen für die Studierendenförderung zählen. Im Jahr 2002 wurde von Seiten der staatlichen Haushalte (Bund, Länder) für den Bereich der Studierendenförderung, der u.a. die staatliche Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und die Förderung von studentischen Wohnraum umfasst, insgesamt 1,55 Mrd. DM ausgegeben. Werden die Ausgaben für die Darlehensfinanzierung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, die nicht unmittelbar durch den Bund, sondern von der Deutschen Ausgleichsbank bereitgestellt werden hinzugezählt, erhöhen sich die Ausgaben für die staatliche Studienförderung um ca. 600 Mio. DM auf 2,15 Mrd. DM.[61]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten [62]
Tab. 1: Ausgaben der Hochschule für Lehre und Forschung
Quelle: Statistisches Bundesamt; WR (2000); WR (2002)
Ein geeigneter Indikator für die Höhe der finanziellen Aufwendungen der staatlichen Haushalte im Hochschulbereich sind die Grundmittel, da die Leistungen der Hochschule außerhalb der Lehre und Forschung (z.B. der Krankenversorgung) und für die Drittmittelforschung durch den Abzug von Zahlungen von staatlichen Bereich bzw. der unmittelbaren Einnahmen eliminiert werden.
Im Jahr 1999 haben Bund und Länder rund 33,2 Mrd. DM (Grundmittel) für den Hochschulbereich aufgewendet.[63] Damit erhöhten sich im Zeitraum 1995/1999 die Grundmittelausgaben von
31,7 Mrd. DM in 1995 auf 33,2 Mrd. DM in 1999 (vgl. Tab. 2). Der Ausgabenanteil des Bundes im Verhältnis zum Länderanteil hat sich im gleichen Zeitraum von 10,91% in 1995 auf 11,17% in 1999 erhöht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 2: Ausgaben (Grundmittel) im Hochschulwesen von Bund und Ländern 1995-1999
Quelle: Statistisches Bundesamt; BLK-Bildungsfinanzbericht 2000/2001 (2002)
Im Jahr 1995 hatten die für den Hochschulbereich zugewiesenen Grundmittel einen Anteil von 2,98% am staatlichen Gesamthaushalt. Dieser Anteil stieg bis 1999 kontinuierlich auf 3,35% an, während der für den Hochschulbereich bereitgestellte Anteil der Grundmittel am Bruttoinlandsprodukt (BIP) im gleichen Zeitraum von 0,90% in 1995 auf 0,86% in 1999 sank. Die staatlichen Ausgaben für die Grundmittel je Einwohner stiegen von 389 DM in 1995 auf 405 DM in 1999 und damit um 3,95 % (vgl. Tab. 3).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 3: Ausgaben (Grundmittel) von Bund und Ländern 1995-1999 für den Hochschulbereich
Quelle: Statistisches Bundesamt; BLK-Bildungsfinanzbericht 2000/2001 (2002)
Werden die in der Tabelle 1 aufgeführten Ausgaben für Lehre und Forschung der Hochschulen insgesamt -getrennt nach Ausgabenarten- auf die Zahl der Studierenden bezogen, ergeben sich die in der Abbildung 1 dargestellten Relationen. Die Ausgaben insgesamt stiegen im Zeitraum 1995/1999 von 26.313 DM je Studierenden in 1995 auf 28.726 DM je Studierenden in 1999. Dies entspricht einer Steigerung um 8,40%. Während im gleichen Zeitraum die Investitionen je Studierenden nur um 5,49 % und die laufenden Grundmittel je Studierenden nur um 5,27 % stiegen, verzeichneten die Drittmittel je Studierenden im Zeitraum 1995/1999 mit 19,93 % die höchste prozentuale Steigerungsrate.
Die staatlichen Ausgaben für Grundmittel für Lehre und Forschung im Hochschulbereich je Studierenden stiegen in den Jahren 1995 bis 1999 real um 5,31 % und nominal um 11,75%. Ursächlich für die nominelle Steigerungsrate sind die sinkenden Studierendenzahlen im angegebenen Zeitraum. Während die Grundmittel in den Jahren 1995-1999 nur um 4,47% nominal gestiegen sind, sanken die Studierendenzahlen um 4,52%.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Ausgaben für Lehre und Forschung im Hochschulwesen je Studierenden
Quelle: Statistisches Bundesamt (2001); eigene Berechnung[64]
Für die nachfolgenden Betrachtungen ist es von Bedeutung, wie sich die Grundmittel für Lehre und Forschung an Hochschulen auf die Ausgabenarten und die laufenden Grundmittel auf die Fächergruppen verteilen. Betrachtet wird das Rechnungsjahr 1998. Von den Ausgaben für Grundmittel entfielen 1998 rd. 61,32% auf die Personalausgaben, 27,03% auf die übrigen (Sach-)Ausgaben und 11,65% auf die Investitionen.[65] Die prozentuale Verteilung der laufenden Grundmittel in 1998 nach Fächergruppen stellt die Abbildung 2 dar. Auf den Bereich der Humanmedizin entfielen 45,2% der laufenden Grundmittel, auf die Zentralen Einrichtungen 18,2%, auf den Bereich der Mathematik/Naturwissenschaften 11,9% und auf die Ingenieurwissenschaften 9,9%. Einen Anteil von 5,9% haben die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an den laufenden Grundmittel und einen Anteil von 5% die Sprach- und Kulturwissenschaften. Die verbleibenden Fächergruppen haben einen Anteil von unter 2%.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Laufende Grundmittel der Hochschulen nach Fächergruppen in 1998
Quelle: Statistisches Bundesamt; BMBF (2001)
Werden die laufenden Grundmittel im Jahr 1998 ins Verhältnis zu den Studierendendaten des Wintersemesters 1998/1999 gesetzt ergeben sich die in der Abbildung 3 aufgeführten laufenden Ausgaben je Studierenden nach Fächergruppen. Die Studierenden wurden entsprechend ihrem ersten Studienfach den einzelnen Fächergruppen zugeordnet.[66] Die laufenden Grundmittel im Jahr 1998 betrugen für einen Studierenden der Humanmedizin 48.660 DM und waren damit mehr als doppelt so hoch, wie für die Studierenden der übrigen Fächergruppen. Bei einer Betrachtung der Universitäten folgen die Studierenden der Veterinärmedizin mit 23.260 DM je Studierenden und Jahr, die Studierenden der Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften mit 20.330 DM, die Studierenden der Mathematik und Naturwissenschaften mit 15.890 DM und die Studierenden der Ingenieurwissenschaften mit 14.730 DM. Die laufenden Grundmittel der verbleibenden Fächergruppen an den Universitäten lagen im Jahr 1998 unter 8.000 DM je Studierenden. Die laufenden Grundmittel an den Fachhochschulen lagen in allen Fächergruppen (ohne Berücksichtigung der Ausgaben für die zentralen Einrichtungen) bei unter 8.000 DM.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Laufende Ausgaben (Grundmittel) für Lehre und Forschung an Hochschulen je Studierenden nach Fächergruppen und Hochschularten in 1998
Quelle: BMBF (2001); eigene Darstellung
2.4.2 Entwicklung der Studierendenzahlen
Die quantitative Entwicklung der Studienanfänger, der Studierenden und der Hochschulabsolventen bestimmt maßgeblich den zukünftigen Finanzierungsbedarf der Hochschulen. Die Zahl der Studienanfänger (Studierende im 1. Fachsemester) kann dabei als Indikator für den zukünftigen Personalbedarf und die Zahl der Studierenden als Indikator für den Finanzierungsbedarf im Bereich Hochschulbau dienen.
Die KMK prognostiziert, dass die Zahl der Studienanfänger im 1. Fachsemester von 439.164 im Jahr 2000 auf 385.000 im Jahr 2015 abnehmen wird (vgl. Abb. 4). Die Zahl der Studierenden wird von 1.798.517 in 2000 auf 1.788.800 in 2015 sinken. Für die Hochschulabsolventen ist davon auszugehen, dass ihre Zahl von 197.524 im Jahr 1999 auf 213.500 in 2014 ansteigen wird. Gemäß der Prognose der KMK ist langfristig von einer –wenn auch nur geringen- quantitativen Entlastung der Hochschulen auszugehen. Die Prognose basiert auf einer Status-quo-Fortschreibung, bei der die gegenwärtigen Quoten für den Übergang der Studienberechtigten auf die Hochschulen, die Fachwechselquoten, die Verweildauern und die Studienerfolgsquoten nicht verändert werden. Zu berücksichtigen ist, dass der Prognose die mit 68% sehr niedrige Hochschulübergangsquote aus dem Jahr 1999 zugrunde liegt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Anzahl der Studienanfänger, Studierenden und Hochschulabsolventen; ab 2001 Prognose der Anzahl der Studienanfänger und Studierenden als Status-quo-Fortschreibung; ab 2000 Prognose der Hochschulabsolventen als Status-quo-Fortschreibung
Quelle: KMK (2001); eigene Darstellung
Die Quote für den Übergang der Studienberechtigten auf die Hochschulen war in den Jahren 1990 bis 1999 stark rückläufig und sank von 82% auf 68%. Die KMK weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Entscheidung einer Studienaufnahme u.a. von den Faktoren „(...) Veränderung im Bildungsverhalten der Bevölkerung, der wirtschaftlichen Entwicklung, dem Akademisierungsgrad der Elterngeneration, den Zulassungsbeschränkungen an den Hochschulen, den finanziellen Vor- und Nachteilen einer nichtakademischen Ausbildung, der Entwicklung des Arbeitsmarktes (...)“ beeinflusst wird.[67] In einer Modellrechnung trifft die KMK die Annahme, dass die Übergangsquote zukünftig wieder ansteigen und in einer Bandbreite zwischen 70-80% liegen wird. Für eine deutliche Erhöhung der Übergangsquote spricht, dass sich die finanziellen Voraussetzungen für die Studienaufnahme bedingt durch eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage stabilisieren werden. Die Studienübergangsquote wird darüber hinaus durch die steigende Konkurrenz um die rückläufige Zahl der Ausbildungsplätze im dualen System steigen sowie durch den steigenden Anteil der Studienberechtigten, die nach Abschluss einer betrieblichen Ausbildung ein Studium aufnehmen.[68] Der Einfluss von Studiengebühren auf das Studienverhalten wurde von der KMK nicht explizit berücksichtigt.
Die quantitative Entwicklung der Studienberechtigten-, Studienanfänger-, Studierenden und Hochschulabsolventenquote ist in der Abbildung 5 dargestellt. Die Studienberechtigtenquote[69] wird sich gemäß einer Prognose der KMK von 37,6% in 2000 auf 39,1% in 2015 erhöhen. Zum Vergleich, die Studienberechtigtenquote lag in 1960 bei etwa 6%, in 1970 bei rund 11% und in 1980 bei 21,7%.[70]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Studienberechtigten-, Studienanfänger-, Studierenden- und Hochschulabsolventenquote [%]; ab 2001 Prognose der Studienberechtigten-, Studienanfänger-, Studierendenquote als Status-quo-Fortschreibung; ab 2000 Prognose der Hochschulabsolventen als Status-quo-Fortschreibung
Quelle: KMK (2001); eigene Darstellung
Die Studienanfängerquote[71] wird von 34,5% in 2000 auf 31,6% in 2015 sinken. Im gleichen Zeitraum werden die Studierendenquote[72] von 18,1% in 2000 auf 21,6% in 2015 und die Hochschulabsolventenquote[73] von 14% in 2000 auf 14,6% in 2015 steigen.
2.4.3 Kosten eines Studiums
Die Vollkosten eines Studiums setzen sich aus den öffentlichen/institutionellen und den privaten Kosten zusammen.
Bei der ökonomischen Betrachtung privater Kosten geht es um die sogenannten Oppertunitätskosten, die beim Treffen von Entscheidungen entstehen und den Wert eines entgangenen Gutes oder einer Dienstleistung bezeichnen. So geht die Entscheidung für ein Studium und gegen die Erwerbstätigkeit einher mit einem Verzicht auf Einkommen. Die Oppertunitätskosten sind von jeden Studierenden zu tragen. In die Betrachtung der privaten Kosten gehen nicht die Lebenshaltungskosten ein, da diese in jedem Fall anfallen, unabhängig von der Wahl einer Studienaufnahme.[74]
Bei den öffentlichen/institutionellen Kosten kann unterschieden werden in direkte und indirekte Kosten. Die direkten Kosten umfassen die Hochschulausgaben und die Sozialleistungen an die Studierenden, wie beispielsweise Kindergeld, Studienförderung, und Subvention der Sozialversicherung. Durch diese studienspezifischen Sozialleistungen werden wiederum die Oppertunitätskosten auf Seiten der Studierenden zum Teil von staatlicher Seite kompensiert. Die indirekten öffentlichen Kosten entstehen den öffentlichen Haushalten durch den Wegfall der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge auf das entgangene Einkommen der Studierenden. Damit führt die Entscheidung für ein Studium sowohl auf Seiten der Studierenden als auch auf Seiten der öffentlichen Haushalte zu Oppertunitätskosten.
Die privaten Kosten stellten im Berechnungsjahr 1994 mit 41% im Mittel den größten Anteil an den Vollkosten[75], gefolgt von den indirekten öffentlichen Kosten mit einem Anteil von 30,4%. Die direkten Kosten machten mit einem Anteil von 28,6% den geringsten Teil der Vollkosten aus. Die öffentlichen Hochschulausgaben je Studierenden betrugen im Jahr 1994 13.609 DM (vgl. Abb. 6).[76]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Vollkosten eines Hochschulstudiums je Studierenden und Jahr; Berechnungsjahr 1994
Quelle: Lüdeke, Beckmann (1998)
Die Vollkosten für ein Hochschulstudium je Studierenden lagen im Jahr 1994 in Abhängigkeit von der Fächergruppe zwischen 59.809 DM in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und 104.122 DM in der Medizin (vgl. Tab. 5). Die Höhe der Vollkosten wurde dabei maßgeblich von der Höhe der Hochschulausgaben je Studierenden bestimmt, die im Vergleich zu den privaten Kosten, den indirekten öffentlichen Kosten und den öffentlichen Kosten für die Sozialleistungen an Studierende im hohen Maße von der gewählten Studienrichtung abhängig ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 4: Vollkosten eines Hochschulstudiums je Studierenden und Jahr nach Fächergruppen; Berechnungsjahr 1994
Quelle: Lüdeke, Beckmann (1998)
Im Durchschnitt trug im Jahr 1994 die öffentliche Hand 58,93% der Vollkosten eines Studiums. Der private Anteil lag bei 41,07% und der Anteil. Den geringsten prozentualen Anteil erbrachten die öffentlichen Haushalte mit 55,53% in der Fächergruppe Kunst, Kunstwissenschaften und Sport, den höchsten Anteil mit 74,80% in der Medizin (vgl. Tab. 5).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 5: Privater Finanzierungsanteile und Finanzierungsanteil der öffentlichen Hand an den Vollkosten eines Hochschulstudiums je Studierenden und Jahr nach Fächergruppen; Berechnungsjahr 1994
Quelle: Lüdeke, Beckmann (1998)
Die Hochschulausgaben je Studierenden bestimmen maßgeblich die Studiengebührendebatte und werden nachfolgend näher betrachtet. In diesem Kontext werden die unterschiedlichen Berechnungsansätze diskutiert. Ein in der Literatur gängiger Ansatz setzt die Hochschulausgaben insgesamt ins Verhältnis zur Zahl der Studierenden. Gemäß diesem Ansatz ergeben sich für das Jahr 1996 jährliche Ausgaben im Mittel von 28.072 DM je Studierenden, wobei die jährlichen fachspezifischen Ausgaben je Studierenden zwischen 3.610 DM für den Studienbereich Germanistik und 199.863 DM für den Bereich Humanmedizin liegen.[77] Für das Jahr 1998 ergeben sich im Mittel jährliche Ausgaben von 28.268 DM je Studierenden.[78]
Problematisch an diesen Ansatz ist, dass die Hochschulausgaben insgesamt nicht mit den Ausgaben für die Hochschullehre gleichzusetzen sind. Zunächst sind die Hochschulausgaben um die Drittmittel und Verwaltungseinnahmen zu bereinigen, da die Verwaltungseinnahmen überwiegend in die Krankenversorgung fließen und die eingeworbenen Drittmittel fast ausschließlich in die Forschung. Auf Basis der verbleibenden Grundmittel (laufende Grundmittel und Investitionsausgaben) ergeben sich für das Jahr 1998 im Mittel je Studierenden jährliche Ausgaben in Höhe von 17.012 DM (vgl. Abb. 7).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 7: Grundmittel (laufende Grundmittel und Investitionsausgaben) für Lehre und Forschung an Hochschulen je Studierenden nach Fächergruppen in 1998
Quelle: BMBF (2001); Statistisches Bundesamt (2000)
Da die Aussagekraft des Mittelwertes aufgrund der großen Bandbreite der Studienkosten in Abhängigkeit vom Studienbereich gering ist, werden die Ausgaben je Studierenden auf Basis der fachspezifischen Grundmittel berechnet (vgl. Abb. 7).[79] In der Humanmedizin beliefen sich (unter Berücksichtigung der Grundmittel-Ausgaben für die zentralen Einrichtungen) die Grundmittel je Studierenden in 1998 auf 75.481 DM. In der Veterinärmedizin lag dieser Betrag bei 31.728 DM, in den Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften bei 22.609 DM, in der Fächergruppe der Mathematik und Naturwissenschaften bei 21.942 DM, in den Ingenieurwissenschaften bei 17.422 DM und in den Sprach- und Kulturwissenschaften bei 15.567 DM. Unter 15.000 DM Grundmittel je Studierenden wurden für das Jahr 1998 in den Fächergruppen Kunst/Kunstwissenschaften, Sport und Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften verausgabt. Die Spannweite innerhalb der einzelnen Fächergruppen ist zum Teil ebenfalls erheblich. So betrugen z.B. im Jahr 1998 in der Fächergruppe Mathematik/Naturwissenschaften die Hochschulausgaben insgesamt 13.957 DM je Studierenden im Lehr- und Forschungsbereich Mathematik. Im Lehr- und Forschungsbereich Biologie lag dieser Wert hingegen bei 35.007 DM und in der Chemie bei 37.584 DM.[80]
Eine Abhängigkeit der Hochschulausgaben besteht auch zu der Hochschulart. Für das Jahr 1998 ergeben sich die in Abbildung 3 dargestellten fächergruppenspezifischen laufenden Grundmittel je Studierenden, die im Mittel für einen Studierenden an einer Universität 15.070 DM und für einen Studierenden der allgemeinen Fachhochschule 8.530 DM betrugen[81].
Der in der Abbildung 7 ausgewiesene öffentliche Grundmittel-Zuweisungsbetrag umfasst den Personal- und Sachaufwand für Lehre und Forschung. Da die Ausgaben für die Forschung nicht –zumindest nicht im vollem Umfang- der Hochschulausbildung zuzurechnen sind, erfolgt ein Abzug von den öffentlichen Grundmittel in Höhe der staatlichen Forschungsausgaben. Bei der Ermittlung des Forschungsanteils wird von unterschiedlichen Prozentsätzen ausgegangen. So ermittelten Lüdeke/Beckmann (1998), dass im Mittel 66,7% der Hochschulausgaben in die Lehre fließen. Die Spannweite reicht von 39,1% in der Medizin und 97,4% in den Sprach- und Kulturwissenschaften. In einer Studie von Grüske liegt der Anteil der Lehre an den Hochschulausgaben zwischen 60-70%.[82] Für Österreich ermittelten hingegen Sturn und Wohlfahrt, dass die Kosten der Lehre nur rd. 30% des Hochschuletats ausmachen.[83]
In den amtlichen Statistiken selbst wird aufgrund des Prinzips der Einheit von Forschung und Lehre bei der Ausweisung der Grundmittel nicht nach Aufgaben differenziert. Da die vom Bund und den Ländern zugewiesenen Grundmittel für die Erfüllung der Aufgaben Forschung, Lehre und in den Hochschulkliniken ferner für die Krankenversorgung zur Verfügung gestellt werden und die Grundmittelverwendung seitens der Hochschulen autonom erfolgt, ist eine Ermittlung des Anteils der Forschungsausgaben an den zugewiesenen Grundmittel nur unter Anwendung bestimmter Koeffizienten auf dem Weg der Schätzung näherungsweise möglich. Die KMK, das BMWF, der WR und das Statische Bundesamt haben ein Berechnungsverfahren für derartige Forschungs- und Entwicklungskoeffizienten entwickelt. Dieses Berechnungsverfahren basiert auf den Gedanken, dass sich die Hochschulausgaben proportional der Verteilung der Arbeitszeit des wissenschaftlichen Personals auf die einzelnen Hochschulfunktionen aufteilen lassen.[84]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 6: Forschungs-, Entwicklungs- und Lehrekoeffizienten
Quelle: Statistisches Bundesamt (2000)
Während die Forschungs- und Entwicklungskoeffizienten der Universitäten indirekt über den Zeitaufwand für Lehre und andere Nichtforschungsaktivitäten nach einem empirisch-normativen Verfahren ermittelt werden, werden die Forschungs- und Entwicklungskoeffizienten der Kunst-, Fach- und Verwaltungsfachhochschulen sowie der Medizinischen Einrichtungen pauschal bzw. nach einem angepassten Verfahren festgelegt. Die Forschungs-, Entwicklungs- uns Lehrekoeffizienten für die Jahre ab 1995 sind in der Tabelle 6 aufgeführt.
Zur Ermittlung eines Richtwertes für die Ausbildungskosten je Studierenden getrennt nach Fächergruppe können vereinfacht die Lehrekoeffizienten der Universitäten aus der Tabelle 6 mit den Grundmittel je Studierenden aus der Abbildung 7 verrechnet werden. Die Grundmittelausgaben für die zentralen Einrichtungen werden auf die einzelnen Fächergruppen umgelegt. Es ergeben sich die in Abbildung 8 dargestellten Ausbildungskosten je Studierenden. Die Spannweite reicht von 5.785 DM für Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler bis zu 66.725 DM für Humanmedizin. Dazwischen liegen die Veterinärmedizin mit 20.623 DM, die Mathematik und Naturwissenschaften mit 13.520 DM, die Agrar-, Forst- und Erziehungswissenschaften mit 13.604 DM, die Sprach- und Kulturwissenschaften mit 11.130 DM die Ingenieurwissenschaften mit 10.157 DM, die Kunst und Kunstwissenschaften mit 8.788 DM sowie Sport mit 7.317 DM.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8: Grundmittel-Ausgaben für den Bereich Lehre je Studierenden (bzw. Ausbildungskosten je Studierenden) nach Fächergruppen für das Jahr 1998; eigene Darstellung
Bei der Interpretation der Daten muss berücksichtigt werden, dass den einzelnen Forschungs- und Entwicklungskoeffizienten eine Vielzahl von Annahmen zugrunde liegt und die Kunst-, Fach- und Verwaltungsfachhochschulen einen geringeren Forschungs- und Entwicklungskoeffizient aufweisen, als die Universitäten. Ferner wird hinsichtlich der angewandten Methodik angemerkt, dass im Kontext der Kosten- und Leistungsrechnung und dort insbesondere in der Kostenträgerrechnung die kostenrechnerische Trennung intensiv diskutiert wird. In dieser Diskussion wird immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Trennung der Kosten des Kuppelprodukts Forschung und Lehre nicht praktikabel ist und auf die Prämisse der Einheit von Forschung und Lehre verwiesen.[85]
Ein weiterer methodischer Mangel lässt sich darauf zurückführen, dass die Hochschulausgaben auf die Gesamtzahl der Studierenden bezogen werden, also auch auf die Langzeitstudierenden und die sogenannten Scheinimmatrikulierten. Letztere Gruppe der „Studierenden“ ist an einer Hochschule eingeschrieben, um den Studierendenstatus und die damit verbundenen Vergünstigungen zu erlangen, wie beispielsweise ein Semesterticket. Verlässliche Statistiken über die Zahl der Scheinimmatrikulierten gibt es nicht (vgl. auch Kap. 2.4.4).
Es ist davon auszugehen, dass bei einer Bereinigung der Statistik um die Scheinimmatrikulierten sich die Hochschulausgaben je Studierenden im Mittel erhöhen werden. Dieser Effekt wird sich jedoch auf die einzelnen Fächergruppen unterschiedlich auswirken, da sich die Scheinimmatrikulierten nicht gleichmäßig auf die Fächergruppen verteilen. So werden sich in den Lehr- und Forschungsbreichen mit Zulassungsbeschränkungen, wie beispielsweise Human- und Veterinärmedizin, Betriebswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften wenige bis keine Scheinimmatrikulierten befinden.
Die Langzeitstudierenden lassen sich aus der Betrachtung weitestgehend ausschließen, wenn die Hochschulausgaben (Grundmittel für Forschung und Lehre) ins Verhältnis zu der Anzahl der Studierenden im 1.-14. Hochschulsemester gesetzt werden[86] Dadurch erhöhen sich die Hochschulausgaben je Studierenden für das Jahr 1998 im Mittel auf 22.086 DM (gegenüber 17.012 DM für alle Studierenden; vgl. Abbildung 7). Aber auch dieser Effekt wird sich auf die einzelnen Fächergruppen unterschiedlich verteilen. Als Indiz kann die unterschiedlich hohe (mittlere) Fachstudiendauer gelten, die beispielsweise in der Humanmedizin im Jahr 1998 bei 13 Semestern lag und im Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre (BWL) bei 10,9 Semestern.[87]
Unberücksichtigt bei der durchgeführten Berechnung der Hochschulausgaben je Studierenden bleibt ferner die Dienstleistungsverflechtung zwischen den Fächergruppen und die Auslastung in den einzelnen Studienfächern. Des Weiteren werden die Studierenden nur entsprechend ihrem ersten Studienfach den Fächergruppen zugeordnet. Im Rahmen eines Magister- oder Lehramtstudiums erfolgt aber i.d.R. eine Einschreibung in mindestens drei bzw. zwei Studienfächern. Es erscheint daher erforderlich, diese Studierenden anteilig auf die Fächergruppen zu verteilen. Die unterschiedliche Gewichtung (z.B. für Haupt- oder Nebenfach) der einzelnen Fächer könnte dabei über eine Äquivalenzbildung erfolgen.
Ausgehend von den aufgeführten Gründen sollten die in dieser Arbeit und in der Literatur ermittelten Hochschulausgaben je Studierenden immer nur als Richtgrößen verstanden werden. In diesem Zusammenhang führte der WR aus: „Die Zahl der Studierenden war und ist keine sinnvolle Richtschnur zur Bemessung des Finanzbedarfs der Hochschulen. Der Finanzbedarf für die Grundausstattung ist nur in kleinen Teilen von der Zahl der Studenten abhängig.“ [88] Letztlich kann eine Entscheidung für oder gegen Studiengebühren daher auch nicht allein auf Grundlage der Hochschulausgaben je Studierenden erfolgen.
Ein weiterer gängiger Ansatz besteht darin, die Hochschulausgaben ins Verhältnis zu den Absolventenzahlen zu setzen. Dieser Ansatz setzt jedoch zwei Größen ins Verhältnis, die nicht unmittelbar voneinander abhängig sind. Die Zahl der Absolventen eines Bezugsjahres steht nicht im unmittelbaren Verhältnis zu den Hochschulausgaben je Absolvent des gleichen Bezugsjahres. Vielmehr verhält sich die Ausgabenentwicklung im Hochschulbereich je Absolventen seit 1993 nahezu spiegelbildlich zur Entwicklung der Absolventenzahlen.[89] Die Zahl der Absolventen eines Jahres wird maßgeblich von den Anfängerkohorten der vorangegangenen Jahre, von den herrschenden Studienbedingungen, der Arbeitsmarktsituation, den Studienabbrecher- und Studienortwechslerquoten und den Aufbau neuer Studiengänge bestimmt.
Ferner sind die Durchschnittskosten je Studierenden nicht mit den tatsächlichen Kosten, die ein zusätzlicher Studierender kostet (den sog. Grenzkosten) gleichzusetzen. Die Kostenstruktur der Hochschulen ist weitgehend statisch, weil sie in vielen und gerade in den kapital- und personalintensiven Bereichen nicht von der Zahl der Studierenden abhängig ist. Als Beispiel sei eine Vorlesung angeführt, deren Kosten typischerweise konstant sind, unabhängig davon, ob sich zehn oder fünfhundert Studierende im Auditorium befinden. Steigende Studierendenzahlen bringen in diesem Fall hohe Skalenträge, d.h. die zusätzlichen Kosten je weiteren Studierenden sind –bis zur Kapazitätsgrenze- relativ gering (oder sogar Null, wie im Beispiel einer Vorlesung, für die keine Verbrauchsmaterialien benötigt werden). Wird die Kapazitätsgrenze überschritten, müssen zusätzliche sächliche und personelle Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden. Es ergibt sich ein U-förmiger Kostenverlauf.
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die aufgeführten Werte einen Mittelwert für das gesamte Bundesgebiet bilden. Erfolgt eine Berechnung der Grundmittel je Studierenden auf Länderebene oder gar auf der Ebene einzelner Hochschulen können die Werte sowohl deutlich nach unten als auch nach oben abweichen. So lagen im Jahr 1998 die Grundmittelausgaben der Länder für Lehre und Forschung an Hochschulen je Studierenden zwischen 27.135 DM (in Sachsen-Anhalt) und 11.139 DM (in Nordrhein-Westfalen).
2.4.4 Anteil von Studiengebühren am Hochschuletat
Wären im Rechnungsjahr 1998 von jedem der rd. 1,8 Mio. Studierenden Studiengebühren in Höhe von 1000 DM je Semester erhoben worden, hätte sich für das Jahr 1998 eine Einnahme in Höhe von 3,6 Mrd. DM ergeben. Dieser Wert hätte 17,29% der Grundmittelausgaben im Bereich Lehre entsprochen, 11,76% der staatlichen Hochschulausgaben ohne Verwaltungs- und Drittmittelausgaben und 6,85% der Hochschulausgaben insgesamt.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Einführung einer Studiengebühr die Zahl der Studierenden beeinflussen wird. Voraussichtlich wird die Einführung einer Studiengebühr zu einem deutlichen Rückgang der Studierenden führen, die nicht bis gering studien- und prüfungsaktiv sind. Diese Gruppe umfasst Studierende, die in zunehmenden Maße das Studium aufgrund beruflicher und/oder familiärer Verpflichtungen zurückgesetzt haben, Studierende bei denen das Studium nicht mehr der Lebensmittelpunkt ist und Studierende, die eine wahrscheinlich später erfolgte Entscheidung zum Studienabbruch vorziehen. Zurückgehen wird voraussichtlich auch insbesondere jene Gruppe der Studierenden, die aus sonstigen Gründen (u.a. soziale Vergünstigungen, Semesterticket ...) eingeschrieben sind, aber nie eine Studienabschluss angestrebt haben (sog. Scheinimmatrikulierte). Zu einem weiteren Rückgang der Studierendenzahl kann es kommen, wenn Studierende höherer Semester deutlich beschleunigt ihr Studium in der noch gebührenfreien Phase zum Abschluss bringen, um so die Gebühren zu umgehen. Darüber hinaus kann die Einführung einer Studiengebühr dazu führen, dass Studierwillige aus finanziellen Gründen von einer Studienaufnahme absehen und sich alternativ für eine gebührenfreie Berufsausbildung oder der direkten Berufseinstieg entscheiden. Dies würde insbesondere die Zahl der Ersteinschreibungen beeinflussen.
Für die Hochschulen in der BRD lassen sich die beschriebenen Effekte nicht quantifizieren. Als Anhaltswerte können jedoch die Daten des Landes Österreich dienen, die ein der BRD vergleichbares Hochschulsystem haben und seit dem WS 2001/02 Studiengebühren (sog. Studienbeitrag) in Höhe von 363,36 € pro Semester für österreichische Studierende und Studierende, die den österreichischen Studierenden gleichgestellt sind (Staatsangehörige von EU- und EWR-Mitgliedsstaaten sowie der Schweiz) bzw. in Höhe von 726,72 € pro Semester für die anderen Studierenden erheben.
Eine Studie über die Auswirkungen der Studiengebühren auf die Zahl der Studierenden an österreichischen Universitäten[90] prognostizierte, dass die Zahl der Ersteinschreibungen durch die Studiengebühr nahezu nicht beeinflusst wird und maximal um 10% zurückgehen würde. Wesentliche Veränderungen von bis zu 33,20% wurden hingegen in Bezug auf den Studienaltbestand (Studierende insgesamt abzüglich der Studienanfänger) prognostiziert.
Bei einem Vergleich der Prognosezahlen der Studie mit den tatsächlichen Studierendenzahlen nach Einführung des Studienbeitrags zeigt sich, dass der Rückgang des Studienaltbestands geringer ausfiel als prognostiziert und der Rückgang der Studienanfängerzahlen stärker. So sank die Zahl der Studierenden an den Universitäten in Österreich von 221.505 im WS 2000/01 auf 176.724 im WS 2001/02 und die Zahl der Ersteinschreibungen von 26.023 im WS 2000/01 auf 22.310 im WS 2001/02. Dies entspricht einer Reduzierung der Immatrikulierten um 20,22% und der Ersteinschreibungen um 14,27%.[91]
Die Einführung von Langzeit- und/oder Zweitstudiengebühren wird voraussichtlich deutlich geringere Auswirkungen auf die Studierendenzahlen haben.[92] Während die Studienanfängerzahlen der grundständigen Studiengänge[93] nahezu unbeeinflusst werden, wird sich der Studierendenaltbestand voraussichtlich reduzieren. So ging die Zahl der Studierenden in Baden-Württemberg nach Einführung der Langzeit- und Zweitstudiengebühr zum WS 1997/98 um 9,86% im Vergleich zum
WS 1996/97 zurück. Im übrigen Bundesgebiet sank die Zahl der Studierenden im gleichen Zeitraum nur um 0,35%. Die Zahl der Studienanfänger sank in Baden-Württemberg zum WS 1997/98 im Vergleich zum Vorjahr um 1,43%, während im übrigen Bundesgebiet die Zahl der Studienanfänger um 0,57% anstieg.[94]
Nachfolgend wird nicht die Frage in den Mittelpunkt gestellt, wie hoch der Anteil möglicher Studiengebühren am Hochschuletat ist, sondern wie hoch der Anteil der Studiengebühren jedes einzelnen Studierenden an den fachspezifischen Hochschulausgaben ist. Diese Fragestellung ist von Bedeutung, wenn Studiengebühren eine Steuerungsfunktion erfüllen sollen.[95] Ausgehend von den Grundmittel-Ausgaben für den Bereich Lehre je Studierende nach Fächergruppen für das Jahr 1998 (vgl. Abb. 9) würden sich bei einer Studiengebühr in Höhe von 1000 DM pro Semester Studierende der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu 34,57% an den fachspezifischen Grundmittel-Ausgaben beteiligen und Studierende der Humanmedizin nur zu rd. 3%. Diese Diskrepanz zeigt bereits, dass (sofern die Studiengebühren eine Lenkungs- und Steuerungsfunktion erfüllen sollen) die Gebührenhöhe nicht unabhängig von dem gewählten Studienfach erhoben werden darf.
Hinsichtlich einer möglichen Verwendung der eingenommenen Studiengebühren bestehen folgende Optionen, die Studiengebühren könnten –im Sinne einer zusätzlichen Einnahme- direkt bei den Hochschulen verbleiben und so zu einer Entlastung der Hochschulhaushalte beitragen. Insbesondere die Befürworter von Studiengebühren streben einen Verbleib der Gebühren bei den Hochschulen an.[96] Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass die Studiengebühren zwar an den Hochschulen verbleiben, jedoch die staatlichen Hochschulzuweisungen um einen entsprechenden Betrag gekürzt werden. Denkbar wäre auch, dass die eingenommenen Studiengebühren durch (allgemeine) Steuersenkungen an die Steuerzahler weitergereicht werden. Diese Möglichkeit steht im Zusammenhang mit der sozialpolitischen Argumentation.[97] Außer Acht gelassen werden darf ferner nicht, dass der Einzug von Studiengebühren mit einem monetären Verwaltungsaufwand verbunden ist.
[...]
[1] Das OECD-Ländermittel lag im Jahr 1998 bei 1,06%; vgl. OECD (2001)
[2] vgl. OECD (2001); Diese Aussage gilt auch, wenn die unterschiedlichen Bildungsstrukturen der OECD-Länder berücksichtigt werden; vgl. List, J. (2002); S. 11
[3] vgl. Peisert, H.; Framhein, G. (1994) S. 2
[4] vgl. W. von Humbolts (1809/10); vgl. auch Menze, C (1975)
[5] vgl. Peisert, H.; Framhein, G. (1994) S. 4 f.
[6] vgl. Müller, R. A. (1990) S. 85 f.; Die Steigerungsrate lag in den Jahren 1871-1900 weit über der Rate des Bevölkerungswachstums; vgl. Prahl (1978) S. 211 ff.
[7] vgl. Müller, R. A. (1990) S. 89/99
[8] vgl. Müller, R. A. (1990) S. 102 ff.
[9] vgl. Müller, R. A. (1990) S. 105 ff.
[10] vgl. Peisert, H.; Framhein, G. (1994) S. 6
[11] vgl. Müller, R. A. (1990) S. 105 ff.
[12] vgl. Art. 91a GG (Regelt den Ausbau und Neubau von Hochschulen, für die eine gesetzlich zu regelnde gemeinsame Rahmenplanung vorgesehen wurde.); vgl. Art. 91b GG (Regelt die Möglichkeit, aufgrund von Vereinbarungen, bei der Bildungsplanung und bei der Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung von überregionaler Bedeutung zusammenzuwirken.); vgl. Art. 75, Nr. 1a GG (Der Bund erhält durch diesen Art. im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung das Recht, Rahmenvorschriften über die allg. Grundsätze des Hochschulwesens zu erlassen.)
[13] Die Gesetzgebung auf Landesebene muss dem Hochschulrahmengesetz folgen.
[14] vgl. HRK (1991), S. 81 ff.
[15] vgl. Bultmann, T. (1995)
[16] vgl. Weber, M (1987)
[17] vgl. WR (1985)
[18] "Anreize in Form von Gebühren, Hörergeldern u.ä. bestehen nicht. Zwar ist die staatliche Finanzierung der Hochschulen teilweise von der Studentenzahl abhängig, aber diese Abhängigkeit wird kaum wettbewerbswirksam,(…) den Hochschulen fehle es auf diese Weise an Dispositionsfreiheit.“; vgl. WR (1985) S. 10/20
[19] vgl. Bultmann, T. (1995)
[20] vgl. HRK/KMK (1992)
[21] vgl. HRK-Pressemitteilung vom 14.11.95
[22] vgl. Spiegel vom 20.11.1995
[23] vgl. Kap. 2.3
[24] sog. Zöllner-Modell; vgl. Kap. 2.3
[25] vgl. Pressemitteilung des MSWF des Landes NRW vom 06.11.2001
[26] vgl. KMK (2000a)
[27] vgl. Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Edelgard Bulmahn, am Mittwoch, den 02.12.1998 im Deutschen Bundestag
[28] Sechstes Gesetz zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes (6. HRGÄndG) vom 08. August 2002; im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 57 S. 3138-3139, ausgegeben zu Bonn am 14. August 2002
[29] vgl. Pressemitteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden Württemberg Nr. 118/2002 vom 21.06.2002
[30] vgl. Pressemitteilung des BMBF Nr. 135/2002 vom 04.07.2002
[31] vgl. Interview mit dem Präsidenten der HRK in der Sächsischen Zeitung vom 21. Februar 2002; vgl. auch Interview mit dem Generalsekretär der HRK in „Die Zeit“ vom 24. April 2002
[32] vgl. Deutscher Bundestag (2002)
[33] vgl. u.a. GEW (2002); vgl. auch Pressemitteilung des Aktionsbündnisses gegen Studiengebühren (ABS) vom 20. Februar 2002
[34] vgl. § 27 Abs. 4 Satz 2 6. HRGÄndG
[35] vgl. iwd 39 (2002); S. 5
[36] vgl. Landeshochschulgebührengesetz (LHGebG) vom 5. Mai 1997 (GBl. S. 173); vgl. auch Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über die Universitäten im Lande Baden-Württemberg (Universitätsgesetz - UG) vom 1. Februar 2000, veröffentlicht im Gesetzesblatt S. 208
[37] vgl. § 120 a des Universitätsgesetzes des Landes Baden-Württemberg- Gesetz über die Universitäten im Lande Baden-Württemberg (Universitätsgesetz - UG) in der Neufassung des Gesetzes vom 24. November 1999
[38] vgl. BVerwG 6 C 8 – 11.00 – Urteil vom 25. Juli 2001
[39] vgl. § 6 und § 129 a Hochschulmodernisierungsgesetz-Referentenentwurf vom April 2002-Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) in der Fassung vom 18. Juli 2001 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 171)
[40] vgl. § 11 bis § 13 Gesetz zur Hochschulreform in Niedersachsen vom 24. Juni 2002 (Nds. GVBl. S. 286 – VORIS 22210 –)
[41] Saarländisches Hochschulgebührengesetz vom 20. März 2002, seit dem 01.04.2002 in Kraft
[42] vgl. Art. 2 § 1bis § 3 des Entwurf eines Artikelgesetzes zur Aufhebung des Hochschulgebührengesetzes, zum „Gesetz zur Einführung von Studienkonten und zur Erhebung von Hochschulgebühren (Studienkonten- und
-finanzierungsgesetz - StKFG)“ und zur Änderung des Hochschulgesetzes
[43] vgl. § 1 des Entwurfs einer Verordnung über die Erhebung von Gebühren vor Einrichtung von Studienkonten, Zweitstudiengebühren, Gebühren für das Studium im Alter, Gasthörergebühren, Ausfertigungs- und Verspätungsgebühren an den Universitäten, Fachhochschulen und Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (HSGebVO)
[44] vgl. Art. 85 Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Oktober 1998 (GVBl S. 740)
[45] vgl. § 109 Abs. 2 Bremisches Hochschulgesetz vom 20. Juli 1999 (Brem.GBl. S. 183)
[46] Gesetz über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulgesetz - SächsHG) vom 11. Juni 1999, (SächsGVBl. S. 294)
[47] vgl. § 2 Abs. 8 Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) vom 12.10.90, zuletzt geändert am 07.10.99) (GVBl. S. 367)
[48] vgl. § 2 Abs. 10 BerlHG
[49] vgl. § 2 Abs. 3, Gesetz über die Hochschulen des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Hochschulgesetz - BbgHG) vom 20. Mai 1999 (GVBl. I S.130), geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 28. Juni 2000 (GVBl. I S.90 (91))
[50] Pressemitteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz vom 6. November 2001 zum Thema „Hochschulfinanzierung und Studiengebührenfreiheit“
[51] vgl. Landesgesetz über die Universitäten in Rheinland-Pfalz (Universitätsgesetz - UG) in Kraft seit 1. Oktober 1995 (inkl. der Änderungen durch das Gesetz vom 6. Februar 2001)
[52] vgl. Neufassung des Hessischen Hochschulgesetzes vom 31. Juli 2000
[53] vgl. § 6 Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOB. M-V S. 398)
[54] vgl. § 115 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (HSG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.Juli.1998 (GVBl. LSA S. 300 ), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 08. August 2000 (GVBl. LSA S. 520 )
[55] Gesetz über die Hochschulen und Klinika im Lande Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz - HSG) vom 4. Mai 2000, Gl.-Nr.: 221-7
[56] vgl. § 107 des Thüringer Hochschulgesetzes in der Fassung der Beschlussfassung des Landtags vom 29.4.1999 zum Dritten Gesetz zur Änderung des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG)
[57] Grundmittel sind die Nettoausgaben abzüglich der dem jeweiligen Aufgabenbereich zurechenbaren unmittelbaren Einnahmen. Sie zeigen die aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzierenden Ausgaben eines bestimmten Aufgabenbereichs.
[58] vgl. Pasternack (2001); vgl. auch Federkeil; Ziegele (2001)
[59] vgl. Statistisches Bundesamt (2000); S. 9
[60] vgl. WR 2002; S. 58 ff.
[61] vgl. BLK-Bildungsfinanzbericht 1999/2000 (2001) S. 70 ff.
[62] Grundmittel i.S.d. Hochschulfinanzstatistik sind Ausgaben insgesamt abzgl. der Verwaltungseinnahmen und Drittmittel. Laufende Grundmittel sind die laufenden Personal- und Sachausgaben (ohne Investitionen). Ausgaben sind hier monetäre Aufwendungen im kameralen Sinn. Drittmittel sind die von der Hochschulfinanzstatistik erfassten Drittmittel, bis 1990 teilweise geschätzt (vgl. auch WR 2000). Die Realwerte wurden durch die Deflationierung mit dem Preisindex für den Staatsverbrauch auf der Basis 1995=100 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ermittelt (Berechnung WR 2002). Alle Werte ohne Zusetzung von Versorgung und Beihilfen.
[63] Inkl. der Ausgaben für die universitäre Forschung und die DFG und inkl. der Zusetzungen für Versorgung und Beihilfen.
[64] Für die Berechnung wurden die Studierendenzahlen des jeweiligen Wintersemesters gewählt (so z.B. für das Jahr 1995 die Studierendenzahlen aus dem WS 1995/96) und die Realwerte aus der Tab. 2.
[65] Grunddaten vgl. BMBF (2001)
[66] Methodik vgl. Statistisches Bundesamt (2000)
[67] vgl. KMK (2001) S. 3
[68] vgl. KMK (2001) S. 30
[69] Anteil am Durchschnitt der 17-bis unter 20jährigen (Länder mit 12 Schuljahren) und der 18- bis unter 21jährigen (Länder mit 13 Schuljahren) deutschen und ausländischen Wohnbevölkerung am 31.12. des jeweiligen Vorjahres.
[70] vgl. HIS (2002) S. 9
[71] Anteil am Durchschnitt der 19- bis unter 25jährigen (bis 1996 der 18- bis unter 22jährigen) deutschen und ausländischen Wohnbevölkerung am 31.12. des jeweiligen Jahres.
[72] Anteil am Durchschnitt der 25- bis unter 32jährigen deutschen und ausländischen Wohnbevölkerung am 31.12. des jeweiligen Vorjahres.
[73] Anteil an der 19- bis unter 32jährigen deutschen und ausländischen Wohnbevölkerung am 31.12. des jeweiligen Jahres.
[74] Die Lebenshaltungskosten von Beginn bis zum Studienabschluss liegen in Abhängigkeit von dem gewählten Studienfach im Mittel zwischen 97.900 DM (in den Kunstwissenschaften) und 72.500 DM (in den Rechtswissenschaften); vgl. Forschung & Lehre (1990), S. 170
[75] vgl. Lüdeke, R., Beckmann, K. (1998); S. 17 ff.; Für eine Person A, die nicht studiert, werden für einen Zeitraum, der einer durchschnittlichen Studiendauer entspricht das Bruttoeinkommen sowie die Sozialausgaben und die Steuern auf dieses Einkommen ermittelt und addiert. Von diesen Wert abgezogen wird das durchschnittliche Bruttoeinkommen (zzgl. der Steuern auf dieses Einkommen) eines Studierenden. Es ergeben sich die Kosten X für den Fall, dass Person A nicht studiert. Für Person B, die studiert, werden für den gleichen Zeitraum die direkten Sozialleistungen ermittelt sowie die entgangenen Steuern und Sozialbeiträge (die sich durch die Nichterwerbstätigkeit der Person B ergeben). Die drei Werte werden addiert und es ergeben sich die Kosten Y für den Fall, dass Person B studiert. Die privaten Oppertunitätskosten ergeben sich durch die Gegenüberstellung der Fälle der Personen A und B. Die Kosten Y werden von dem Kosten X subtrahiert. Das Modell von Lüdeke/Beckmann geht von einem vollkommenen Arbeitsmarkt aus (Arbeitslosenquote: 0%).
[76] Hochschulausgaben für den Bereich Lehre; die Ausgaben für die Forschung wurden herausgerechnet; vgl. Lüdeke, R., Beckmann, K. (1998)
[77] vgl. u.a. Färber; G. (2000); S. 191
[78] Daten vgl. BMBF (2001); S. 279 in Verbindung mit Statistisches Bundesamt (2000); S. 67
[79] Da die Grundmittel in der amtlichen Statistik nicht nach Fächergruppen getrennt aufgeführt werden, wurden für die Ermittlung der fachspezifischen Grundmittel-Ausgaben je Studierenden die fächergruppenspezifischen laufenden Grundmittel (vgl. Statistisches Bundesamt (2000); S. 67) und die entsprechenden fächergruppenspezifischen Investitionsausgaben (vgl. BMBF (2001); S. 279) addierte und ins Verhältnis zu den entsprechenden fächergruppenspezifischen Studierendenzahlen (vgl. Statistisches Bundesamt (2000); S. 67) gesetzt. Die Grundmittel für die zentralen Einrichtungen wurden nicht fächergruppenspezifisch erfasst. Die laufenden Grundmittel wurden um die Investitionsausgaben ergänzt, da auch diese (insbesondere im Bereich des Hochschulbaus) dem Lehrbereich (und nicht allein dem Forschungsbereich) zuzurechnen sind. Die methodische Schwäche bei dieser gewählten Vorgehensweise liegt jedoch darin, dass sich Investitionsausgaben (insbesondere für Großbauprojekte) nicht gleichmäßig auf die Jahre (und damit auf die Studierenden) verteilen.
[80] Da die Grundmittel in der amtlichen Statistik innerhalb der einzelnen Fächergruppen nicht nach Lehr- und Forschungsbereichen getrennt aufgeführt werden, wurden die Hochschulausgaben insgesamt –getrennt nach Lehr- und Forschungsbereichen- (vgl. BMBF (2001); S. 279) ins Verhältnis zur Zahl der Studierenden getrennt nach Studienbereichen (vgl. BMBF (2001); S. 167, 172) gesetzt.
[81] Eine Ermittlung der fachspezifischen Grundmittel-Ausgaben je Studierenden getrennt nach Hochschularten ist nicht möglich, da die Grundmittel in der amtlichen Statistik nicht nach Fächergruppen und Hochschularten getrennt aufgeführt werden. Lediglich die laufenden Grundmittel (Grundmittel ohne Investitionen) werden getrennt nach Fächergruppen und Hochschularten in der amtlichen Statistik erfasst; vgl. BMBF (2001)
[82] vgl. Grüske, K.-D. (1997), S. 279
[83] vgl. Sturn, R.; Wohlfahrt, G. (1999)
[84] vgl. Statistisches Bundesamt (2000), S. 13 ff.; vgl. auch Hetmeier (1998), S. 153 ff.
[85] vgl. „Greifswalder Grundsätze zum Hochschulrechnungswesen“ Beschluss der Jahresversammlung der deutschen Universitätskanzler vom 01.10.1999; vgl. auch Hansmann, M. (2001); S. 14 ff.
[86] Sofern Studiengebühren für Langzeitstudierende erhoben werden, zählen als Langzeitstudierende, Studierende, die die Regelstudienzeit (bei der überwiegenden Zahl der grundständigen Studiengänge liegt diese bei neun oder zehn Semestern) um mehr als vier Semestern überschritten haben; Quelle: BMBF (2001); S. 166 ff.
[87] vgl. WR (2001/I), S. 55 u. 80
[88] vgl. WR (1998); S. 260
[89] vgl. BLK-Bildungsfinanzbericht 2000/2001 (2002); S. 91
[90] vgl. Pechar, H.; Wroblewski, A. (2001)
[91] Quelle: bmbwk (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Österreich); vgl. auch Süddeutsche Zeitung vom 27.08.2002 „Der Schillingstrudel“
[92] Hinsichtlich der Auswirkungen von Studiengebühren für Langzeitstudierende vgl. ABS (2001)
[93] Grundständige Studiengänge führen zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss.
[94] vgl. Statistisches Bundesamt (2000); S. 36
[95] vgl. Kap. 5
[96] vgl. CHE/HRK (2001); S. 2
[97] vgl. Dilger, A. (1999); S. 403 ff.; vgl. Kap. 4
Details
- Titel
- Ökonomische und sozialpolitische Argumente für und gegen Studiengebühren
- Untertitel
- Ein Beitrag zur aktuellen bildungspolitischen Diskussion
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 136
- Katalognummer
- V221956
- ISBN (eBook)
- 9783832465612
- ISBN (Buch)
- 9783838665610
- Dateigröße
- 1005 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- studiengebühren hochschulfinanzierung hochschulrendite bildungspolitik humankapitaltheorie
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2003, Ökonomische und sozialpolitische Argumente für und gegen Studiengebühren, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/221956

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.




