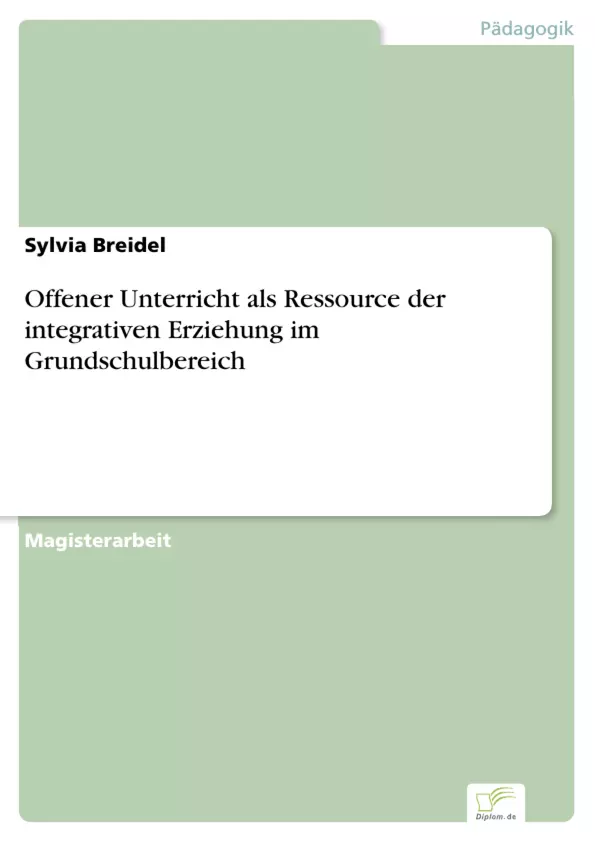Veröffentlichen auch Sie Ihre Arbeiten - es ist ganz einfach!
Mehr Infos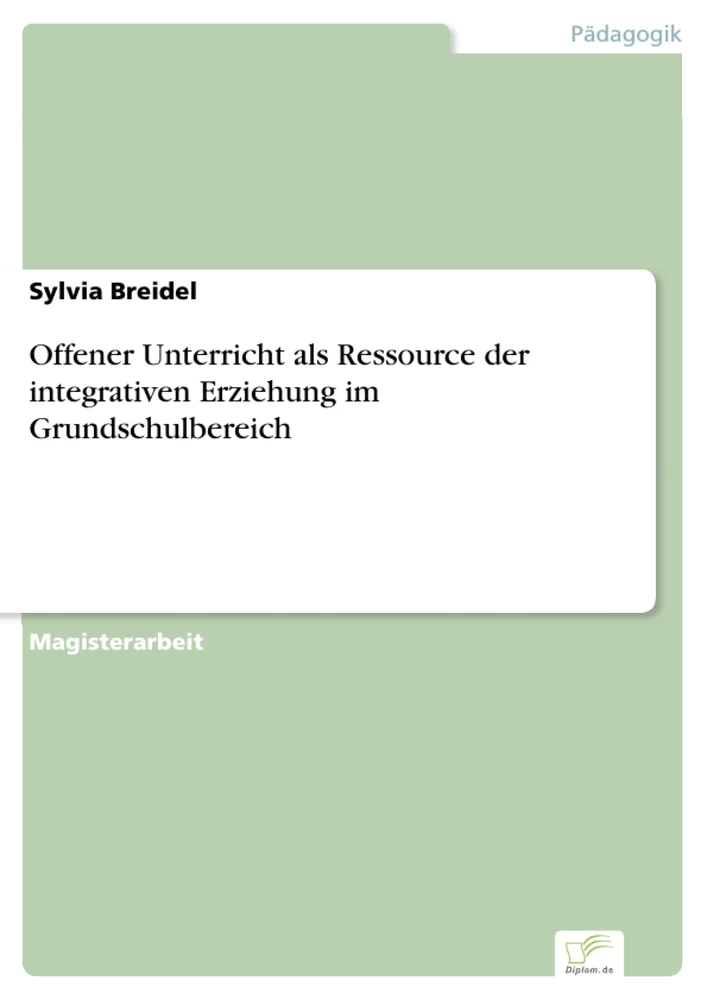
Offener Unterricht als Ressource der integrativen Erziehung im Grundschulbereich
Magisterarbeit, 2001, 83 Seiten
Autor

Kategorie
Magisterarbeit
Institution / Hochschule
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Erziehungswissenschaften)
Note
2
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Die Fragestellung, zum Aufbau der Arbeit und Einleitung in die Thematik
1.1 Die Aspekte der pädagogischen Bewegung
1.1.1 Interkulturelle Pädagogik
1.1.2 Feministische Pädagogik
1.1.3 Integrationspädagogik – gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern
2. Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft
2.1 Was heißt behindert?
2.2 Aussondernde Bildungseinrichtungen für Menschen mit Behinderungen
2.3 Integration und Normalisierung
2.4 Zur historischen und aktuellen Entwicklung der integrativen Idee in Deutschland und Europa
3. Integrative Didaktik und die Organisation in der Schulklasse
3.1 Was ist integrative Didaktik?
3.2 Die Klassenorganisation
3.2.1 Die Rolle des Lehrers und die Beziehung zu seinen Schülern
3.2.2 Das Verhältnis unter den Mitschülern
3.2.3 Die Eltern und der Aspekt der sozialen Herkunft
4. Offener Unterricht
4.1 Reformpädagogik und Offener Unterricht
4.2 Beispiel I : Der Wochenplanunterricht
4.2.1 Célestin Freinet
4.2.2 Der Wochenplanunterricht
4.2.3 Theorie und Praxis : Der Wochenplanunterricht in einer integrativen Grundschulklasse
4.3. Beispiel II : Der Projektunterricht
4.3.1 John Dewey
4.3.2 Der Projektunterricht
4.3.3 Theorie und Praxis : Der Projektunterricht in einer heterogenen Gruppe an der Grundschule
5. Die Möglichkeiten und Grenzen des gemeinsamen Unterrichts mit offenen Unterrichtskonzepten
5.1 Didaktische Begründungsansätze für Offenen Unterricht in integrativen Lernsituationen
5.2 Integration durch das Ausleben von Individualität und das Erleben von Gemeinschaft
5.3 Die Grenzen von Offenem Unterricht in heterogenen Lerngruppen
6. Spekulationen zu den zukünftigen integrativen Entwicklungen der Gesellschaft und insbesondere den pädagogischen Herausforderungen
Literaturverzeichnis
Anhang (Erklärung)
1. Die Fragestellung, zum Aufbau der Arbeit und Einleitung in die Thematik
Das politische und pädagogische Bemühen um Integration, dem gemeinsamen Lernen und Leben von Menschen mit und ohne Behinderung, besteht schon mindestens seit der reformpädagogischen Bewegung um die letzte Jahrhundertwende. Mit schweren Einschnitten und Rückschritten wurden besonders in den letzten zwei Jahrzehnten immer mehr Schüler[1] integrativ beschult und Signale für Integration durch die Gesetze gegeben, jedoch immer mit Einschränkungen.
Im Niedersächsischen Schulgesetz (§14 Abs. 4) wurde 1993 beschlossen, Sonderschulen als Förderzentren neu zu organisieren, um die Sonderschüler in den Unterricht der Regelschulen zu integrieren. In einer „Rahmenplanung für die Fortführung der Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ wurde 1998 die Vorgehensweise weiter ausdifferenziert (Niedersächsisches Kultusministerium 1998).
In dieser Rahmenplanung wird lediglich der neue Status von Sonderschulen und die organisatorische Herausforderung beschrieben. Es wird hier nicht die Chance einer veränderten Didaktik für tatsächlichen gemeinsamen Unterricht (z. B. durch Offenen Unterricht und innere Differenzierung) erwähnt. Doch gerade diese integrative Didaktik ist der wesentliche Bestandteil von schulischer Integration.
Es geht mir um die Frage, wie und mit welchen didaktischen Methoden integrative Erziehung am sinnvollsten zu realisieren ist, und welchen Nutzten alle Kinder und Jugendlichen davon haben.
Wie können Pädagogen gute Bedingungen für Integration schaffen? Ist der Offene Unterricht geeignet für gemeinsames Lernen mit behinderten und nichtbehinderten Kindern? Was sind die Prinzipien von Offenem Unterricht?
Ich beschränke mich in meinen Überlegungen zur Integration im schulischen Bereich nur auf die Grundschule. Es soll jedoch nicht so mißverstanden werden, als ob Integration in der ersten Klasse anfängt und in der vierten Klasse aufhört. Integration betrifft nicht nur einen bestimmten Lebensabschnitt oder eine spezielle
Institution, sondern wirkt in allen Lebensbereichen. Begründungsansätze für Integration in nur einem Bereich oder für nur eine bestimmte Gruppe wären nicht sinnvoll und würden dem Integrationsgedanken widersprechen.
In der integrationspädagogischen Literatur wird zwar grundsätzlich für Integration in allen Klassenstufen plädiert, von Schulversuchen oder Berichten zu Integration in höheren Klassenstufen, etwa in der gymnasialen Oberstufe, wird jedoch verhältnismäßig wenig berichtet. Anscheinend sind didaktische Modelle zu integrativem Unterricht besonders in Grundschulen gut zu erproben, durchzuführen und durchzusetzen. Außerdem ist gerade die Regelgrundschule ein Ort, in dem starke selektive Maßnahmen durchgeführt werden – und durch eine verbesserte Didaktik zum Nutzen aller Schüler verhindert werden müssen. Es wäre zu überlegen, inwieweit didaktische Modelle auf andere Klassenstufen und Schulformen zu übertragen sind.
Integration ist ein sehr weit gefaßter Ausdruck. Ich habe beobachtet, daß in Gesprächen zum Thema Integration zu Beginn oft die Fragen auftaucht, welche Gruppe denn dabei überhaupt gemeint ist. Die gesellschaftliche Integration in Bezug auf Menschen mit ausländischer Herkunft ist vielen ein Begriff und wird daher meistens zuerst vermutet. Integrativer Unterricht, im Sinne von gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen, ist weniger bekannt. Daraufhin wurde ich auf die differenzierten Sichtweisen und die Vielfalt des Themas aufmerksam. Deswegen beginne ich in der Einleitung zum Integrationsbegriff mit zwei weiteren wichtigen pädagogischen Bewegungen, die interkulturelle und die feministische, auch wenn ich mich danach weitestgehend auf die Didaktik der Integration von Kindern mit und ohne Behinderungen beziehe.
In meiner Arbeit werde ich immer wieder direkt oder indirekt auf die normativen Begriffsbestimmungen von behindert und Behinderung zurückkommen. Mir ist es wichtig, der (Be-) Deutung dieser Begriffe in ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang nahe zu kommen, weil hier der Zugang zur Integration ansetzt. Da Integration ein gesellschaftlicher Prozeß ist, kann sie immer nur so weit gehen, wie das Verständnis der Gesellschaft reicht. Auf diesen Aspekt werde ich besonders im zweiten Kapitel zurückkommen.
Im dritten Kapitel werde ich näher auf die allgemeine integrative Didaktik eingehen, vor allem auf die institutionellen Rahmenbedingungen, die Beziehungen
innerhalb der Lerngruppe, die Aufgabe der Lehrer und die Rolle der Eltern. Diese Informationen sollen die Grundlage für den Offenen Unterricht im nächsten Kapitel sein.
Auf zwei Formen des Offenen Unterrichts in integrativen Lernsituationen möchte ich im vierten Kapitel näher eingehen. Dabei handelt es sich um den Wochenplan- unterricht und die Projektmethode. Ich sehe sie im Zusammenhang mit reformpädagogischen Ideen und werde daher auch die Vorläufer dieser Konzepte, nämlich Célestin Freinet und John Dewey erwähnen. Anschließend stelle ich die Theorie meiner eigenen Praxiserfahrung gegenüber.
Ich habe die praktische Umsetzung von Offenem Unterricht und schulische Integration durch ein Praktikum in einer Grundschule kennengelernt. Diese Grundschule ist zwar offiziell keine integrative Grundschule, die Schülerschaft ist jedoch sehr heterogen, und in der von mir unterstützten Klasse wurde außerdem ein Mädchen mit einer Körperbehinderung unterrichtet.
Die Ressourcen des Offenen Unterrichts für die integrative Erziehung werde ich anhand von Literaturrecherchen und eigener Erfahrung im fünften Kapitel herausarbeiten. Hier werde ich auch meine Leitfragen zusammenfassend beantworten und die Grenzen des gemeinsamen Unterrichts nennen.
Die Chancen für Integration liegen natürlich nicht nur in einem didaktischen Modell, sondern auch in den gesellschaftlichen Bedingungen. Daher möchte ich diesen gesamtgesellschaftlichen Aspekt zum Schluß noch einmal ansprechen. Man kann das Thema Integration nicht vollständig erschließen bzw. nicht verstehen, wenn dieser Aspekt außer acht gelassen wird. Leben wir in einer Konkurrenzgesellschaft oder in einer Solidargemeinschaft mit Platz für starke und schwache Mitglieder – vielleicht auch von beidem etwas? Was können die Indikatoren für den integrativen Prozeß sein? Dabei werde ich herausstellen, welche bedeutende Rolle die Pädagogik bei der Gestaltung von Gesellschaft spielt.
1.1 Die Aspekte der pädagogischen Bewegung
Annedore Prengel analysiert in „Pädagogik der Vielfalt“ drei bildungspolitisch aktuelle Entwicklungen von Integration in Gesellschaft und Schule in Deutschland und auch weltweit (Prengel 1995).
Prengel vereinigt den „Gleichheitsgrundsatz“, also Gleichberechtigung im Sinne von gleichberechtigter Teilnahme an gesellschaftlichen Institutionen, mit dem „Freiheitsgrundsatz“, dem Recht auf persönlicher Andersartigkeit. Beide Grundsätze bilden im Sinne eines Sozialkontraktes die Basis der solidarischen Pflicht in einer Demokratie.
Prengel differenziert die Bedeutung von Verschiedenheit und Gleichberechtigung in
- interkultureller Pädagogik,
- feministischer Pädagogik
- und integrativer Pädagogik
Um keine integrative Bewegung auszulassen, möchte ich die beiden ersten Ansätze kurz darstellen, bevor ich dann näher auf die integrative Didaktik eingehe, um die es mir in dieser Arbeit vorrangig geht. Natürlich schließen sich jedoch die drei Integrationsbewegungen nicht gegeneinander aus, sie spielen in unserer gesellschaftlichen Realität eine gleichwertige Rolle, und die Aspekte treten meisten nebeneinander auf – es geht ja gerade um die Heterogenität. Man denke nur an koedukative Erziehung in unseren Schulen und Kindergärten, das Zusammentreffen verschiedener Kulturen und die Problematik mit verhaltensauffälligen und lernschwachen Kindern und Jugendlichen. So habe ich während des Praktikums in einer Grundschule ein körperbehindertes türkisches Mädchen betreut.
1.1.1 Interkulturelle Pädagogik
Die Interkulturelle Pädagogik, auch Ausländerpädagogik genannt, hat ihre Wurzeln in der Reformpädagogik (siehe Kapitel 4.1). Historischer Hintergrund für die Notwendigkeit von interkultureller Pädagogik sind die Auswirkungen rassistischer, kolonialistischer und faschistischer Denkweisen. Ausländerpädagogik thematisiert das Verhältnis zwischen den Angehörigen verschiedener Kulturen und Ethnien im Bildungswesen. Vorrangig geht es um die Eingliederung ausländischer Schüler unterschiedlicher Gruppen in Regelklassen der Mehrheitskultur. Der Großteil dieser Gruppen besteht in Deutschland aus Angehörigen von Arbeitsemigranten, Asylsuchenden, Aussiedlern und alteingesessenen Ethnien wie z. B. Sinti und Roma. Die Bildungssituation dieser Gruppe ist abhängig von der Schul-, Sozial- und Ausländerpolitik des Staates, vom Arbeitsmarkt, vom Wohnungsmarkt, von der Finanzpolitik und von der Dauer des Aufenthaltes der Kinder und deren Familien.
Prengel nennt drei mögliche Zielsetzungen in der Ausländerpädagogik:
- Nach dem „Rotationsprinzip“ werden die Schüler auf ihre Rückkehr in ihr Heimatland in Nationalklassen vorbereitet.
- Das „Integrationskonzept“ geht von einem dauerhaften Aufenthalt aus und sieht den Unterricht in Regelklassen vor.
- Dem „Optionskonzept“ liegen beide Möglichkeiten, also entweder Rückkehr oder Seßhaftwerden, zugrunde. Schwerpunkte sind die Unterstützung von kultureller Identität und die Unterstützung der Eingliederungsfähigkeit durch Vorbereitungsklassen, muttersprachlichen Unterricht, Unterricht in Regelklassen und Beschäftigung mit der Geschichte, Kultur und der Entstehung des Herkunftslandes.
Die Schwierigkeiten der interkulturellen Pädagogik sieht Prengel vor allem in der Heterogenität der Gruppen von ausländischen Schülern aus den verschiedenen Herkunftsländern und Kulturen, der veränderten Beziehung zum Heimatland und in der Bildung einer Migrantenkultur (Prengel 1995, S.64-87).
Ein weiteres Problem der interkulturellen Pädagogik liegt in der Unterstützung ausartender Menschenfeindlichkeiten mancher Kulturen, welche durch die kompromißlose Anerkennung dieser Kulturen ideologisch gestützt werden würde. Diesen Diskurs möchte ich hier nicht weiter ausführen, da hierzu auch das Verhältnis unserer westlichen Kultur mit seinem Menschenbild zur (z. B.) Islamischen überdacht werden muß[2]. Prengel stellt die Diskussion zu Assimilationskonzepten, Eurozentrismus und Kulturrelativismus ausführlich dar (Prengel 1995, S. 74-95).
1.1.2 Feministische Pädagogik
Die feministische Pädagogik beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen dem männlichem und weiblichen Geschlecht im Bildungswesen. Sie geht hervor aus der Frauenbewegung und Frauenforschung und zählt zu deren Schlüsselthemen : Geschichte der Frauen, weibliches Arbeitsvermögen, weibliche Beziehungsformen, weibliche Denkformen, ästhetische und künstlerische Gestaltung, Erfahrungen weiblicher Körperlichkeit, Mütterlichkeit, lesbische Liebe, Unterdrückungserfahrungen (physische und psychische Gewalt, sexueller Mißbrauch, Gesetzgebung), weibliche und schulische Sozialisation sowie Koedukation (vgl. Prengel 1995, S. 118 f).
Ziele der Frauenbewegung sind Demokratie und Gleichberechtigung in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen unter Berücksichtigung der Verschiedenheit der Geschlechter und auch die Akzeptanz und Wertschätzung der Lebensweisen von Frauen im patriarchalischen System. Die verinnerlichte Höherbewertung des Männlichen und die Entwertung des Weiblichen sollen überwunden werden (Prengel 1995, S. 125-138).
Prengel nennt drei Strömungen der feministischen Arbeit :
- Ein Ansatz der feministischen Pädagogik vertritt die Vorstellung von „Androgynität“. Bei dieser Theorie wird die für Vereinigung der dominierenden Verhaltensweisen beider Geschlechter in einem Geschlecht plädiert. Damit sollen die Grenzen der Zweigeschlechtlichkeit verwischt werden. Wichtigstes Ziel ist die gerechte Aufteilung von Erwerbsarbeit, Hausarbeit und Erziehung.
- Die Vertreter der „Gleichheitsoption“ bemühen sich um die Auflösung der Geschlechterhierarchie. Sie sehen die berufliche Karriere der Frauen als Kriterium für Emanzipation; die traditionelle weibliche Lebensweise ist hier ein Indikator für Unterdrückung.
- Im Gegensatz dazu sehen die Verfechter der „Differenzoption“ ausschließliches Denken an die eigene Karriere lediglich als Anpassung an die männlichen Lebens- und Verhaltensweisen. Sie setzen sich gegen die Diskriminierung weiblicher Lebensformen und für eine Höherbewertung des Weiblichen ein.
Die drei Aspekte verdeutlichen die Diskussion „(...) um die Abschaffung der geschlechtshierarchischen oder der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung (..)“ (Prengel 1995, S. 138).
Prengel plädiert für ein pluralistisches Zusammendenken der Theorien, sie schreibt hierzu : „(..) Gleichheit zwischen Frauen und Männern kann nicht ohne die Akzeptanz von Differenz eingelöst werden, und Differenz kann nicht ohne die Basis gleicher Rechte Wertschätzung erfahren.“ (Prengel 1995, S. 132).
Als dritte Bewegung möchte ich Integrationspädagogik kurz definieren und in den späteren Kapiteln näher beschreiben.
1.1.3 Integrationspädagogik – gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern
Für eine allgemeine Definition von pädagogischer Integration beziehe ich mich auf Feuser. Integration bedeutet, daß
1. alle Kinder und Jugendliche bzw. Schüler ohne Ausschluß aufgrund ihrer vorliegenden Behinderung
2. in Kooperation miteinander
3. auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau
4. individuell abhängig von der aktuellen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenz
5. an und mit einem gemeinsamen Gegenstand (Projekt, Thema, Vorhaben) spielen, lernen und arbeiten (vgl. Feuser 1989, S. 22).[3]
Integration meint also nicht gelegentliches Beisammensein bei besonderen Anlässen und einseitige Hilfestellungen der nichtbehinderten Menschen oder die Anpassung sogenannter gesellschaftsfähiger behinderter Menschen an eine Gruppe von Nichtbehinderten. Ebensowenig ist Integration der Versuch der Förderung von Menschen mit Behinderungen zur Herstellung von Homogenität in einer Gruppe, zum Beispiel in einer Grundschulklasse durch lediglich räumliches Zusammenführen von Schülern mit und ohne Behinderungen (vgl. Prengel 1995, S. 139). Ganz im Gegenteil – vermieden werden soll jede Art von Selektion[4] und Segregation[5] – individuelle und kollektive Heterogenität ist erwünschtes Ziel.
Von der Integration ist kein Mensch ausgeschlossen aufgrund seiner Art von Behinderung oder des Schweregrades seiner Beeinträchtigung(en). Die Beeinträchtigungen können sich ausdrücken in einer geistigen Behinderung, körperlichen Behinderung, Lernbehinderung, Sprachbehinderung, Sinnesschädigung, Verhaltensstörung oder Mehrfachbehinderung.
Ich möchte im Folgenden nicht näher auf spezifische Behinderungen eingehen, weil es meiner Meinung nach nicht sinnvoll ist, für integrative Zwecke zwischen den möglichen Beeinträchtigungen zu differenzieren. Als Erklärung dazu möchte ich beschreiben, wie und in welchem Zusammenhang ich den Begriff Behinderung verstehe.
2. Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft
2.1 Was heißt behindert?
Die Begriffsklärung ist wichtig, um den Gedanken der Integrationspädagogik zu verdeutlichen. Der Umgang der Gesellschaft und jedes Individuums mit benachteiligten Menschen sagt viel aus über ihren Zustand, die vorherrschenden Werte und Normen und ethischen Überzeugungen. Und auch ein verändertes Verständnis von Behinderung hat auch ein verändertes Verständnis von Integration zur Folge. Hierzu ist sicherlich der soziale und ökonomische Wandel der Gesellschaft von Bedeutung.
Was assoziieren wir mit dem Begriff behindert überhaupt?
Für Prengel wurden in der bürgerlichen Gesellschaft den behinderten Menschen positive Werte wie Vernunft, Aktivität, Selbstbewußtsein und Selbstbeherrschung abgesprochen und ihnen vermeintlich unveränderliche negative Wesensmerkmale wie Unvernunft, Passivität, Bewußtlosigkeit, und Ungesteuertheit unterstellt (Prengel 1995, S. 145). Diese Sichtweise ist jedoch eher eine veraltete. Ich erwähne sie hier, um deutlich zumachen, daß dem historischen Ursprung der Sonderpädagogik das Bild von einem schwachsinnigen, idiotischen Kind zugrunde lag, welches in dementsprechende Heime bzw. Schulen zu seinen „Gleichgesinnten“ eingewiesen werden mußte.
Meistens ist die sonder- und heilpädagogische Sichtweise medizinisch orientiert, denn eine Körperbehinderung oder hirnorganische Schädigung könnte auch durch einen medizinischen Eingriff behandelt werden. Ich vermute, daß die Sonderpädagogen sich auch aus Prestigegründen wissenschaftlich lieber in der Nähe von Medizinern gesehen haben.
Aus traditioneller Sicht ist eine Behinderung eine Persönlichkeitseigenschaft. Der Mensch wird an seinen Beeinträchtigungen, seinen Defiziten gemessen. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird dies deutlich. Wenn von einem Menschen mit Behinderung gesprochen wird, dann so als wäre die Behinderung seine einzige Eigenschaft : „Peter ist behindert.“ anstatt „Peter hat eine Körperbehinderung.“ oder „Peter hat eine Sprachbehinderung.“.
Das Bild von Menschen mit Behinderungen ist durch un- gekennzeichnet : unvollkommen, unsauber, unspontan, unlogisch, unfähig, unzuverlässig, ungezogen usw. Sie handeln unsinnig, und es wird ihnen von der anderen Seite, den nichtbehinderten und nicht kranken Menschen, Unverständnis entgegengebracht.
Mit der Bildungsreform Ende der sechziger Jahre taucht ein neuer Bewertungsmaßstab auf : das sozio-kulturelle Umfeld der Kinder und die gesellschaftlichen Gegebenheiten rücken in den Vordergrund (vgl. Begemann 1970). Die Vorurteile gegenüber Behinderten nehmen ab.
Im pädagogisch-psychologischen Sinn ist ein Kind mit einer Behinderung jemand der „in seinen pädagogischen Vollzugsbereitschaften, im Lernprozeß und in der erzieherischen Ansprechbarkeit“ beeinträchtigt ist (Bleidick 1972, S. 202).
Die Auffassung von Minderwertigkeit und abweichendem Verhalten hat im Laufe der Zeit sich also stark gewandelt. Mit den Worten der World Health Organisation (WHO) von 1991 bedeutet eine Behinderung eine Benachteiligung bzw. den Verlust oder die Einschränkung der Möglichkeit, gleichberechtigt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Diese Definition gilt als Richtlinie für die Europäische Union (EU) und steht in diesem Zusammenhang natürlich auch für die Forderung nach Chancengleichheit durch Bildungsangebote (vgl. Oertel 1998, S. 101 ff).
In pädagogischen Überlegungen ist nicht mehr die Schädigung des Individuums (die Behinderung/ Beeinträchtigung) der Ausgangspunkt.
Es stehen nun vielmehr die behindernden bzw. entwicklungsbeeinträchtigenden Lebensbedingungen und folglich die soziale Benachteiligung im Vordergrund. Umgangssprachlich ausgedrückt : Behindert ist man nicht – behindert wird man. Oder auch : Behindert sein bedeutet eine bestimmte Reaktion des sozialen Umfelds zu erwarten.
Zur Einschätzung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ist bei Wissenschaftlern und Pädagogen nicht mehr die Art und der Grad der Behinderung der wichtigste Maßstab. Ausschlaggebend ist die Kind-Umwelt-Diagnose unter besonderer Berücksichtigung des Sozialisationhintergrundes des Individuums.
Bei dieser Diskussion darf nicht außer acht gelassen werden, daß die Pädagogen nichts an den Lebensbedingungen der Kinder ändern können. Sie können jedoch die Schüler in ihrem Selbstbewußtsein und ihre Selbstbehauptung fördern, so daß sie auch aus einer widrigen Situation gestärkt hervorgehen können.
Georg Feuser beschreibt in einer Definition ein weiteres, soziologisches Kriterium, nämlich das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Behinderten. Er bezeichnet eine Behinderung als einen sozialen Prozeß und nicht als eine charakteristische Eigenschaft eines Menschen :
„Behinderung verstehen wir als Ausdruck jener gesellschaftlichen, ökonomischen und sozialen Prozesse, die auf einen Menschen hin zur Wirkung kommen, der durch soziale und/oder biologisch-organische Beeinträchtigungen gesellschaftlichen Minimalvorstellungen und Erwartungen hinsichtlich seiner individuellen Entwicklung, Leistungsfähigkeit und Verwertbarkeit in Produktions- und Konsumptionsprozessen nicht entspricht.“ (Feuser 1989, S. 20).
Grundsätzlich ist seit Ende der achtziger Jahre ein weiterer Wandel (vor allem auch in der Sprache) zu verzeichnen : aus Behinderten werden Menschen mit Behinderung – aus der Aktion Sorgenkind wird im Jahr 2000 die Aktion Mensch. In einem Werbespruch wird aus Rücksicht Respekt und aus Toleranz Anerkennung. Vielleicht zeigt sich auch bald eine Änderung in den Köpfen der Zielgruppe dieser Werbeaktion. Von den nichtbehinderten Menschen wird mehr verlangt, als behinderte Mitbürger zu dulden und aus Mitleid zu unterstützen. Die Substantive Anerkennung und Respekt drücken meiner Meinung nach die Gleichwertigkeit deutlicher aus als die Forderung nach Rücksicht und Toleranz zwischen zwei Gruppen. Menschen mit Behinderungen sind nicht mehr nur die Sorgenkinder der Nation. Sie haben eine wichtige Funktion für die Entwicklung der Gesellschaft. Der partnerschaftliche Umgang von Menschen mit und ohne Behinderung bedeutet eine Herausforderung für alle.
Bis auf die Verschiedenheit der Menschen kann ich für mich keine allgemeine Normen für das Menschsein feststellen. Betrachtet man das Leben als dauernde Überwindung von Hindernissen, wäre es nichts anderes als eine Herausforderung im Umgang mit den eigenen und fremden Behinderungen. Behinderungen sehe ich als Lebens-, Erlebens- und Lernchancen.
Wie reagierte die Pädagogik bis heute überhaupt auf die Verschiedenheit der Menschen? Um sie zu erziehen wurden Menschen mit Behinderungen von den anderen getrennt und in speziellen Bildungseinrichtungen unterrichtet.
2.2 Aussondernde Bildungseinrichtungen für Menschen mit Behinderungen
Eine Institution der Sonderpädagogik sind die Sonderschulen. Die große Mehrheit von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf wird hier unterrichtet. Sonderschulen[6] gibt es seit über 100 Jahren in Deutschland, sie sind ein fester Bestandteil unseres viergliedrigen Schulsystems. Auf die historische Entwicklung von Sonderschulen möchte ich hier nicht näher eingehen.
Es gibt in Deutschland in etwa so viele Sonderschulformen wie es Möglichkeiten einer Behinderung gibt. Im Schuljahr 1997/ 1998 werden in Niedersachsen 3,6 % der Schüler des Primar- und Sekundarbereichs in neun differenzierten Sonderschulformen unterrichtet[7] (Niedersächsisches Kultusministerium 1998).
In der Sonderschule werden spezielle, möglichst homogene Schülergruppen mit speziellen Methoden unterrichtet. Durch die institutionelle Trennung sollten die begabten Schüler der Regelschulen entlastet werden und ungestört von den von der Durchschnittsnorm abweichenden Schülern lernen können. Diese Anschauung steht so heute in keinem Schulgesetz mehr. Ich vermute aber, daß in der Schulverwaltung und auch bei manchen Lehrern dieser Gedanke aufgrund der Überlastung und längst überholter Auffassungen durchaus noch präsent ist.
Ausschlaggebend für die Einweisung in eine bestimmte Sonderschule ist die Art von Behinderung des Kindes[8]. Dabei wird nicht berücksichtigt, daß die sogenannte Sonderschulbedürftigkeit wegen einer Behinderung sozio-kulturell bedingt sein kann, und daß von der Norm abweichendes Verhalten durch nicht-normative Sozialisation zu einer Behinderung wird (vgl. Prengel 1995, S. 144). Außerdem kann eine körperliche und psychische Beeinträchtigung durch soziale Benachteiligung bedingt sein und nicht-normatives Verhalten hervorrufen. Auslöser könnten z. B. mangelnde Ernährung sein oder der Alkoholkonsum der Eltern.
Deutlich ist auch, daß eine am Defekt orientierte Selektion bei Sonderschuleinweisungen vorgenommen wird. Sie orientiert sich grundsätzlich an negativen Eigenschaften, welche anscheinend unveränderbar sind und Lernmöglichkeiten
ausschließen. Somit ist durch diese negative Selektion derjenige verhaltensgestört, der die Schule für Verhaltensgestörte besucht, geistig behindert derjenige, der die Schule für Geistigbehinderte besucht, lernbehindert derjenige, der die Schule für Lernhilfe besucht etc..
Der Fehler wird beim Kind angenommen, welches nicht mit der bisher an ihm ausgeübten Didaktik des Lehrers und seiner Interaktion zurecht kommt. Nehmen wir als Beispiel die Sonderschule für Lernhilfe (etwa 80 % der Sonderschüler besuchen diese Schule) : Ist ein Kind lernbehindert, weil es Schwierigkeiten beim Lesen hat oder beim Schreiben oder beim Rechnen? Oder hat es Schwierigkeiten, soziale Regeln zu erlernen und zu befolgen (vgl. Eberwein 1994a, S. 56 f)? Vielleicht liegt der Grund in der Beeinträchtigung auch darin, daß der Schüler Zuhause nicht die Möglichkeit hat, konzentriert zu lernen, oder aus welchen Gründen auch immer.
Und außerdem : sollte nicht sowieso in jeder Schule Lernhilfe angeboten werden? Unsinnig wäre es doch, in einer bestimmten Schule mehr und bessere Lernhilfe anzubieten als in einer anderen Schule.
Weil hier sozusagen der Fehler im System liegt, möchte ich möchte noch einmal deutlich machen, daß
- Lernbehinderungen immer aufgabenspezifisch sind,
- es unmöglich ist, das (Sonder-) Schulsystem nach jeder speziellen aufgabenbezogenen Schwierigkeit weiter zu differenzieren; dann müßte ja jedes Kind seine eigene Schule haben,
- der Versuch einer Zuteilung von Kindern in homogene Gruppen dem Integrationsgedanken widerspricht.
In der Literatur werden noch weitere Argumente genannt, die sich gegen Sonderschulen richten :
1. extreme Diskriminierung und/ durch Segregierung
2. gegenseitige negative Beeinflussung und Fehlen (der Norm entsprechender) positiver Vorbilder[9]. Je heterogener eine Schulklasse ist, desto mehr Eigenschaften sind vorhanden und können voneinander gelernt werden.
3. Gewöhnung an ein pädagogisches Schonklima, welches nicht der Realität „draußen“ entspricht
4. Überforderung der Sonderschullehrer durch Anhäufung von Problemfällen (vgl. Myschker/ Ortmann, 1999, S. 8).
Außerdem sind negative Vorkommnisse und mögliche entwicklungshemmende und die Persönlichkeit beeinflussende Ereignisse an Regelschulen, wie z. B. Gewalt, Sitzenbleiben, Leistungsorientierung, Schülerhierarchien, Schulverweis, Schuleschwänzen, Entlassung ohne Schulabschluß an Sonderschulen nicht ausgeschlossen und ebenso präsent wie an anderen Schulen. Überhöhte Klassenstärken, Stundentafelkürzungen und zu hohe Forderungen an die Lehrer sind keine spezifischen Probleme von Regelschulen, sondern auch die von Sonderschulen
Bestimmte Anregungs- und Entwicklungsmöglichkeiten schließen die homogenen Gruppen in Sonderschulen an sich schon aus, weil es an unterschiedlichen Kontaktmöglichkeiten mangelt.
Neben den Sonderschulen gibt es noch weitere Bildungseinrichtungen für sonderpädagogischen Förderbedarf, nämlich die Förderzentren. Sie sind ein Bestandteil der Rahmenplanung des vom Kultusministeriums vorgeschlagenen Integrationskonzeptes. Ihre Aufgaben sind in den Schulgesetzen geregelt. Die Förderzentren sind meistens umgewandelte oder neu organisierte Sonderschulen, oder sie beinhalten eine Sonderschule und sind so nichts weiteres als eine solche. Aus den Förderzentren werden Sonderschullehrer, Mitarbeiter und Betreuungskräfte an integrative Schulen zur sonderpädagogischen Unterstützung geschickt; sie leisten sozusagen mobile Dienste. Die Förderzentren organisieren auch Fortbildungen für Pädagogen und vermitteln spezielle mediale und materielle Ausstattung.
Ich bemängele an dem Integrationskonzept, welches durch die Förderzentren realisiert werden soll, daß dies lediglich durch eine Umstrukturierung von
Sonderschulen geschieht. Es beinhaltet keine didaktischen Konzepte und gibt einem tatsächlichen gemeinsamen Unterricht keine echte Chance. Eine didaktische Erneuerung, z. B. die Einführung des Offenen Unterrichts zu integrativen Zwecken, würde die sonderpädagogischen Förderzentren bzw. den sonderpädagogischen Förderbedarf überflüssig machen, sofern sie in der Lehrerausbildung berücksichtigt wird.
Bezeichnend ist auch die Haltung zur Sonderpädagogik in den Föderzentren. Sonderpädagogik hat dort die Funktion spezielle Eigenschaften der Kinder zu fördern, um eine Behinderung mit einer anderen besonderen Fähigkeit auszugleichen. Man geht von Entwicklungs- und Lernfähigkeit durch eine spezielle (therapeutische/ psychologische/ medizinische) Behandlung, Betreuung und Beratung aus. Grundlage dafür ist eine spezielle Diagnose, die den Menschen lediglich auf seine Behinderung oder seinen Schaden reduziert.
Ein Beispiel für den aussondernden Charakter von Förderzentren möge an dieser Stelle das Taubblindenzentrum in Hannover sein. Dies ist eine überregionale Ausbildungs- und Heimstätte für taubblinde Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Im Taubblindenzentrum befindet sich auch eine Sonderschule, in welcher taube und/ oder blinde Kinder und Jugendliche und/ oder Kinder und Jugendliche mit mehreren Behinderungen unterrichtet werden, soweit sie im schulpflichtigen Alter sind[10].
Integration wird hier blockiert, da man die Menschen dort nach Art der Behinderung, Entwicklungsstand und nach Alter sortiert. Die Kinder sind weit weg von ihrem Heimatort und von ihren Eltern, fahren meistens nur in den Schulferien nach Hause und haben im Alltag keinen Kontakt mit nichtbehinderten Kindern. Sie haben in ihrem Leben bereits mehrere sonderpädagogische Einrichtungen besucht.
Die Zusammenarbeit des Taubblindenzentrums bezieht sich vorrangig auf weitere behinderungsspezifische Institutionen (z. B. Schulen für Sehbehinderte, Werkstätten für Behinderte und Einrichtungen des Deutschen Taubblindenwerks). Es wird aber auch angeboten, außerhalb des Taubblindenzentrums integrativ
beschulte taubblinde Kinder beratend und betreuend zu fördern (bzw. deren Eltern, Lehrer, Erzieher usw.).
Diese Art von Föderzentrum unterstützt trotz der genannten Kooperationsbemühungen meiner Meinung nach die Aussonderung, da sie in einer künstlichen Welt homogene Gruppen bildet, welche der modernen pluralisierten und individualisierten gesellschaftlichen Wirklichkeit gegenüberstehen. Hier wird noch einmal deutlich, daß auch eine extrem stark ausgeprägte Behinderung diese Art der Isolation nicht begründen kann, denn es gibt keine Grenzen der Integrationschancen aufgrund der Schwere und Art einer Behinderung (siehe S. 11).
Integration ist letztendlich nur durch gelebte Integration möglich und nicht durch vorangegangene Spezifikation, Separation und Ausgliederung. Spezielle Förderbedürfnisse können nicht befriedigt werden, indem sie an einen besonderen Ort gebunden sind. Zumindest nicht dann, wenn ein integrativer Anspruch besteht, und wenn man eine Normalisierung in der Beziehung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung erreichen will.
2.3 Integration und Normalisierung
a) Integration und Normalisierung und Normalisierung in der Gesellschaft
Übersetzt man den international gebräuchlichen, aus dem Latein stammenden Begriff Integration, bedeutet er soviel wie Herstellung eines Ganzen oder Vervollständigung. Gesellschaftspolitisch bedeutet dies, daß eine Gesellschaft erst dann vollständig ist, wenn all ihre Facetten gleichbedeutende Elemente eines Ganzen sind, also auch Menschen mit Behinderungen. Integration ist ein wichtiger Faktor einer stabilen Demokratie und verbindet Menschen mit individuellen Eigenschaften.
Im Jahr 1994 werden in Deutschland 5,37 Millionen Menschen gezählt, die unter das Schwerbehindertengesetz fallen (Statistisches Bundesamt Wiesbaden 1994, S. 507, Angabe Stand Juli 1994); wobei die Menschen mit schweren Behinderungen nur ein Teil der Menschen mit Behinderungen überhaupt sind. Integration bedeutet also nicht die gesellschaftliche Emanzipation für eine Minderheit, sondern für eine große Gruppe.
Die Konzepte zur gesellschaftlichen Integration betreffen ein sehr weites Spektrum von möglichen Ansätzen. Daher möchte ich konkrete institutionelle Bereiche nennen, die bei der Realisierung von Integration eine Rolle spielen.
Ingolf Österwitz nennt sechs integrative Dimensionen :
1. Die räumliche Integration : Wohnungen, Freizeitangebote, Arbeits- und Beschäftigungsplätze sollten dort sein, wo sie auch für andere Menschen selbstverständlich und normal sind.
2. Die funktionelle Integration : Die allgemeine Befriedigung der Lebensbedürfnisse in den üblichen und für alle zugänglichen Bereichen der Umwelt.
3. Die soziale Integration : Betrifft die zwischenmenschlichen Beziehungen und anonyme Beziehungen zu anderen Menschen.
4. Die personale Integration : Die Bedürfnisse nach Beziehungen mit anderen wichtigen Bezugspersonen entwickeln und verändern sich ständig. Ziel ist es, ein befriedigendes privates Leben in Austausch und Gemeinschaft mit anderen führen zu können.
5. Die gesellschaftliche Integration : Bezogen auf die Entwicklung als Mitbürger, auf die Wahrnehmung von Selbstbestimmungsrechten, auf die Einbeziehung in Entscheidungen, die besonders behinderte Menschen angehen.
6. Die organisatorische Integration : Heranziehung allgemeiner öffentlicher Dienste, um den integrativen Prozeß zu fördern (vgl. Österwitz 1996, S. 200).
[...]
[1] Um den Lesefluß nicht zu beeinträchtigen, verwende ich in meiner Arbeit nur die männliche Sprachform für bestimmte Gruppen (Schüler, Lehrer, Pädagogen etc.). Gemeint sind bei diesen Ausdrücken natürlich auch die weiblichen Mitglieder der Gruppen.
[2] Ein aktuelles Thema dazu wäre die Diskussion im die Integration der Türkei in die Europäische Union (EU), trotz ihrer Mißachtung der Menschenrechte.
[3] Auf diese Definition Feusers und den Begriff „gemeinsamer Gegenstand“ werde ich in Kapitel 5.2 noch einmal etwas genauer eingehen.
[4] Selektion im Sinne von Aussortieren durch Leistungsbewertung.
[5] Segregation meint hier : Ausschluß behinderter Menschen.
[6] Früher hießen diese Schulen Hilfsschulen.
[7] Insgesamt besuchen 33 000 Schüler die Schule für Lernhilfe, für Sprachbehinderte, für Erziehungshilfe, für Körperbehinderte, für geistig Behinderte, für Schwerhörige, für Gehörlose, für Sehbehinderte, und für Blinde (Niedersächsisches Kultusministerium 1998).
[8] Kinder mit Körperbehinderungen kommen in die Sonderschule für Körperbehinderte, Kinder mit geistiger Behinderung in die Sonderschule für Geistigbehinderte etc..
[9] Gemeint ist damit, daß sich die Kinder viel voneinander „abgucken“. Sie übernehmen negative und positive Eigenschaften von anderen Kindern.
[10] Ich habe dort vor meinem Studium ein einjähriges Praktikum gemacht.
Details
- Titel
- Offener Unterricht als Ressource der integrativen Erziehung im Grundschulbereich
- Autor
- Erscheinungsjahr
- 2001
- Seiten
- 83
- Katalognummer
- V221598
- ISBN (eBook)
- 9783832461386
- ISBN (Buch)
- 9783838661384
- Dateigröße
- 618 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- integration didaktik projektunterricht wochenplanunterricht sonderpädagogik
- Produktsicherheit
- Diplom.de
- Arbeit zitieren
- , 2001, Offener Unterricht als Ressource der integrativen Erziehung im Grundschulbereich, Hamburg, Bedey Media GmbH, https://www.diplom.de/document/221598

Deutschlands größter Sharing Community
Jetzt Zusammenfassungen, Skripte und Klausuren kostenlos downloaden!
Uniturm.de
Ihre Vorteile als Autor
Geld verdienen Für jedes verkaufte Exemplar erhalten Sie Autorenhonorar - bis zu 40%.Kostenlose Buchveröffentlichung
Als eBook-Studie im Original und / oder auf Wunsch zusätzlich als hochwertiges Fachbuch in unserem renommierten Buchverlag.
Renommee als Fachbuchautor
Präsentieren Sie sich als Fachfrau oder Fachmann in Ihrem Fachgebiet und machen Sie sich bekannt.
Persönliche Betreuung
Unser Lektorat wird Sie persönlich betreuen und ist auch telefonisch unter +49(0)176-85996762 erreichbar.
Weltweit im Buchhandel
Ihr Buch ist weltweit im Buchhandel und Online-Buchhandel wie z.B. amazon erhältlich.
Jetzt Autor werden!
- Copyright
- © Bedey & Thoms
Media GmbH - seit 1997
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
-
Diplom.de steht seit 1996 für die professionelle und
hochwertige Veröffentlichung akademischer
Abschlussarbeiten im Original als eBook und Buch.
-
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten,
Magisterarbeiten, Dissertationen und andere
Abschlussarbeiten aus allen Fachbereichen
und Hochschulen können Sie bei uns als eBook
sofort per Download beziehen oder sich als Buch
zusenden lassen.